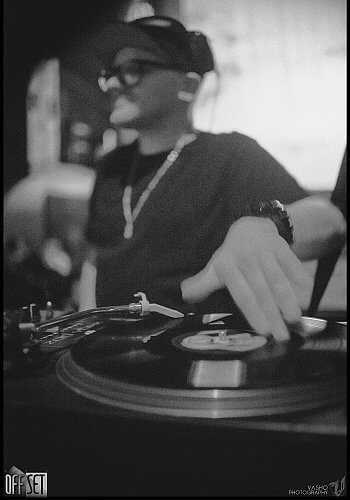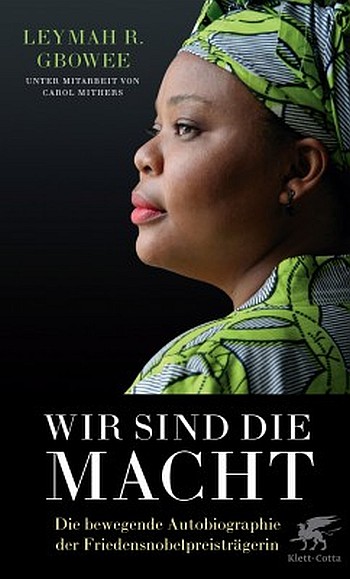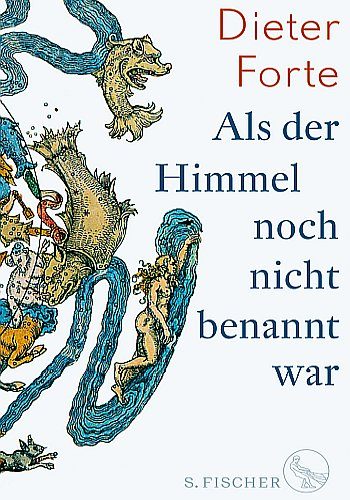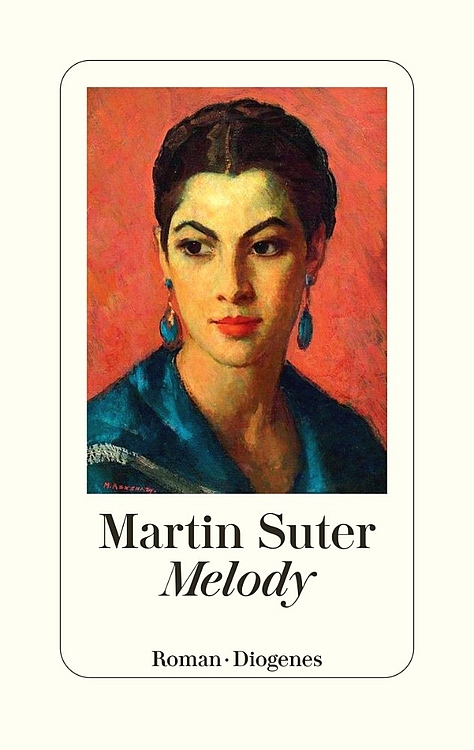Um das Leben der in Klagenfurt geborenen und unter tragischen Umständen in Rom gestorbenen österreichischen Schriftstellerin Ingeborg Bachmann (1925 – 1973) ranken sich zahlreiche Mythen, noch geschürt durch lange unveröffentlichte Nachlassfragmente und gesperrte Briefwechsel. Am 17. Oktober jährt sich ihr Todestag zum 50. Mal. Der jüngere Bruder Heinz erinnert sich an ›Ingeborg Bachmann, meine Schwester‹ und gewährt Einblicke in das Familienalbum. Von INGEBORG JAISER
 Sie war zugleich Femme fatale und Fräuleinwunder der deutschsprachigen Nachkriegsliteratur: vielgestaltig, undurchsichtig, rätselhaft. Mal mit Scheuem-Reh-Attitüde bei der Niendorfer Tagung der Gruppe 47, mal als durchgestyltes Cover-Girl auf der Spiegel-Titelseite – als erste Frau überhaupt. Mit Männern hatte sie kein nachhaltiges Glück, auch wenn Paul Celan, Max Frisch, Werner Henze und wohl auch Henry Kissinger zu ihren temporären Liebhabern und Partnern gehörten. Zahlreiche Biographen, Herausgeber und Literaturwissenschaftler haben sich um Deutungsversuche zwischen Leben und Werk Ingeborg Bachmanns bemüht. Und im Vorgriff auf den 50. Todestag (am 17.10.2023) der berühmten Tochter der Stadt wurde bereits im Sommer die bescheidene Grünfläche vor dem ORF-Landesstudio Kärnten zum »Ingeborg-Bachmann-Park« umgewidmet – nach all den bereits bestehenden Ingeborg-Bachmann-Plätzen, -Gymnasien, -Denkmälern und -Wegen, ganz zu schweigen von einer der wichtigsten literarischen Auszeichnungen im deutschen Sprachraum, dem Ingeborg-Bachmann-Preis.
Sie war zugleich Femme fatale und Fräuleinwunder der deutschsprachigen Nachkriegsliteratur: vielgestaltig, undurchsichtig, rätselhaft. Mal mit Scheuem-Reh-Attitüde bei der Niendorfer Tagung der Gruppe 47, mal als durchgestyltes Cover-Girl auf der Spiegel-Titelseite – als erste Frau überhaupt. Mit Männern hatte sie kein nachhaltiges Glück, auch wenn Paul Celan, Max Frisch, Werner Henze und wohl auch Henry Kissinger zu ihren temporären Liebhabern und Partnern gehörten. Zahlreiche Biographen, Herausgeber und Literaturwissenschaftler haben sich um Deutungsversuche zwischen Leben und Werk Ingeborg Bachmanns bemüht. Und im Vorgriff auf den 50. Todestag (am 17.10.2023) der berühmten Tochter der Stadt wurde bereits im Sommer die bescheidene Grünfläche vor dem ORF-Landesstudio Kärnten zum »Ingeborg-Bachmann-Park« umgewidmet – nach all den bereits bestehenden Ingeborg-Bachmann-Plätzen, -Gymnasien, -Denkmälern und -Wegen, ganz zu schweigen von einer der wichtigsten literarischen Auszeichnungen im deutschen Sprachraum, dem Ingeborg-Bachmann-Preis.
Familiärer Zusammenhalt
Nach all diesen Würdigungen überrascht der eben erschienene Erinnerungsband ›Ingeborg Bachmann, meine Schwester‹ durch bescheidene Zurückhaltung. Es ist der Versuch des 13 Jahre jüngeren Bruders Heinz, einem lange in Afrika und dem Nahen Osten arbeitenden Geologen, das Leben seiner Schwester Ingeborg aus privater, familiärer Sicht neu zu erzählen. Auch wenn er als »Spätling« nur schemenhafte Erinnerungen an ihre Schulzeit haben kann und er sich erst in den Sechzigerjahren »auf Augenhöhe« mit seiner großen Schwester gefühlt hat, wie er selbst gesteht. Doch anrührende, vielfach unbekannte Fotos aus dem Familienalbum und tradierte Erzählungen aus dem Alltagsleben schließen mögliche Lücken glaubhaft und stimmig.
Besonders wichtig erscheint es Heinz Bachmann, den engen, über Jahrzehnte und weite räumliche Distanzen hinweg bestehenden familiären Zusammenhalt zu betonen. Offenbar besuchte man sich gerne und schrieb regelmäßig Briefe. Reiselustig, umtriebig, bewegungsfreudig und polyglott dürfte die ganze Familie gewesen sein. Es wird von abenteuerlichen Reisen der Eltern mit dem Rad berichtet, nach Italien oder zu Verwandten ins 90 Kilometer entfernte Gailtal, mit den Kindern auf dem Gepäckträger. Ingeborg soll sich auch gerne mit ihrem Vater auf Italienisch unterhalten haben. Überhaupt wird das Vater-Tochter-Verhältnis durch Heinz Bachmann als vertrauensvoll und liebevoll dargestellt, obgleich viele Biographen (und natürlich Ingeborg Bachmann selbst) eine zutiefst ambivalente Haltung erspürt haben. Die gnadenlose, grausame Vaterfigur in ›Malina‹ gibt Zeugnis davon.
Es war ein Wirbel, der nie aufhörte
Und sollte die praktizierte Reiselust der Eltern prägend für die Kinder gewesen sein? Sowohl Heinz als auch Ingeborg haben lange Zeit im Ausland gelebt, mit ständig wechselnden Wohnsitzen, Aufenthaltsorten, Fixpunkten. Mehr als einmal müssen große Geldbeträge transferiert und Seilschaften aktiviert worden sein, um einander in Notsituationen zu helfen. Bereits die Finanzierung von Ingeborgs Philosophie-Studium in Wien verschlang alle Reserven. »Auch die ganzen Fotogeräte wurden verkauft«, schreibt Heinz Bachmann. »Daher gibt es ab dieser Zeit keine Familienfotos mehr.« Doch gegenseitige Anteilnahme, Austausch und Inspiration wurde stets gelebt. Noch heute ist Heinz Bachmann stolz darauf, dass fast wörtliche Zitate aus seiner geologischen Dissertation Eingang in ›Das Buch Franza‹ gefunden haben.
Auch wenn Ingeborg Bachmann oft ruhesuchend nach Klagenfurt zurückgekehrt ist, drehte sich ihr Leben immer schneller – »es war ein Wirbel, der nie aufhörte und körperlich wie seelisch sehr anstrengend war«, schreibt ihr Bruder. Über die wechselnden Beziehungen seiner Schwester scheint er informiert gewesen zu sein – auch wenn er im Nachhinein auf jegliche Animosität verzichtet, der öffentlichen Wahrnehmung höchstens eine persönliche Sichtweise hinzufügt. So schreibt er über Ingeborg Bachmanns Wiener Zeit: »Aber in unserer Familie hatte Paul Celan nie die Bedeutung, die Hans Weigel in diesen Jahren besaß.« Und später konnte »Herr Frisch« trotz Geschenken und beeindruckendem Auto nie überzeugend punkten (»Ganz allgemein fehlte es an Herzlichkeit.«).
Noch fünf Jahrzehnte nach Ingeborg Bachmanns Tod sind Heinz Bachmanns Erinnerungen von Trauer und einem unterschwelligen Bedauern über mögliche Versäumnisse, Abwesenheiten, Nachlässigkeiten durchzogen. Das gibt diesem Buch einen sehr menschlichen, persönlichen Touch. Schade nur, dass der Verlag auf einen Anhang mit bio-bibliographischen Daten verzichtet hat, auf die man als Leser gerne zurückgreifen würde.
Titelangaben
Heinz Bachmann: Ingeborg Bachmann, meine Schwester
Erinnerungen und Bilder
München: Piper, 2023
125 Seiten, 24,- Euro