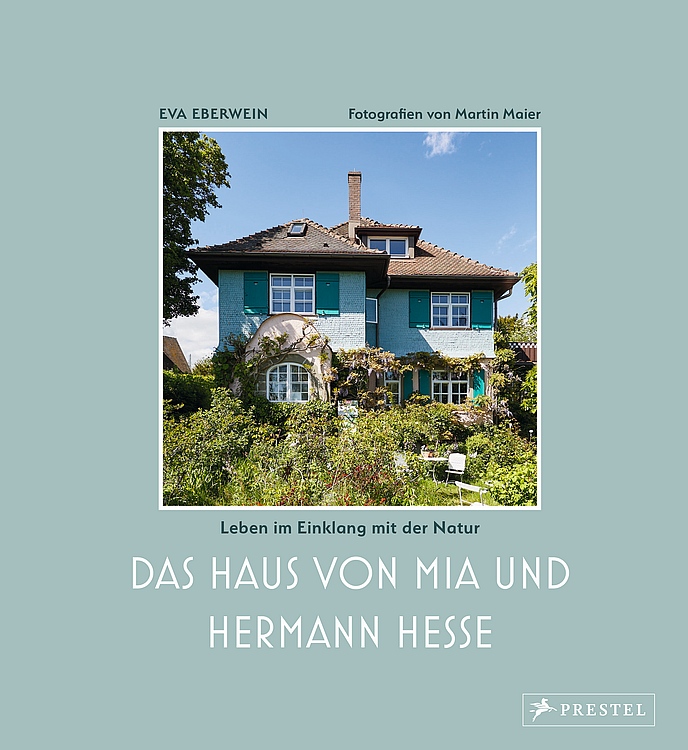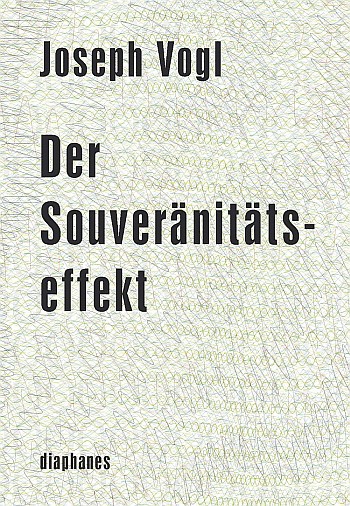Es war am Abend, ich war müde und griff zum Buch. Ich las und was ich las, machte mich zufrieden, entspannt, fast glücklich. Ich konnte das Geschriebene nachvollziehen und es war in einem warmherzigen, persönlichen Ton geschrieben. Elke Heidenreichs Buch ›Altern‹ ist so ganz anders als ›Shitbürgertum‹ von Ulf Poschardt. Dieses las ich den Tag über, um herauszufinden, was der Journalist mitzuteilen hatte. Ich gewöhnte mich über den Tag an einen Ton, der geradezu ätzend aggressiv war; an einen Stil, der sehr viele Setzungen machte, die man als Leser zu schlucken hatte.
Wer sind eigentlich diese Shitbürger – fragt BASTIAN BUCHTALECK
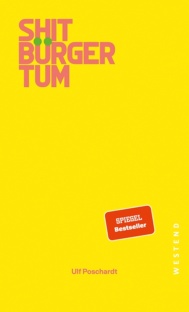 Das Buch wendet sich schon im Titel gegen Shitbürger. Darunter versteht Poschardt Deutsche Banker, die Linke, die Grünen, Angela Merkel, Ursula von der Leyen, den Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk, rot-grünes Bürgertum, Schönwettermatrosen und nicht zuletzt diejenigen, gegen die sich Trumps Wahlkampfreden richten. Im Prinzip kann es nahezu jeden treffen.
Das Buch wendet sich schon im Titel gegen Shitbürger. Darunter versteht Poschardt Deutsche Banker, die Linke, die Grünen, Angela Merkel, Ursula von der Leyen, den Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk, rot-grünes Bürgertum, Schönwettermatrosen und nicht zuletzt diejenigen, gegen die sich Trumps Wahlkampfreden richten. Im Prinzip kann es nahezu jeden treffen.
Wie kommt Poschardt auf diese Menschen und Menschengruppen? Laut dem Buch sind es all jene, die Neid empfinden, weil sie unglücklich über ihren Platz in der Gesellschaft sind. Trennscharf ist etwas anderes und so eröffnet sich die Frage, wie man mit einem Buch umgeht, das über 180 Seiten lang gegen ein Shitbürgertum wettert, welches es nie wirklich definiert.
Ein unzuverlässiger Erzähler
In der Literaturtheorie gibt es den »unzuverlässigen Erzähler«. Dies ist eine Figur des Autors, deren Ausführungen nicht immer glaubwürdig sind und sie wird eingesetzt mit dem Ziel, den Leser in ein Spiel um Wahrheit und Erfindung zu verwickeln. Der unzuverlässige Erzähler gehört zur fiktionalen Literatur.
In ›Shitbürgertum‹ ist der Autor ein solch unzuverlässiger Erzähler. Im Kapitel »Celan und die Gruppe 47« bezeichnet Poschardt diese Literatenvereinigung als »antisemitischer Sauhaufen« (Seite 35). Zum Beweis werden Günter Eich, Siegfried Lenz, Karl Krolow und Martin Walser angeführt. Alle Schriftsteller hatten Berührungspunkte bis hin zur Nähe zu den Nationalsozialisten. Gleichzeitig gelten sie alle mehr oder auch stärker als unverdächtig in Hinsicht auf Antisemitismus. Was also? Ein zuverlässiger Erzähler würde abwägen und sich um Neutralität bemühen. Der unzuverlässige Erzähler biegt die Fakten, bis er seine Schlussfolgerungen präsentieren kann.
Nicht nur an dieser Stelle setzt Poschardt Feststellungen, die seine Argumentation und somit sein Weltbild stützen, die zugleich eher nicht so sind, wie der Journalist und Autor es gerne hätte. Dies führt dazu, dass man das Buch entweder mit großer Vorsicht lesen muss oder als eine satirisch überspitzte Groteske.
Giorgia Meloni Kommunistentochter
Im gleichen Kapitel schreibt er über die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni: »Als Tochter eines Kommunisten führte sie ihre neo-post-faschistische Partei in die Mitte – und hat damit all das an dunkler Geschichte integriert, was weiterhin ein Teil der italienischen Identität geblieben ist.« (Seite 38) Unabhängig davon, wie man sich vorstellen soll, dass dunkle Geschichte integriert wird, wenn man eine postfaschistische Partei in die Mitte der Gesellschaft führt, stimmt es, dass Meloni ihren Vater als überzeugten Kommunisten bezeichnet hat.
Gleichzeitig verschweigt der unzuverlässige Erzähler, dass Meloni seit ihrem ersten Lebensjahr bei ihrer Mutter aufwuchs und ihren Vater, der dann schon in einem anderen Land lebte, nur einmal im Jahr besuchte. Der unzuverlässige Erzähler verschweigt auch, dass Melonis Mutter im neofaschistischen Movimento Sociale Italiano (MSI) und deren Nachfolgepartei Alleanza Nazionale tätig war. Meloni selbst trat schon mit 15 Jahren in deren Jugendorganisation ein.
Warum sind diese Feststellungen so wichtig? Schon nach einem Viertel, Fünftel, Achtel des Buchs ist klar, Poschardts Schlussfolgerungen basieren auf einer Faktenbasis, die mehr Ausdruck seiner Weltsicht ist, als der Welt an sich. Die Faktenbasis wird dem Weltbild angepasst und nicht das Weltbild der Welt. Im Prinzip dürfen alle Schlussfolgerungen im Buch angezweifelt werden.
Die beste Stelle des Buchs
In seiner besten Passage wendet sich das Buch gegen das links-grüne Bildungsbürgertum: »Die eigenen Kinder nicht mit faktisch unbeschulbaren Migranten aus prekären Verhältnissen in dieselbe Klasse schicken zu wollen, macht Sie nicht zu einem schlechten Menschen, weil es ja dort noch diejenigen gibt, die Migranten samt und sonders abschieben möchten. Und besser als die sind Sie ja allemal. Wären die nicht rechts, wären Sie nicht links. Wären die nicht schlecht, wären Sie nicht gut. Und weil dieser Selbstbetrug das einzige Erlösungsversprechen ist, das Ihnen seit Ihrem Austritt aus der katholischen Kirche geblieben ist, haben Sie ihn unter dem Schlagwort »Kampf gegen rechts« sogar institutionalisiert.« (Seite 78).
Diese Worte wurden bei den Wiener Festwochen an ein Publikum aus dem rot-grünen Milieu gerichtet, und zwar von Robert Willacker. Wenn Poschardt Willacker zitiert, wird deutlich, wie klar man argumentieren kann. Dagegen walzt das Buch »Shitbürgertum« sein Thema auf knapp 180 Seiten aus und trifft es doch nicht.
Geröllhaufen, Gewalt, Kraftausdrücke
Die Sprache des Buchs passt zum Inhalt. Wie ein Geröllhaufen walzt sie sich Satz für Satz, Seite für Seite durch das Buch. Es steckt eine urtümliche Gewalt in der Sprache, gerade weil Poschardt auf Differenzierungen verzichtet, weil er sich für Schlagworte, für deftige Worte und für sehr klare Aussagen entschieden hat.
Am Ende des Buchs formuliert Poschardt, er wolle das Shitbürgertum »mit den Widersprüchen in seinen Wahrnehmungen konfrontieren« (Seite 168). Es ist anzunehmen, dass er eine derart drastische Sprache nutzt, um gehört zu werden. Die Forderung ist, der Shitbürger soll differenzierter auf andere Menschen und Meinungen reagieren, um liberalere Beziehungen zu anderen Teilen der Gesellschaft zu unterhalten (vgl. Seite 168). Dies ist ein ernstzunehmender Vorschlag, der daran krankt, dass das Buch dies selbst überhaupt nicht erfüllt. Es ist voller Widersprüche in der eigenen Wahrnehmung, geht absolut nicht differenziert mit den Menschen und Meinungen um und wirkt entsprechend wenig liberal in seiner Haltung.
Immer wieder Poschardt
Wenn das Buch also wenig genau argumentiert, dabei unflätig ist und kaum vertrauenswürdig, wovon handelt es überhaupt? Schon im Vorvorwort versteckt sich der beste Hinweis darauf, wenn Poschardt über Trumps Wahlkampfreden und sein eigenes Buch schreibt: »in denen sich große Wahrheiten und historische Analysen mit dem Zorn jener, die aus dem privilegierten Diskurstheater ausgeschlossen sind« (Vorvorwort) verbinden. Trump, er, große Wahrheiten – kleiner will er nicht.
So entsteht bei der Lektüre der Eindruck, es geht häufig nicht wirklich um das Shitbürgertum (wie könnte es auch, da es nicht trennscharf definiert wurde). Es geht um Ulf Poschardt, der, wie geschrieben, daran knappst, aus dem privilegierten Diskurstheater ausgeschlossen zu sein. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Fazit
Insgesamt ist das Buch einer Pistolenkugel vergleichbar, die einmal abgefeuert ihr Ziel verfehlt, als Querschläger durch den Raum irrt und dabei gefährlich ist. Dem Buch als Irrläufer fehlen klare Definitionen und es leidet unter dem unzuverlässigen Erzähler. Es liest sich wie ein beleidigter Aufschrei. Wenn man nicht mitmachen darf, dann macht man eben kaputt. Macht kaputt, was euch kaputt macht, steht auf dem Klappentext und das ist der treffende Eindruck: Mit ›Shitbürgertum‹ will Poschardt kaputt machen.
Das hat zur Folge, dass der Leser auch kluge, wahre Gedanken, die in dem Buch stecken, nicht herauslesen kann, weil die hastigen, atemlosen Wortanhäufungen ein Big Noise erzeugen, in dem die Wahrheit schlicht untergeht. Wer schon vorher derselben Meinung ist wie der Autor, nickt ab. Alle anderen überzeugt der Autor mit seinem Buch nicht.
Insofern ist ›Shitbürgertum‹ tatsächlich ein Shitbuch. Eine Sammlung haltloser Thesen, denen eine faktische Grundierung fehlt. Unzuverlässig, launisch, ungenau und obendrein selbstverliebt präsentiert Poschardt seinen Privatglauben und verlässt zu häufig den Rahmen der geteilten Realität.
Titelangaben
Ulf Poschardt: Shitbürgertum
Regensburg: Westend Verlag 2025
176 Seiten, 22 Euro
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander