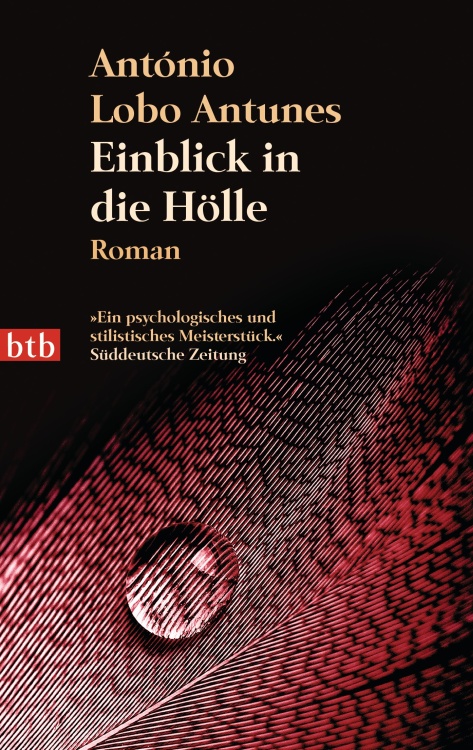Umrisse eines Porträts des französischen Epikers Richard Millet von WOLFRAM SCHÜTTE
Zuerst der Name: Millet. Bislang gab es nur einen der ihn in der Kunstgeschichte trug: der französische Maler Jean-Francois Millet, aus einer normannischen Bauernfamilie stammend und 1875 gestorben, „widmete sich siebenundzwanzig Jahre lang, bis zu seinem Tod, einer Aufgabe: aufzudecken, unter welchen Bedingungen die französischen Bauern lebten“ – schrieb John Berger über ihn.
Der englischen Schriftsteller – Kunsthistoriker, Erzähler und selbst Maler –, der seit Jahrzehnten auf einem Dorf in der Haute Savoie, südlich den Genfer Sees lebt, hat 1976 unter dem Titel „Millet und der Bauer“ dem Maler einen seiner großartigen Essays gewidmet. Nicht ohne Grund: nach Millets Tod, bemerkt John Berger, „gehörten einige seiner Bilder zu den bekanntesten gemalten Bildern der Welt… Auch heute gibt es, glaube ich, kaum eine Bauernfamilie in Frankreich, die nicht seine Bilder durch Stiche, Karten, Ornamente oder von Tellern her kennt… Der Stolz, mit dem eine Klasse sich zum erstenmal erkennbar in einer beständigen Kunstform abgebildet sieht, ist freudig, auch wenn die Kunst nicht makellos und die Wahrheit bitter ist“.
Denn Jean-Francois Millet „wußte vor allem, daß die Bauern damals zu einem brutalen Dasein verurteilt waren, speziell die Männer“. Millets Geschichtsbild war passiv und pessimistisch, fährt John Berger fort, aber der französische Bauern-Maler habe „etwas gespürt, was damals kaum ein anderer voraussah: daß … der durch die Industralisierung geschaffene Markt, dem die Bauern geopfert wurden, eines Tages den Verlust jedes historischen Gefühls mit sich bringen könnte. Darum wurde der Bauer für Millet der Inbegriff des Menschen, und deswegen ging er davon aus, daß seine Gemälde eine historische Funktion hatten“.
John Berger, der in London geboren wurde und nicht aus einer bäuerlichen Familie stammt, bewundert aber auch deshalb gerade Millet, weil der dichteste Teil seines eigenen erzählerischen Oeuvres, die zwischen 1982 und 1991 entstandene Trilogie „Sauerde“, „Spiel mir ein Lied“ und „Flieder und Flagge“, geschrieben wurde „im Geist der Solidarität mit diesen ›Rückständigen‹ (den Bauern), ganz gleich, ob sie noch in Dörfern leben, oder gezwungen wurden, nach Metropolis auszuwandern“. Der partielle Rückzug John Bergers aufs Land ist so etwas wie eine symbolische Teilhabe an der aussterbenden bäuerlichen Lebenswelt. Trotzdem bleibt der Wahl-Savoyade Berger ein (linker) Intellektueller und Kosmopolit. Wie Jean-Francois Millet, diesen Vorläufer im Geiste, kommt Bergers Zeugenschaft vom „bäuerlichen Universum“, wie P.P.Pasolini die auch von ihm betrauerte rurale Welt nannte, ohne Sentimentalität oder gar reaktionärer politischer Nostalgie aus.
Es scheint mir kaum denkbar, daß Richard Millet, 1953 in der Corrèze geboren und heute als Verlagslektor in Paris lebend und arbeitend, weder seinen großen malerischen Namensvorgänger kennt, noch den auch in Frankreich bekannten englischen Schriftsteller, der den bäuerlichen Freunden in der Haute Savoie seine Stimme geliehen hat. Denn die künstlerischen, beruflichen und existenziellen Interessen in diesem Personen-Dreick liegen so nahe und dicht beieinander, daß eine pure Koinzidenz der offensichtlichen Korrespondenzen sehr verwunderlich wäre. Aber meines Wissens hat sich Richard Millet bisher zu den hier von mir imganinierten Verwandtschaftsverhältnissen nicht geäußert; auch nicht die mir zugängliche französische Kritik.
Überhaupt verdanken ja deutschsprachige Leser die Lektüre-Möglichkeit von Richard Millets Romanen „Der Stolz der Familie Pythre“ und „Die drei Schwestern Piale“ der Entdeckungsfündigkeit des jungen Alexander Fest Verlags – und der Meisterschaft Christiane Seilers, die als Übersetzerin auf Anhieb eine Aufgabe löste, die angesichts des Schwierigkeitsgrades von Millets ausufernden Prosa-Perioden mehr als André-Gide-Preis würdig ist, den sie dafür zurecht erhalten hat. Hoffentlich ist sie gerade dabei, den 3. Band („Lauvre le pur“) von Millets Roman-Trilogie zu übersetzen, in der die „im Verschwinden begriffene ländliche Welt mit der gewaltvollen Stadtkultur konfrontiert wird“ (Millet) – was übrigens Erzählgegenstand auch von John Bergers Roman „Flieder und Flagge“ war. Freilich dürfte Millets Trilogie dann im Rowohlt-Verlag erscheinen, dessen Verlagsleiter Alexander Fest in diesen Tagen wurde, in dem sein Verlag aufgegangen ist
Wir wissen wenig über das Oeuvre Millets vor den beiden übersetzten Romanen und auch wenig von dem französischen Autor, der zwar in der Corrèze geboren wurde, aber auch im Libanon aufwuchs und deshalb arabisch spricht, sich jedoch geprägt sieht vom protestantischen Vater und der katholischen Mutter. „Ich bin ein orientalischer Jansenist“, hat er im Hinblick auf die Spannung von Sinnlichkeit und Intellektualität, von Sexualität und Todespräsenz in seiner Trilogie bekannt. Seit Anfang der 80iger Jahre hatte er Romane, Erzählungen und Theaterstücke veröffentlicht, ohne sich wirklich einen auffälligen Namen zu machen, obwohl er sogar für einen Essay über „Le sentiment de la langue“ den Preis der Académie Francaise erhalten hat.
Erst 1995 mit dem „Stolz der Familie Pythre“ sorgte Richard Millet in der französischen Kritik für ein irritiertes Aufsehen , das sich zu Respekt und Bewunderung mit der 1997 erschienen „Liebe der drei Schwestern Piale“ steigerte. Da war auf einmal ein „düsteren Giono und ein Fortsetzer Célines“ vorhanden, obwohl „ein Aufschrei durch das Feuilleton ging, weil die Begräbnisszene der ›Pythres‹ ebenso schockierte wie die unbarmherzigen Schicksale der Personen und der Stil“, bemerkt der Autor rückblickend nicht ohne Stolz.
Der literarische Skandal war von jeher das Entréebillett zum beginnenden Ruhm in der französischen Literatur – selbst wenn Millet heute souverän behauptet, der Erfolg seiner Trilogie in Frankreich sei ein Mißverständnis, weil die „meisten Franzosen ursprünglich zwar aus ländlichen Gegenden stammen, aber voller Nostalgie zurückblicken auf ihre Wurzeln, die sie zugleich auch verachten“ und Millet eben diese „Ambivalenz bloßlegen“ wolle. Denn er schreibt nicht nur über die (bäuerliche) Provinz, sondern zugleich auch gegen ihre nostalgische Idyllisierung, sei´s in der familiären Erinnerung, sei´s durch die Werbung und die Tourismus-Industrie.
Richard Millet hat sich ausgerechnet den Teil von „la douce France“ gewählt, der – weit entfernt von aller landschaftlichen Süße und dem Meer – zu den bitterärmsten, abgelegensten und unwirtlichsten Gegenden unseres Nachbarn gehört: das von eisigen Winden durchpeitschte, von steil abfallenden tiefen Tälern zerschnittene Hochplateau der Millevaches, der „1000 Quellen“ (und nicht Kühe, wie man aufgrund des Namens annehmen könnte). Lieblich ist da nichts, also auch kein Wiesenland für Viehzucht, und der granitene Boden ist schwer zu bearbeiten, wo er sich nicht gar zu mit dichten Nadelhölzern bewachsenen Bergen aufwirft. Dieser Teil Zentralfrankreichs in dem Departement der Corrèze, wohin das Meeresklima nicht reicht, gilt als das „Sibirien“ des an so vielen milden landschaftlichen Schönheiten reichen Nachbarlandes; die Jahrhunderte französischer Geschichte sind an ihm vorbeigegangen wie ein Tag – an dem die Hunnen bis hierher vorgedrungen waren.
Aber Richard Millet hat noch erlebt, wie sich seit den Fünfziger Jahren diese Ödnis eines harten Lebens mit verschlossenen Menschen rapide entvölkert hat und die wasserreiche Gegend für die ferne Metropole Paris nur als Standort für Stauseen von zentralistischem Interesse wurde, was die spärlich verbliebenen Bauern auch noch um die alten und letzten Lebensgrundlagen brachte und die Dorfgemeinschaften endgültig zerstörte. „Es war der Tod dieser Gesellschaft, ihrer Menschen, ihres Dialekts und ihrer Berufe, der mich genötigt hat, gegen das Vergessen anzuschreiben. Denn diese Gesellschaft ist durch nichts ersetzt worden, es herrscht nun eine schreckliche Leere, eine Art Nacht“ (Millet).
Mit dem Tod beginnt die dreiteilige Epopoe der Millevache. „Der Stolz der Familie Pythre“ hebt mit dem Paukenschlag eines ebenso geheimnisvollen wie lapidaren kurzen Satzes an: „Im März begannen sie merklich zu stinken“; und er setzte sich fort im Trommelwirbel einer düster rollenden Satzperiode, die über eine halbe Druckseite sich fortsetzt und Rhythmus und Tonhöhe, Modulation und Durchführung in der Prosa bestimmen, die da kommen wird auf den folgenden 364 Seiten: „Ein bißchen roch man es immer, je nach Wetterlage, sobald der Winter zu weichen schien und es sich wieder regte, sich uns, zunächst ohne daß man es wahrhaben wollte, in Erinnerung rief, alt und arglos wie ein Schmerz, den man überwunden geglaubt hatte und gern vergessen hätte, der sich aber in Schüben zurückmeldete, verhaßt wie die Darmwinde einer geliebten Frau; und jeden, der es roch, sollte es verfolgen – am meisten von allen Chat Blanc, der den ersten faden, süßlichen, dann hartnäckigen, boshaften, siegreichen und empörenden Geruch noch riechen sollte, als er das enge heimatliche Tal von Prunde, das am östlichen Rand der Hochebene lag, längst verlassen hatte, damals, als das Jahrhundert zuende ging, ein neues Zeitalter anbrach und man uns auf unserem Granitsockel vergessen hatte, die wir, von Elend und Kälte in Stein gehauen, außerhalb der Zeit standen und vielleicht sogar unsterblich waren, nicht als Individuen, sondern in der Folge vom Vater auf den Sohn, aus der Tiefe der Zeiten herauf durch den tönenden Fortbestand der Familien- und Vornamen, und weil wir in uns Fasern hatten, die so zäh waren wie die Buche, wie Fels und Winter oder der Nordwind über der Heide“.
Es ist der Verwesungsgeruch der Leichen von im Winter Gestorbenen – wie der ärmlichen Witwe und Mutter des jungen Chat Blanc, dem Gründungsvater der Pythres, deren ländliche Odyssee durch die Zeit bis in die 70iger Jahre erzählt werden wird. So steinhart ist der winterliche Granitboden dort, daß die Toten in einem Schuppen auf Pfählen, „der wie ein in den Himmel gebauter Kaninchenstall aussah“, aufbewahrt werden mußten und erst im Frühjahr, wenn ihr Gestank penetrant die Luft verpestete, auf dem abgelegenen Friedhof des nächsten größeren Dorfes beerdigen konnten.
Der Geruch des Todes wird die Pythres nicht verlassen, und erst mit dem Fäkaliengestank des schwachsinnigen Jean, des unehelich geborenen Letzten des Geschlechts, der seine Scheißhaufen ins Freie neben die Kirche setzt, endgültig vergehen. Er beendet die Pythre-Dynastie – das „Te Deum“(„Le Monde“) einer schweigsamen, ebenso männlich gewalttätigen, wie weiblich duldsamen, immer im Abseits oder am Rande der über sie tuschelnden Dorfgemeinschaft lebende Familie, die nicht nur „von Elend und Kälte in Stein gehauen“ schien, sondern auch während der Akte ihrer verzweifelter Sexualität, bei der die Männer die Schöße der Frauen „durchpflügen“, um „das Glück“ zu finden, die Eiseskälte ihrer lieblosen Einsamkeit nicht zum Abschmelzen bringen konnte.
Es mindert die epische Eigenart Richard Millets nicht, wenn man, besonders im „Stolz der Familie Pythre“, den mächtigen Schatten William Faulkners auf dieses französische „Yoknapathawpha“ fallen sieht. Auch die großen lateinamerikanischen Epiker – wie García Márquez und Vargas Llosa – haben von dem nordamerikanischen Südstaatler für ihre „Beschwörung des Imperfekts“ (Thomas Mann) gelernt. Vorallem hat Richard Millet von Faulkner nicht nur das katastrophisch zwischen dumpfer Sprachlosigkeit, sexueller Gewalt und psychischer Debilität oszillierende Personal und die absteigende Linie eines sich auflösenden ländlichen Familienverbandes übernommen („Sartoris“, „Schall und Wahn“, „Als ich im Sterben lag“), samt der archaischen Einbindung der Menschen in Natur und Geschichte eines „in Ungnade gefallenen Stücks Land, das ihnen allen zum Verhängnis wird“ (Millet). Der Franzose hat auch – als Literaturwissenschaftler und Lektor, der zu den „gelehrten Dichtern“ gehört – erkannt, daß das historisch Vergangene nicht vitalistisch-realistisch (à la Giono), sondern nur sprachlich-rhetorisch evozierbar ist: wie in der kubistischen Montage-Epik seines älteren Landsmanns Claude Simon oder den Stimmen-Oratorien des bürgerlich-familiären Verfalls im Oeuvre des Portugiesen António Lobo Antunes.
Sie alle, wie ihr literarischer Urvater Faulkner, beschwören, im Kampf der Literatur gegen das Vergessen, die Kontinuität von fernster Vergangenheit und nächster Gegenwart, in der Gleich-Zeitigkeit eines episch ausufernden (wo nicht sogar uferlosen) Periodenbaus von ununterbrochen fließenden Sätzen, sowohl retro- als auch prospektiv – wie im Eingang der „Pythre“. Diese zur mythischen Seins-Setzung der literarischen Imagination tendierende sprachliche und grammatikalische Strategie sieht sich gezwungen, „magische“ Formen der Beschwörung, des Rituals, der Wiederholung und der Variation zu adaptieren. Die Rhetorik, als gebundene Rede und gliedernde Logistik epischer Vergegenwärtigung gehört zum primären Arsenal des „Magischen“ in der Literatur.
Seit sich der mitteleuropäische Roman als Prosa vom vormodernen poetischen Epos (Homer/ Amadis) getrennt hat, suchen moderne Epiker (von Dos Passos, Faulkner oder Broch bis García Márquez, von Proust, Döblin oder Grass bis Thomas Bernhard) nach Modi einer neuen Verschmelzung von Prosa & Poesie im Epischen. Und sie finden sie in der Adaption von Struktur-Prinzipien des musikalischen Ausdrucks , der sich in rhetorischen Erzählstrategien niederschlägt.
Das ist sowohl bei dem bekennenden Bach- & Beethoven-Liebhaber Lobo Antunes erkennbar wie bei Richard Millet, der sich einerseits den solitären epischen Versdichtungen Saint-Jean Perses nahesieht, andererseits den kolossalen symphonischen „Erzählungen“ Bruckners und Mahlers. Für Millet „ist die Musik die höchste Kunst. Ich bin besessen nicht von den Hübschheiten der Sprache, sondern eher von Rhythmus und Tonalitäten, von Höhen und Tiefen und vom Klang. Als ich die ›Pythre‹ schrieb, war ich gefangen vom 6/8 und 5/8 Rhythmus, die mich daran hinderten, etwas anderes zu lesen als Bossuet, den ich mir mit lauter Stimme vorlas“. Der Prinzenerzieher am Hofe Ludwig XV., von dem auch das Motto der ›Pythre‹ stammt ( „Kennen auch die Seelen der Unschuldigen Tränen und Bitternis der Buße?“), gilt als der größte französische Rhetoriker.
Richard Millet evoziert das Vergangene vor allem durch das Pathos eines unzeitgemäßen Französisch, das sich nicht nur an Bossuet, sondern auch an anderen Autoren des 17. und 18. Jahrhunderts (wie Scarron und Lesage) orientiert. Es sind Sprache und Grammatik, die seine Trilogie der Millevaches konstituieren, so daß seine überwältigende „Sprachmächtigkeit“ ebenso ins Auge sticht, wie auch die damit verbundenen Gefährdungen des Hohen Tons und des rhetorischen Leerlaufs, von denen seine düstere Prosa nicht immer ganz frei ist – wie auch nicht von Augenblicken der Monotonie, mit der die rollenden Wellen seiner Satzfluten periodisch die Erzählung anlanden lassen. Während „Le Monde“ bewundernd bemerkt: „um über die Armut zu sprechen, hat Millet die reichste Sprachen gewählt“, hat ihm ein deutscher Kritiker vorgeworfen, Millets kenne „für das Archaische und Elementare kein anderes Mittel als das fortissimo“ . Millet sei „ein in Cinemascope schreibender Autor“(Wolfgang Matz). Vielleicht ist damit aber auch das heute durchaus Verstörende eines „barocken“ Metaphern-Furors bezeichnet, der auf Bossuet zurückweist.
Das „Wir“, mit dem „Der Stolz der Familie Pythre“ erzählerisch eher bezweifelt als begründet wird, umgürtet Aufsteig und Fall der Familie wie der Chor in der antiken Tragödie. Manchmal scheint das „Wir“ mit der Scheelheit der Dorfgemeinschaft identisch, in sich die Pythres nie eingefügt haben; öfter aber ist es – z.B. wie in García Márquez‘ „Herbst des Patriarchen“ – das imaginäre Kollektiv des Erzählens selbst, hinter dem sich der Autor mit seinem auktorialen Wissen verbirgt, um einen anderen Zug des bäuerlich-provinziellen Lebenszusammenhangs – nämlich Gerücht, Mutmaßung, Neid und Üble Nachrede, also die Paranoia der Enge – zu repräsentieren.
Weil Richard Millets Imagination ländlicher Existenz am Ende ihrer archaischen Geschichte sich primär über die Evokationskraft sprachlicher, rhetorischer Strategien stützt, behandelt er das, was im realistischen Erzählen als „Griff ins pralle Menschenleben“ hoch im Kurs steht – also Personen, Konstellationen, Plots – eher nachlässig, fast könnte man sagen: schematisch und stereotypisch. Personen nähern sich symbolischen Ausprägungen von „Charakteren“ (La Bruyère), um die sich sprachlich der Stoff ungemein reich und subtil kristallisiert. In „L´amour des trois soeurs Piale“ ist Lucie („die mit den schönsten Brüsten“) schwachsinnig, Yvonne zwar nicht häßlich, aber doch die, die sich mit ungeheurer Energie als Lehrerin aus den Beschränkungen ihrer Herkunft emanzipiert und Amélie die Verbindung von Schönheit, Wildheit und Eigensinn.
Mag sein, daß sich Millet bei den drei Schwestern – ihr Bruder geht schnell zugrunde – am biographischen Topos der Brontee-Schwestern in den Yorkshire-Mooren orientiert hat, wie ein Kritiker mutmaßte. Millet hat sich jedoch mit diesen drei „repräsentativen“ weiblichen Temperamenten in provinzieller Enge, Armut und Kälte einen größere Perspektiv-Reichtum geschaffen und das Schicksal der Frauen ins Zentrum gerückt, nachdem in den ›Pythres‹ die Männer dominierten.
Einen Herbst und Winter lang läßt sich der junge Versicherungsvertreter Claude, ein ferner Verwandter der drei Schwestern Piale, jeweils montagmorgens von der pensionierten Lehrerin Yvonne, bei der ihre debile Schwester Lucie kichernd lebt, die unterschiedlichen Biographien der drei Frauen erzählen.Das wöchentliche Ritual eines erzählerischen Abstiegs in die Vergangenheit in Begleitung der „Herrin der Wörter“ wird konterkariert von Claudes älterer Geliebter Sylvie, einer verheirateten Frau in den Vierzigern, mit der er, jeweils nach den morgendlichen Erinnerungsexerzitien der strengen Lehrerin, in wechselnden Hotels tafelt und danach in immer anderen Zimmern die beiden sich erotisch aneinander sättigen. Wenn ihre Körper befriedigt sind und Claude von seinen jüngsten Kenntnissen berichtet, die ihm aus dem Munde Yvonnes zufielen, während morgends „die Zeit zerkaut wurde“, setzt die manchmal eifersüchtige, manchmal auch gehässige Sylvie ihr on-dit-Wissen von den verschwiegenen oder bloß gemutmaßten Geheimnissen der drei Schwestern dagegen.
So entsteht ein multiperspektivischer Erzählraum, den Millet aber nicht in Monologen darbietet, sondern in einer durchinstrumentierten erzählerischen Prosa, die bei allen rhetorischen Finessen und metaphorischen Schürzungen durch das rhythmisch wiederkehrende Füllsel des „n´est-pas?“ („nicht wahr?“) einen Kolloquialstil imitiert, in dem sich Millet sogar selbstreflexive Ironien des Erzählvorgangs erlaubt.
In der dominanten Yvonne beschreibt Millet aber auch die Tragik einer Emanzipation durch Sprache und Kultur. Als Lehrerin entwächst sie dem Milieu und dem „Patois“ der Kleinbauern, indem sie sich voll und ganz dem Französischen, als Sprache der Republik, der Vernunft, des Fortschritts „verschreibt“. Als strenge Schulmeisterin, die „zugleich Furcht und Liebe einflößte, falls das nicht dasselbe ist, mußte sie …von den Lippen der kleinen Bengel mit den rötlichen Vollmondgesichtern, den prahlerischen oder verschlagenen Augen und den Händen, die mit der Heugabel, Sense, Hacke geschickter umgingen als mit der Schreibfeder, .. die Dialektwörter absägen oder abschaben“. Dabei „hätte sie ihnen oft selbst gerne mit Dialektwörtern geantwortet, deren Gebrauch die Schulbehörde in Limoges aber unerbittlich verbot“. Selbst wenn die Kinder zuhause „die Sprache des Waldes gegen die der Republik ausspielten, … ahnten sie jedoch nicht, daß das Spiel schon verloren war, ja daß sie im Begriff waren, in die Nacht des Vergessens hinabzusteigen, mit ihren Tieren, Erinnerungen, Bräuchen und Legenden, mit dem armseligen Glanz der schriftlosen Sprache, die die Jüngeren schon nicht mehr sprachen und von der nichts übrigbleiben würde, weder Gesicht noch Körper oder Gesten, nicht einmal die Erinnerung daran“.
Amélie aber, „die Schönheit gewordene Zeit“, „diese sieghafte, gefallene, unzugängliche und stolze Frau“, die nur „an die Geister des Waldes und der toten Gewässer hätte glauben können“, hat sich ihr ganzes Leben lang geweigert, den reichen Schloßbesitzer Barbatte zu heiraten, der sich schon als junger Mann in sie verliebt hatte. Auch als sie, nach einem Unfall im Wald, wo sich die Tiere um sie scharten wie um die Göttin Diana, an den Rollstuhl gefesselt war, wies sie das Heiratsbegehren des nun auf ewig verschmähten unglücklichen Liebhabers zurück – und um ihn zusätzlich zu demütigen, heiratete die Verkrüppelte einen ehemaligen Fremdenlegionär, Faulpelz und Nichtsnutz, auf dessen Rücken Amélie eine zeitlang „auf Amazonenart“ bald auf allen Straßen des Landkreises ritt: „ein Zentaur mit Frauengesicht“. Nachdem er sie mit einer andere Frau verlassen hatte, war Amélie in ihrem Rollstuhl bei einem Sturm von einer Balustrade in eine Schlucht gestürzt, und man hatte sie gefunden: „mit gebrochenem Genick, aufgerissenen Augen, schweigendem Mund, und endlich glücklich, ja glücklich wie nie zuvor, als hätte sie auf diesen Augenblick warten müssen, um zu erfahren, was Freude ist“.
Das Porträt Amélies allein, das Richard Millet zuletzt (etwas zu forciert) ins Mythische einer aus der Zeit gefallenen archaischen Gottheit steigert, bleibt jedoch, dank einer detail-reichen, sinnlich präsenten Ausmalung von Amélies Launen, Eigenheiten & Befremdlichkeiten, ebenso unvergeßlich wie ihr schwesterliches Gegenbild Yvonne. Obwohl als Typus der asketischen Aufsteigerin gezeichnet – der jedoch auch die Liebe zu Männern nicht fremd bleibt -, sind alle drei Schwestern Piale, auch die stumme Lucie, „unfruchtbar“ geblieben. Derzeit würde man im Jargon der Autobranche, von „Auslaufmodellen“ sprechen. Geliebt haben sie, gegen die provinzielle Welt, nur sich – sich einander.
Und Millets erzählerischer „Pilotfisch“, der Erinnerungs-Rechercheur Claude? Nachdem er, im Laufe seiner montäglichen Wort- & Körpererfahrungen mit Yvonne & Sylvie, die verborgene Geschichte von der Liebe der drei Schwestern Piale ans Licht gebracht hat, ist auch seine sexuelle Liaison mit der älteren Geliebten aufgebraucht – wie die Zahl der von den Beiden durchprobierten Zimmer in dem Provinzhotel von Sion.
Endspiele also auf der ganzen Linie. Das ist im tragischen Weltbild Richard Millets, der erzählerisch und sprachlich das Requiem auf eine nicht nur untergegangene, sondern auch verschwundene Welt als epische Form des Eingedenkens favorisiert, von schlüssiger Konsequenz. Richard Millet aber hat, in seinen beiden großen Familienromanen und Vergangenheits-Rückrufen aus dem innersten Herz Frankreichs, seinen Lesern noch einmal das Imperfekt beschworen: in eine Folge von momenthaft fixierten großformatigen Lebens-Bildern, die er immer aufs Neue in seinen metapherndichten, rhythmisch gegliederten Prosa-Pereioden exegetisch auseinanderfaltet: dunkel leuchtend, sinnlich durchglüht. Es sind Satzsymphonien von der „anderen Seite der Zeit“. Es war einmal ….
Titelangaben
Richard Millet: Die drei Schwestern Piale
Aus dem Französischen von Christiane Seiler
Berlin: Alexander Fest Verlag 1998
278 Seiten, 19,90 Euro
Richard Millet: Der Stolz der Familie Pythre
>Berlin: Alexander Fest Verlag 2001
363 Seiten, 22,90 Euro
Richard Millet: Die drei Schwestern Piale
Frankfurt/M.: Fischer-TB.-Vlg 2002
286 Seiten