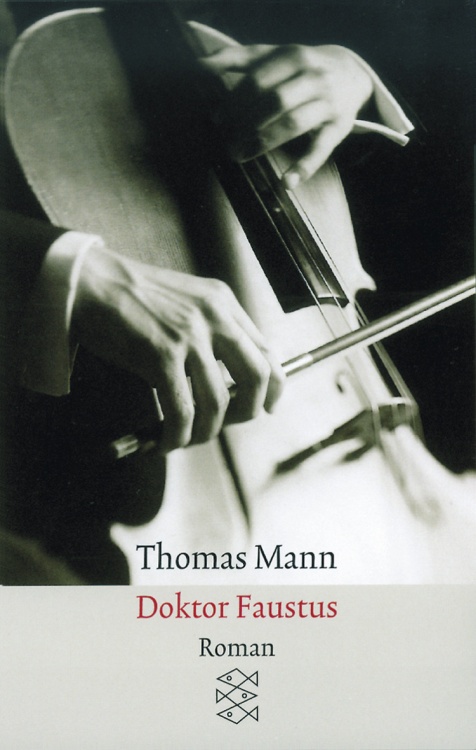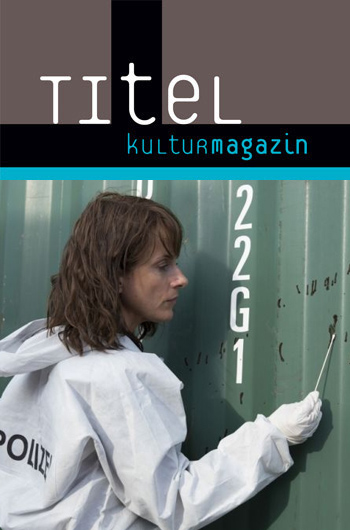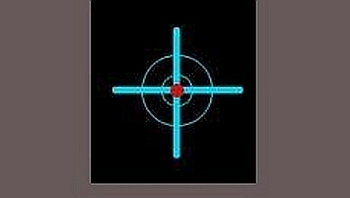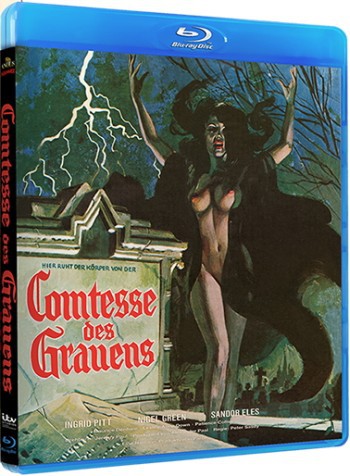Der englische Titel, unter dem Jia Zhang-Kes semidokumentarischer Spielfilm den Goldenen Löwen auf der venezianischen Mostra del Cinema 2006 gewonnen hat und unter dem er bei uns läuft, enthält die widersprüchliche Doppeldeutigkeit des Films in nuce. ›Still Life‹ ist zum einen die wörtliche Übersetzung des kunstwissenschaftlichen Fachbegriffs für »Stilleben«; zum anderen annonciert der Titel, dass es immer noch Leben gibt, wo alles nicht bloß »den Bach hinunter«, sondern von dem größten Staudammprojekt der Welt, dem umstrittenen »Drei- Schluchten-Damm des Yangtze«, verschlungen, nämlich überflutet wird – z.B. die 2000 Jahre alte Altstadt Fengjis. Von WOLFRAM SCHÜTTE
 Sie ist eine von 500 Städten, Dörfern und Siedlungen, die in dem 185 Meter hohen und 2,3 Kilometer langen Staudamm untergehen werden. An die 2 Millionen Menschen müssen umgesiedelt werden für ein Projekt, dessen Gigantomanie an die Chinesische Mauer erinnert, mit der die Angriffe der Mongolen abwehrt werden, wie durch den Drei-Schluchten-Staudamm die seit dem 2. Jahrhundert dokumentierten verheerenden Überschwemmungen des Yangtze verhindert werden sollen. Die damit einhergehenden Umweltschäden sind gar nicht abzuschätzen; auch weisen Kritiker darauf hin, dass die Überflutungskontrolle und die jetzt angepeilte Stromerzeugungskapazität, die 15 derzeitigen Kernkraftwerken entspräche, sich durch mehrere, preiswertere, weniger für Natur & Menschen folgenreichere Staudämme hätte erzielen lassen – ohne die unabsehbare Gefahr eines möglichen Superdammbruchs, durch den die Abermillionen Kubikmeter Wasser, das bis auf eine Höhe von 175 Metern gestaut werden soll, sich dann zu einer gewaltigen Tsunami-Lawine auftürmen würden.
Sie ist eine von 500 Städten, Dörfern und Siedlungen, die in dem 185 Meter hohen und 2,3 Kilometer langen Staudamm untergehen werden. An die 2 Millionen Menschen müssen umgesiedelt werden für ein Projekt, dessen Gigantomanie an die Chinesische Mauer erinnert, mit der die Angriffe der Mongolen abwehrt werden, wie durch den Drei-Schluchten-Staudamm die seit dem 2. Jahrhundert dokumentierten verheerenden Überschwemmungen des Yangtze verhindert werden sollen. Die damit einhergehenden Umweltschäden sind gar nicht abzuschätzen; auch weisen Kritiker darauf hin, dass die Überflutungskontrolle und die jetzt angepeilte Stromerzeugungskapazität, die 15 derzeitigen Kernkraftwerken entspräche, sich durch mehrere, preiswertere, weniger für Natur & Menschen folgenreichere Staudämme hätte erzielen lassen – ohne die unabsehbare Gefahr eines möglichen Superdammbruchs, durch den die Abermillionen Kubikmeter Wasser, das bis auf eine Höhe von 175 Metern gestaut werden soll, sich dann zu einer gewaltigen Tsunami-Lawine auftürmen würden.
›Still Life‹ ist zuförderst ein unschätzbares Dokument der historischen Zeugenschaft für einen irreparablen, apokalyptisch anmutenden Eingriff in eine bizarre, einst weltbekannte Fluss-Landschaft und eine Lebensregion, die – wo sie nicht schon in den Fluten des künstlichen Sees bereits versunken ist – sich als ein unabsehbares Ruinenfeld verlassener Wohn-, Geschäfts- und Industriebauten darbietet, die dem täglich näherkommenden Untergang geweiht sind.
Auf diesem Ruinenfeld harren letzte Reste der ehemaligen Bewohner aus im erfolg- & hilflosen Protest gegen korrupte Provinzkader der KP, die Hilfsgelder für Umsiedler veruntreuen, eine überfordert-unfähige Verwaltung, ausbeuterische Manager und Unternehmer, die Abrisskolonnen zu Hungerlöhnen die Gebäude demolieren lassen, während ein kriminelles Bandenmilieu mit Erpressung, Gewalt und Prostitution sich im Chaos des Verfalls breitgemacht hat. Alles in allem entwirft Jia Zhang-Ke und sein aus Hongkong stammender Kameramann Lik-Wai Yo ein Panorama-Porträt von einer Detailfülle und Stichhaltigkeit, die einem als Zuschauer den Atem stocken lassen: ferner von den kommunistischen Zielen oder auch nur den Imperativen der Französischen Revolution könnte diese chinesische Hölle ohne »Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit« nicht sein, als ›Still Life‹ es in Bild & Ton festhält und bewahrt. China von heute.
Es ist der Stil einer Meditation, mit der Zhang-Ke die tiefe Melancholie des historischen Augenblicks, in dem Zerstörung, Vertreibung und Untergang vorherrschen, öffnet für den empathetischen Blick auf die »Guten Menschen von den drei Schluchten«, wie der chinesische Originaltitel lautet. Mit deren konfliktreichem Überlebenskampf unter- & miteinander findet der Regisseur zu einer Balance, die erst das dokumentarische Stillleben der kleinen & großen Dinge erzählbar, ja für die Zuschauer begeh- & erfahrbar macht.
Wie in den großen neorealistischen Filmen der Italiener, wie in dem von verwandter Ästhetik und Ethik des minimalistischen Details bestimmten Film »Das Leben geht weiter« von Abbas Kiarostami (Vater & Sohn auf der Suche nach einem Menschen im verwüsteten Erdbebengebiet) schickt der chinesische Regisseur erst einen Vater auf die Suche nach seiner Frau & Tochter, dann zeitgleich eine Krankenschwester auf die Suche nach ihrem Ehemann, einem Ingenieur, der sich seit zwei Jahren nicht mehr bei ihr gemeldet hatte und von dem sie sich, als sie ihn getroffen hat, trennen wird. So wird »Still Life« zur poetischen Metapher für eine Gesellschaft im Umbruch aller Lebensverhältnisse.
Beide Fremde am »Drei-Schluchten-Stausee« sind für uns Scouts, mit denen wir sowohl auf der unteren sozialen wie auf der oberen Stufenleiter der im Ab- & Umbruchgelände Lebenden und Arbeitenden in diesen chaotischen Zustand eindringen. Zweifellos werden wir mit dem schweigsamen Bergmann, der einst hier seine Frau noch gekauft und mit sich fortgenommen hatte, die ihn aber vor 16 Jahren mit der gerade geborenen Tochter verlassen und hierher, in ihre Heimat zurückgekehrt war, fündiger bei der Erkundung des sozialen Geländes. Denn er bleibt am Ort, sucht Kontakt mit entfremdeten Verwandten, schließt sich den Abbrucharbeitern an – bis er am Ende seine weggelaufene Frau wiedertrifft und sie, als Dienerin eines Alten, erneut freikaufen muss.
Von Beginn an – einer langen Kamerafahrt durch die Menge ärmlicher Passagiere auf einem überfüllten Schiff – schließen uns die Bewegungen und Begegnungen des stoischen Bergmanns in kleinsten Gesten und Handlungen die soziale Welt der Ausgepowerten auf, offenbaren sie gegenseitige Konflikte und Verwahrlosung, aber auch Solidarität und Mitmenschlichkeit.
Die »Diskretion«, mit der Zhang-Ke das »soziale Feld« (Bourdieu) beschreibt und transparent macht, ist Folge der politischen Zensur, die seinen Stil ebenso »verfeinert« hat, wie er von den Zuschauern eine erhöhte seismographische Aufmerksamkeit und Phantasie verlangt, damit ihnen in der Beiläufigkeit dieser kinematografischen Phänomenologie nichts entgeht und sie sich mit Phantasie ihren eigenen Reim auf das bloß Angedeutete oder kurz Aufblitzende machen können, z.B. wenn dem Bergmann von einer Wirtin Frauen angeboten werden oder er seinen Abrisskumpeln Zigaretten anbietet und ihnen von der Lebensgefährlichkeit seines Berufes erzählt, für den sie sich als Wanderarbeiter interessierten; oder wenn die Krankenschwester bei einem gastfreundlichen Armee-Kameraden ihres Mannes übernachtet, der (absurderweise) archäologische Ausgrabungen in der bald überfluteten Stadt leitet oder das zuletzt für einen Moment vereinte Ehepaar einen hoffnungslosen Tanz im Angesicht der Staumauer versucht, aber sich nichts mehr zu sagen hat und sich trennen wird. Da scheinen wir plötzlich in einem Antonioni-Film zu sein.
Nur zweimal durchbricht Jia Zhang-Ke den cordon sanitaire seines dokumentaristischen Realismus; denn er arbeitet auch in den Hauptrollen mit Schauspielerlaien, einem Grubenarbeiter und einer Tänzerin. Ausgehend von einer Leiste von Porträts Marx´, Lenins, Stalins und Maos in einer abrissbereiten Fabrik, schneidet er kurz Dokumentaraufnahmen von Deng Xiao Ping ein, der das Staudamm-Projekt 1992 durchsetzte. Irritierender aber ist der phantastische Moment, in dem das auffällig-bizarre Skelett eines entkernten Hochhauses, das immer mal wieder in den Fokus der Kamera kam, plötzlich fauchend in den Himmel verschwindet: ein magischer Moment innerhalb eines erodierenden Stilllebens, in dem alles sonst zu Boden geht und im steigenden Wasser versinkt.
Die bewegende Schönheit von Jia Zhang-Kes »Still Life«, der sein High Definition Video auf 35mm aufgeblasen hat und damit eine ebenso authentische wie phantastische Ästhetik erreicht, die dem Bericht eines Außerirdischen von der menschlichen Welt gleicht, kulminiert in zwei grandiosen Sequenzen: Als sich die seit 16 Jahren getrennten Eheleute auf dem Dach eines weitgehend zerstörten Gebäudes zum erstenmal wieder gegenüberstehen, wird in der Ferne ein Gebäude gesprengt – und das Geräusch des zusammenfallenden Gebäudes treibt die einst geflohene Frau in die schützenden Arme ihres seit Langem verlassenen Mannes. Und als der Bergmann sich auf den Rückweg macht, um das Geld im lebensgefährlichen Bergbau zu verdienen, mit dem er seine glücklich wiedergefunden Frau auszulösen wird, sieht er (& wir mit ihm) als letztes von der maroden, untergehenden Stadt einen Hochseilartisten, der hoch oben und ohne Netz auf einem Drahtseil zwischen zwei Ruinen entlang wandert. Was für ein vieldeutiges Symbol für den Augenblick, den Ort, das Land und seine Menschen!
Es ist seine erstaunliche poetische Fähigkeit zur unaufgesetzten, beiläufigen Verdichtung des Realismus zum Metaphorischen und Sinnbildlichen, die uns den chinesischen Regisseur bewundern lässt. Er befindet sich augenblicklich an der Spitze einer epischen Kinematographie der humanen Anteilnahme und kritischen Zeugenschaft – und ganz unverkennbar in der künstlerischen Tradition eines Luchino Viscontis, Theo Angelopoulos´ und Abbas Kiarostamis.
Titelangaben
Still Life: Sanxia Haoren
Verleih: Delphi Filmverleih
China / Hongkong 2006
Regie: Jia Zhang-Ke
Mit San-ming Han, Tao Zhao, Hong-wei Wang,
Zhu-bin Li, Hai-yu Xiang
108 Min.
tartdatum: 04.10.2007