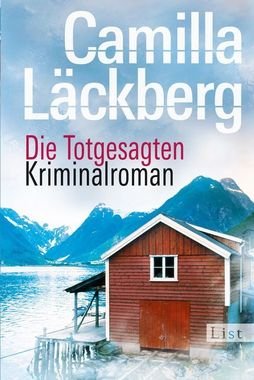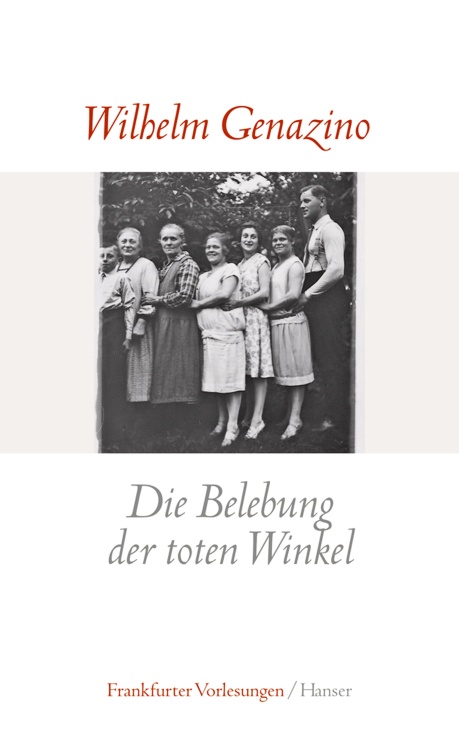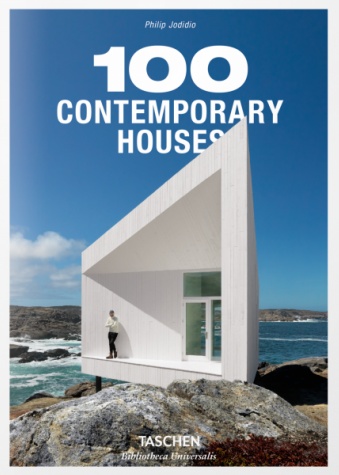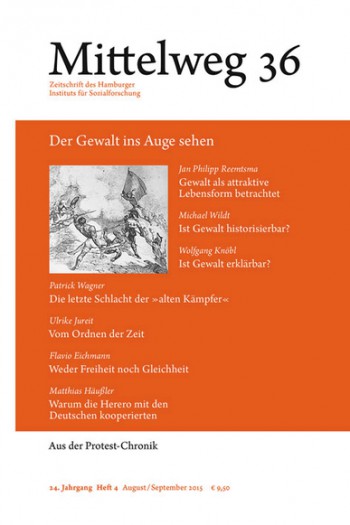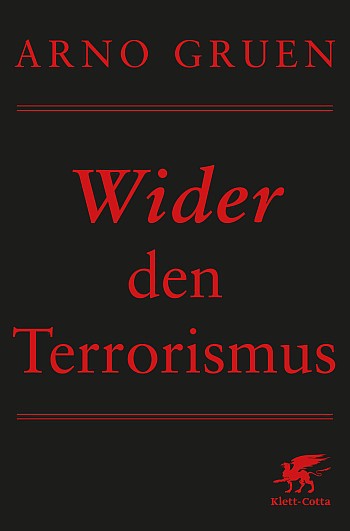Kunstgeschichte als Institutionengeschichte. Heidenreichs populäre Diskursanalyse des Kunstsystems führt Künstler in das System ein, das sie erwartet und zeigt, wie es wurde, was es ist. Von BJÖRN VEDDER
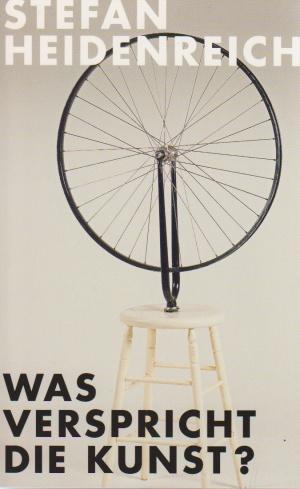 Die neuere Kunstgeschichte, d. h. hier seit der Renaissance, als längst fällige Institutionsgesichte geschrieben zu haben, ist Stefan Heidenreich schon bei Erscheinen der Hardcoverausgabe 1998 hoch angerechnet worden. Die nun vorliegende, leicht überarbeitete Taschenbuchausgabe macht die Untersuchung auch einem breiteren Leserkreis zugänglich.
Die neuere Kunstgeschichte, d. h. hier seit der Renaissance, als längst fällige Institutionsgesichte geschrieben zu haben, ist Stefan Heidenreich schon bei Erscheinen der Hardcoverausgabe 1998 hoch angerechnet worden. Die nun vorliegende, leicht überarbeitete Taschenbuchausgabe macht die Untersuchung auch einem breiteren Leserkreis zugänglich.
Diesem ermöglicht der Autor, der in den Neunzigern selbst als Künstler tätig war, einen sehr informativen und anregenden Blick auf die Kunstgeschichte, der ganz anders ist die bekannten Versuche, etwa der Stilgeschichte.
Die Entwicklung der europäischen Kunst ist für Heidenreich eine Emanzipationsbewegung. Zunächst emanzipiert sich die Kunst, und zwar insbesondere die Malerei, auf die der Autor überhaupt seinen Schwerpunkt legt, vom Handwerk, als welches sie bis in Renaissance gegolten hat, zur Wissenschaft, indem sie eigene Entdeckungen macht und Gesetze aufstellt – z. B. in der Perspektive. Der Maler wird vom gehobenen Domestiken zum Künstler, d. h. zum wissenschaftlich anerkannten Hersteller von Kunstwerken. Seine Ausbildung erfolgt in Akademien und was ein Kunstwerk ist, legen eben diese Akademien in ihren Ästhetiken fest. Sie bestimmen die klassischen Regeln der Kunst, d. h. Perfektion von Proportion und Perspektive, schreibt Heidenreich mit Blick auf das 16. Jahrhundert, in dem er die Malerei schon technisch so gut wie vollendet sieht.
Aus dem Korsett
Techniken und Medien sind Heidenreich besonders wichtig – angefangen bei den Stichen im 16. Jahrhundert, über die Erfindung der Fotografie im 19. Jahrhundert bis zu den virtuellen Welten des 21. Jahrhunderts. Erst durch die schnelle und weite Verbreitung der Stiche konnte sich auch der Stil des reproduzierten Kunstwerks rasch verbreiten. Die Verbreitung eines dann klassisch zu nennenden Stils wurde damit erst möglich, so Heidenreich. Im 19. Jahrhundert löst die Fotografie, die die Herrschaft der Malerei über die künstlerische Abbildung von Wirklichkeit ab und befreit so den Künstler aus dem Korsett der akademischen Kunstlehre, die die Regeln der Abbildung zuvor festgelegt hatte. Erst durch diese Befreiung wird moderne Kunst möglich. Sie begibt sich jedoch in eine neue Abhängigkeit, nämlich in die vom Markt.
Wer die Geschichte in so großen Zügen umreißt wie Heidenreich, muss viele Details beiseitelassen. Zuweilen trifft Heidenreich dabei sehr großzügige Aussagen, die den stilgeschichtlich nicht informierten Leser in die Irre führen können. Einen Vorwurf muss ihm daraus nicht erwachsen. Traditionelle kunstgeschichtliche Informationen finden sich andernorts – in jeder gewünschten Genauigkeit.
Popularisierte Diskursanalyse?
Heidenreichs Kunstgeschichte stellt aber z. B. nicht nur eine sensualistische, in seiner Zeit antiakademische Kunstlehre wie die Roger de Piles als frühen Höhepunkt rationalistischer, akademischer »Versuche der Normierung« vor – das ist dem einen Leisten geschuldet, über den sie 300 Jahre Stilgeschichte schlägt – sie zeichnet sich auch durch den Versuch der Diskreditierung ästhetischer Kategorien aus und das ist unverständlich.
Heidenreich schreibt im Nachwort zur Taschenbuchausgabe, dass er eine »popularisierte Diskursanalyse der Kunst« formulieren wollte, bei der es »nicht um die Frage ging, was uns ein Kunstwerk sagen will, als vielmehr darum zu klären, warum es in einem bestimmten Moment auftauchen kann«. Ein solcher, an Foucault geschulter Zugriff, zeigt das »Kunstsystem, in dem er darlegt, welche Institutionen und Figuren in dem Feld handeln, wie sie sich formiert haben und welche Regeln […] sie setzen«. Ästhetische Diskussionen haben hier keinen Platz. Heidenreichs Kunstgeschichte erweckt aber den Eindruck, als ob alle möglichen Inhalte einer solchen Diskussion keinen Einfluss auf die Geschichte der europäischen Kunst haben konnten, sondern nur die von ihm dargestellten Institutionen und ihre Regeln. Das ist nicht überzeugend.
Die Darstellung dieser Institutionen und Regeln aber – z. B. wie Museen Kunstgeschichte schreiben, der Kunstmarkt die Macht der Akademien brach – ist nicht nur informativ und angenehm geschrieben, sie beleuchtet auch, warum das Kunstsystem heute so ist, wie es ist. Zuletzt wäre zu vermuten – und das schränkte die geäußerte Kritik ein – Heidenreich habe dieses Buch für Künstler geschrieben, als eine Einführung in das System, in das sie sich begeben. Jedenfalls scheint sich die Antwort auf die Titelfrage an sie zu richten. Was verspricht die Kunst dem Künstler? Eine, trotz der weitreichenden Befreiung, die ihm die neuen und veränderten Institutionen bescherten, immer prekäre Situation, in der er Werke schaffen muss, die die »Anforderungen des Betriebes erfüllen, ohne sich ihm zu überlassen«. Eine Zwickmühle, das verspricht die Kunst.
| BJÖRN VEDDER
Titelangaben
Stefan Heidenreich: Was verspricht die Kunst
Berlin Verlag 2009
220 Seiten, 10,90 Euro
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander