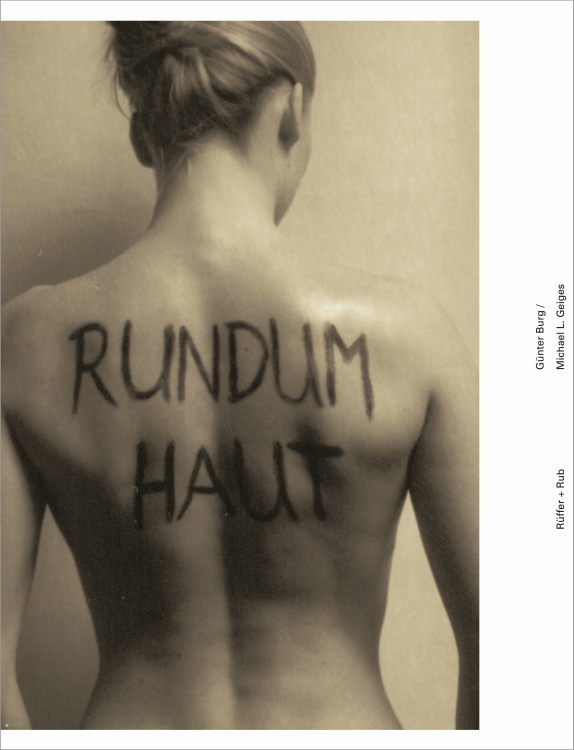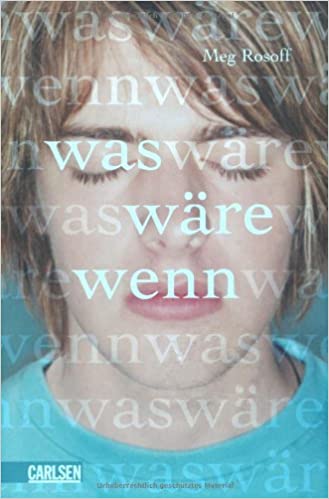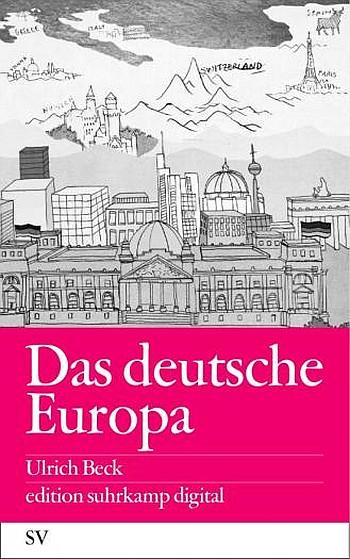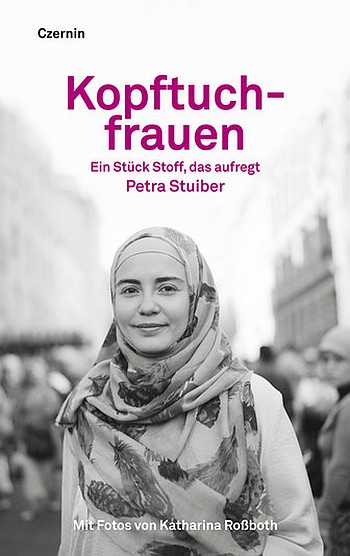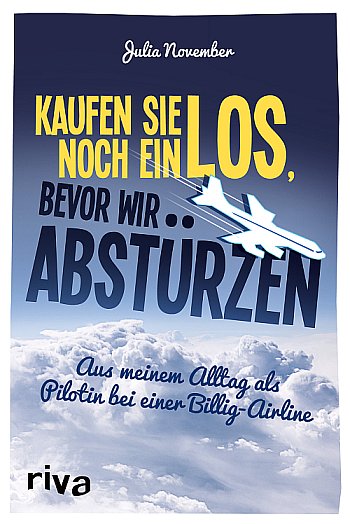Nachdem er vor zwei Jahren den Büchner-Preis erhielt, zählt der Schriftsteller Wilhelm Genazino zu den bekanntesten deutschen Autoren. Mit seinen nun publizierten Frankfurter Poetikvorlesungen gibt er tief reichende Einblicke in sein Schaffen und dessen geistige Hintergründe. Von WOLFRAM SCHÜTTE
 Bevor er vom ›Literarischen Quartett‹ 2001 verspätet »entdeckt« und dann 2004 von der Jury der Darmstädter Akademie den Büchner-Preis zugesprochen bekam, war der 1943 in Mannheim geborene, aber in Frankfurt a. M. lebende Wilhelm Genazino jenen deutschen Lesern bekannt & vertraut, die das eigentümlich Schwebende seiner erzählerischen Prosa schon immer zu schätzen wussten. Der »Gedehnten Blick«, den er auf das Verborgene im städtischen Alltagsleben richtet, war etwas ebenso Eigenwilliges wie Ausgefallenes in der deutschen Gegenwartsliteratur.
Bevor er vom ›Literarischen Quartett‹ 2001 verspätet »entdeckt« und dann 2004 von der Jury der Darmstädter Akademie den Büchner-Preis zugesprochen bekam, war der 1943 in Mannheim geborene, aber in Frankfurt a. M. lebende Wilhelm Genazino jenen deutschen Lesern bekannt & vertraut, die das eigentümlich Schwebende seiner erzählerischen Prosa schon immer zu schätzen wussten. Der »Gedehnten Blick«, den er auf das Verborgene im städtischen Alltagsleben richtet, war etwas ebenso Eigenwilliges wie Ausgefallenes in der deutschen Gegenwartsliteratur.
Jahrelang waren seine Bücher bei Rowohlt erschienen, von der Kritik durchweg hoch gelobt – aber ein größeres Publikum nahm nicht Anteil an seinem seit 1977 schon beträchtlich gewachsenen Oeuvre und fand kein Vergnügen an ihm. Erst im neuen Jahrtausend wurde er durch die erwähnten öffentlichen Hinweise und den Verlagswechsel zu Hanser, über seine treuen Kenner & Liebhaber hinaus, wirklich »bekannt«, womöglich sogar beliebt.
Genazinos Romane, schlank & schmal (im Gegensatz zu ihrem unübersehbar massigen Autor, der mit dieser physischen Präsenz ein österreichisches Pendant in dem Essayisten Franz Schuh hat), glänzen triumphal durch die Abwesenheit von Plots, Spannung & Action; und sie nehmen für sich und die subtile Fähigkeit ihres Autors ein, uns phänomenologische Expeditionsberichte von den Rand- & Unterschichtbezirken unserer urbanen Lebenswelten zu vermitteln, wie sie uns weder die Literatur oder der Journalismus, noch die Alltags-Soziologie liefern. Der Mannheimer in Frankfurt am Main ist nämlich so etwas wie »Der Gott der kleinen Dinge«, um einen Romantitel der indischen Schriftstellerin Arundhati Roy für ihn zu gebrauchen.
Genazino, der besonders fürs Übersehene einen zärtlichen Blick und für das Überhörte ein aufmerksames Ohr hat, und der mit diesen zwei geschärften sinnlichen Organen den städtischen Öffentlichkeiten wie ein sanftmütiger Kriminalist, der Indizien für einen möglichen Prozess gegen unsere Lebensweisen & -verhältnisse sammelt, mäandrierend & reflektierend durchstreift und der seine Fundstücke und sein Spurenlesen in einer lichten, empathetischen Prosa suggestiv zum Leuchten bringt (übrigens: nicht ohne Humor), hat anfangs 2006 an der Frankfurter Universität fünf Poetik-Vorlesungen gehalten – und der studentische Zulauf war groß.
Sich selber auf die freudianische Couch gelegt
Ebenso die Begeisterung seiner Zuhörer, denen er im Verlauf der Vorlesungen intime Einblicke in die eigene poetischen Produktionsweise gestattete – als habe der von ihm öfters zitierte Sigmund Freud sich selbst auf die Couch gelegt. Nun sind diese theoretischen Texte, die sich als Interlinearversionen seiner literarischen zu erkennen geben – kenntnisreicher, intensiver und überraschender als alle sympathetischen Äußerungen der ihm gewogenen Kritik -, in seinem Verlag unter dem Titel »Die Belebung der toten Winkel« erschienen
Es ist ganz erstaunlich, wie stark Genazinos Wahrnehmung, Phantasie und Poetik des gegenwärtigen urbanen Alltags von philosophischen, psychoanalytischen und literarischen Überlegungen grundiert sind – ohne dass er doch derlei abstrahierendes Gründeln in seiner erzählenden Prosa, in der fast immer prekär lebende Einzelgänger im Zentrum stehen und als reflektierende Ich-Erzähler den Ton angeben, auch nur einmal hervortreten ließe.
Die Vorlesungen offenbaren nun, dass der scheinbar schwerelose Beobachter nicht zufällig über »nichtswürdige Kleinteile« wie alte Fotos, Koffer, Dosen, Etuis, Brotkrümel, Schubladeninhalte, Kleidungsstücke, Brillen, Knöpfe, Scheren – also über nutzlos gewordene, »abgelebte« & verschwindende Gebrauchsgegenstände – ins Sinnieren, Grübeln und Spekulieren kommt, sondern dass er gerade, in dem er sie »aufhebt« (Ernst Bloch würde sagen: »bedenkt«), ihnen seine »poetischen Epiphanien« entlockt.
Was eine Taschenlampe alles erzählen kann
Nicht in der Taschenlampe, die dem Kind geschenkt wurde und mit dem es im Dunkel die Zimmerecken an- & ausleuchtete, erkennt Genazino seine Eigenart des Poetischen, sondern erst im Erlöschen des Lichts der Batterie beginnt seine Reise zu den Quellen der anderen Wahrnehmung fündig zu werden. Mehr noch: als er die erloschene Taschenlampe nach einiger Zeit wieder anmacht, hat sich die Batterie ein wenig reaktiviert. Er wiederholt das Phänomen: »Immer wieder glomm ein Lichtrest auf und erinnerte an sein eigenes früheres Strahlen«
Er bemerkte dabei gar nicht, dass durch diese Wiederholungen seine eigene Aufmerksamkeit »batteriemäßig« wurde. »Unser endloses Betrachten verwandelt uns selbst in einen Energieträger, der mit der Zeit ein wenig mysteriös und diffus wird, weil seine Batterie nicht oder sehr spät preisgibt, wofür wir seine Speicherungen brauchen« – was auf jene autobiografischen Ablagerungen vorausweist, die (wie Genazino an mehreren Beispielen aus seinen Büchern erläutert) ihn zu Wahrnehmungen und Phantasien anregte, von denen ihm erst nachträglich bewusst geworden ist, was sie insgeheim konstituierte.
Dieser verschwiegene Grenzverkehr von Überlagerungen, Übertragungen & Überschreibungen kann, wie er am Beispiel von väterlichen Hemden und seinem Sakko beschreibt, im literarischen Verschmelzungsprozess von einer subtilen Bedrohung und Angst zu einem existenziellen Befreiungsakt überwechseln: Rettung durch Poesie
Aber das immer schwächer werdende Licht der Taschenlampe »spielte vor meinen Augen mit seinem eigenen und (irgendwann) endgültigen Verschwinden«. Damit ist ein durchgängiges Motiv der Poetik Genazinos angesprochen: Momentane, vorübergehende »Rettung« des schon im Verschwinden Befindlichen als poetische Erleuchtung & Erinnerung, die damit aber zugleich symbolisch die Ahnung der Gewissheit des eigenen Todes (des Betrachters) besänftigend in ein Bild übersetzt und ableitet, um nicht zu sagen: abwehrt.
Genazinos Protagonisten sind »unterwegs auf der Suche nach solchen leistungsstarken Symbolen, in die sie ihr wackeliges Innenleben einklinken und dann gestärkt von dannen ziehen können«. Die Gegenstände und Dinge sind Stellvertreter der Innenwelt seiner lädierten Helden und ihrer »heiklen Befindlichkeit« der Scham, des Ich-Verlusts, der Lebensangst, der sich seine (zuletzt) »Schuhtester« oder der die Flucht nach vorne angetreten habende »Panik-Berater« ausgesetzt sehen.
Die verlorene Unschuld des abgestellten Koffers
Einen der bei Genazino vielfach wiederkehrenden »Gefühlsbegleiter«, mit denen seine Ich-Erzähler sich in die »Sterblichkeit einüben«, ist der Koffer, dessen Symbolträchtigkeit dem Autor »potentiell unerschöpflich« scheint. Die eindrucksvolle und vieldeutige Szene, in welcher der Erzähler in Genazinos jüngstem Roman »Die Liebesblödigkeit« dabei zuschaut, wie der von ihm mit abgelegten Kleidungsstücken vollgestopfte alte Koffer, den er an »einer belebten Stelle der Stadt abgestellt« hat, von einem Fremden geöffnet wird, der sich aus dem Kofferinhalt »bedient«, dürfte mittlerweile in ihrer Unschuld historisch geworden sein – nach den missglückten Koffersprengstoff-Attentaten. Dass es der »Panik-Berater« war, der dem um seine Hilfe nachsuchenden Erzähler zu diesem »sogenannten Koffer-Experiment« geraten hatte, damit er als Beobachter, wie er am Ende mutmaßt, durch das Fortleben seiner intimen Lebensbegleiter auf dem Körper eines Fremden »auf mein eigenes Verschwinden aufmerksam« gemacht werde: in diese poetische Konstellation Genazinos schießt durch die jüngsten Ereignisse eine unheimliche, makabre, unvorhersehbare andere Epiphanie ein: die des massenhaften Verschwindens im terroristischen Verbrechen.
Daran hat Genazino, dieser seismographische Vermesser des öffentlichen urbanen Raums, natürlich nicht gedacht, wenn er in der letzten Vorlesung, die sich drei »literarischen Praktikern des Augenblicks« widmet, davon spricht, dass wir heute »in einer Fassungslosigkeit leben, die als Ganzes vielleicht nicht mehr beschrieben werden kann«. Er meint damit, dass die einstige Urbanität unserer Städte durch »ausschließlich ökonomisch zugerüstete Städte« dahin ist und deren »Übermacht der Einflüsterungen« ein »unangefochtenes Individuum« nicht mehr zulässt. Indem er gewissermaßen den »Verfall der Aura« (Benjamin) verfolgt, der die Idee der Epiphanie von Proust »Madeleine-Erlebnis über die »metaphysische Selbsterhebung« bei Joyce bis zur epiphanischen Erfahrung Virginia Woolfs unterworfen ist, schreibt er dem »Flaneur« den Totenschein aus, den die Kritik immer noch als mythische Figur seiner Romane zu erkennen meint.
Vom Flaneur zum Streuner
An seine Stelle getreten sei der modernere Typus des Streuners, der »selbst der Ungemütlichkeit noch einen Reiz abgewinnen will und dabei oft erfolgreich ist. Genazino, der in seinem Streuner-Typus offenbar die noch bürgerlich, wenn auch höchst prekär abgesicherte Variante des von allen Sicherheiten verlassenen Stadtstreichers sieht, beruft sich für seine pessimistischen Ansicht auf die hell- & weitsichtigste Analytikerin des modernen Großstadtlebens und seiner ichzerstörerischen Schizophrenien: Virginia Woolf.
Ihr und nicht Franz Hessel oder Robert Walser »fühlt« er sich »am nächsten«. In einer Reportage, die sie Anfang der 30iger Jahre des vorigen Jahrhunderts (!) geschrieben hat, analysiert sie am Beispiel des Londoner Alltagslebens den »Druck einer ungeheuren Maschine«, in der am Leben zu bleiben »unsere ganze Energie erfordert (…): Heute kann kein einzelner Mensch mehr dem Druck gesellschaftlicher Verhältnisse widerstehen. Sie fegen über ihn hinweg und vernichten ihn. Sie lassen ihn gesichtslos, namenlos, ledig als ihr Instrument zurück«. Virginia Woolf rage deshalb unter allen zeitgenössischen Schriftstellern heraus, weil sie »den Zwang eingesteht, sich vertraute und unvertraute Pathologien so zu eigen zu machen, als gehörten diese immer schon zur Grundausstattung des menschlichen Gemüts«. Die Gratwanderung auf der Grenzscheide von Melancholie und Pathologie, die Virginia Woolf zuletzt nicht mehr gelungen ist, gehört auch zu den existenziellen Gefährdungen des Melancholikers Wilhelm Genazino, der sie unter dem Schmelz des Humoristischen, den sein größeres Publikum an seinen letzten Romanen vornehmlich wahrnimmt, diskret verbirgt.
Genazinos Bekenntnis zur engsten literarischen Verwandtschaft mit der großen englischen Schriftstellerin ist nur deshalb erstaunlich, weil die Überraschung, die er unserer literarischen Gegenwart mit diesem Geständnis bereitet, unsere Ignoranz beweist. Denn obwohl der Fischer-Verlag das Werk der Autorin auf die denkbar beste Weise gepflegt hat – mit Neu-& Erstübersetzungen ihrer Romane, Erzählungen, Essays, Tagebücher und Briefe – ist Virginia Woolf bei uns immer noch unbekannter als Wilhelm Genazino.
Mit seinen subtilen und weitreichenden Poetikvorlesungen, deren andere erstaunliche Pointe seine Hommagen an die Bildenden Künstler Joseph Cornell und Christian Boltanski sind, hat sich Genazino aber demonstrativ auch darum bemüht, für die Belebung des toten Winkels zu sorgen, in dem das große Oeuvre der Virginia Woolf, unerkannt & unbekannt, bei uns vor sich hinwest.
Tielangaben
Wilhelm Genazino: Die Belebung der toten Winkel
Frankfurter Poetikvorlesungen
München: Carl Hanser Verlag 2006
107 Seiten, 14,90 Euro
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander