Gesellschaft | Henri Lefebvre: Das Recht auf Stadt
Über Städte nachzudenken, das ist eine brennend aktuelle Angelegenheit. Denn die Situation ist unübersichtlich; jeder weiß, wie begehrt es ist, in der Stadt zu wohnen und nicht in deren Randbezirke, ›Schlafstädte‹, verdrängt zu sein. In den Schwellenländern wachsen Megastädte mit dreißig, vierzig Millionen Einwohnern, dass man sich grundsätzlich fragen muss, wie es noch möglich sein soll, gestaltend einzugreifen. Von WOLF SENFF
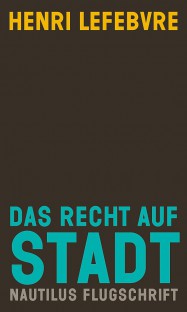 Henri Lefebvre, ein rebellischer Philosoph der sechziger Jahre, erlebt zurzeit eine Renaissance, auch sein ›Revolution der Städte‹ von 1970 wurde vor zwei Jahren neu aufgelegt. Aus Lefebvres Sicht ist die Stadt ein Ort höchst komplexer, lebendiger Interaktion, ein Ort des Wohnens und des Lebens, er setzt sich den Anspruch, eine Philosophie der Stadt auszuarbeiten.
Henri Lefebvre, ein rebellischer Philosoph der sechziger Jahre, erlebt zurzeit eine Renaissance, auch sein ›Revolution der Städte‹ von 1970 wurde vor zwei Jahren neu aufgelegt. Aus Lefebvres Sicht ist die Stadt ein Ort höchst komplexer, lebendiger Interaktion, ein Ort des Wohnens und des Lebens, er setzt sich den Anspruch, eine Philosophie der Stadt auszuarbeiten.
Reichtum, Macht, Wissen
Die Herausbildung städtischer Systeme seit der Industrialisierung sei ein dialektischer Prozess, dessen widerstreitende Aspekte er mit Industrialisierung/Urbanisierung beschreibt, mit Wachstum/Entwicklung, mit wirtschaftlicher Produktion/gesellschaftlichem Leben.
Während die mittelalterliche Stadt noch um Marktplatz und Kirche zentriert gewesen sei, die kapitalistische Handelsstadt bereits einen zentralen Kommerzbereich enthalten habe, finde sich in den Zentren der modernen Metropolen eine hohe Verdichtung von ökonomischem Reichtum, Macht und Wissen.
Zentralisierung und Aufsplitterung
Dieser strikten Zentralität zum Trotz bleibe ›Stadt‹ tendenziell ein lebendiger Organismus, vielfältig zusammengesetzt und ständiger Veränderung unterworfen, und Lefebvre betont, dass es sich um vielschichtige und sogar paradox widersprüchlich erscheinende Prozesse handle, die den grundlegenden Charakter einer Stadt formen, um wirtschaftliche, politische, kulturelle Prozesse, auch Besitzverhältnisse, Klasseninteressen. ›Stadt‹ sei in ihrer konkreten Ausformung jeweils ein Ergebnis, ein ›Werk‹, »eher einem Kunstwerk vergleichbar als einem simplen materiellen Produkt«, und jedes städtische Gebilde erlebe einen Aufstieg, einen Höhepunkt, einen Verfall.
»Der Staat und das Unternehmen versuchen die städtischen Funktionen an sich zu reißen, anzunehmen und wahrzunehmen, indem sie die Form des Urbanen zerstören«. Wenngleich das niemand persönlich plane und in die Tat umsetze, seien es doch immanente Prozesse, die die Stadt letztlich zentralistisch gliedern und separieren in Gruppen, Ethnien, Generationen, in Intellektuellen-, Arbeiter-, Studentenviertel, in diverse Freizeit-, Konsum-, Industrie-, Verwaltungsbereiche.
›Recht auf Stadt‹
Insofern sei sie in weiten Bereichen durch Zwänge definiert, sie werde ein Ort der Produktion, der Kontrolle des Alltagslebens, des Konsums – ein monotones »Räderwerk«. Die Urbanität als städtische Region freien Genusses, als »Bereich des Gebrauchwertes« sei verdrängt durch Erfordernisse industrieller Produktion und staatlicher Bürokratie. Für staatliche Macht und wirtschaftliche Interessen sei urbanes Leben, seien »humanistische Anliegen« letztlich störend, der Konflikt sei unvermeidbar.
Mit dem ›Recht auf Stadt‹ geht es ihm um eine grundsätzliche Staats- und Herrschaftskritik; er ergreift Partei für all die, die unter dem reglementierten städtischen Alltag leiden und marginalisiert werden: Jugendliche, Migranten, Frauen, Intellektuelle, Arbeiter. Das ›Recht auf Stadt‹ fordert eine Partizipation an der städtischen Zentralität – Information, Soziabilität, Vergnügungen etc. – ein, die letztlich nur durch soziale Kämpfe erreichbar sei.
Leben und Wohnen
Er formuliert das Recht auf Stadt als eine Forderung und versteht darunter ein Recht auf das städtische Leben »in verwandelter, erneuerter Form«. Leben und Wohnen seien die Bereiche, die die Bewohner für sich zurückerobern müssten. Er wird darin wenig konkret, was angesichts der erdrückenden Realitäten vielleicht auch schwerfällt.
Eine wichtige sinnstiftende Rolle schreibt er dabei der Kunst, auch der Musik zu. Paris und New York, schreibt er, würden bereits eine praktische Idee jener künftigen Urbanität vermitteln, da dort das Entscheidungszentrum – inklusive Wissenschaft und Kultur – und Konsumzentrum zusammenfiel. Ein solcher Stadtkern werde »stark von den neuen Chefinstanzen« genutzt werden, Lefebvre sieht erneut ein sich in den Raum erstreckendes »Universum der Konzentration« bis zu den Satellitenstädten.
Mal geht’s so, mal geht’s so
Lefebvre trifft mit seiner Darstellung zweifellos die gegenwärtige Realität unserer Städte. Was wir an Gentrifizierung erleben, sind soziale Selektionsprozesse, für die eine desorientierte kommunale Politik mit dem massiven Verkauf staatlichen Wohneigentums erst die Voraussetzungen schuf.
Andererseits muss man anerkennen, dass die Kommunen Probleme der Segregation im Blick haben und eine Mischung städtischer Funktionen angestrebt wird; das lässt sich zuverlässig stets am Einzelfall darstellen.
Luftschlösser
 Wenden wir Lefebvres Aussagen einmal in aller Kürze auf Hamburg an. Was an dieser Stadt vor allem auffällt, ist der ununterbrochene Trubel. Da liegt es nahe, zu fragen, ob denn die Präsentation von ›Hamburg meine Perle‹ – Magnet des deutschen/nordeuropäischen Tourismus – ein Teil städtischen Lebens sein kann und gar ein Beispiel lebendiger, selbstbestimmter Urbanität. Gleichermaßen stellt sich die Frage, ob das Werben um eine superreiche internationale Klientel – Hafencity, Elbphilharmonie – konzeptionell sinnvoll ist und ob derartige Orte, die viel mediale Aufmerksamkeit genießen, für die städtische Bevölkerung überhaupt eine Rolle spielen.
Wenden wir Lefebvres Aussagen einmal in aller Kürze auf Hamburg an. Was an dieser Stadt vor allem auffällt, ist der ununterbrochene Trubel. Da liegt es nahe, zu fragen, ob denn die Präsentation von ›Hamburg meine Perle‹ – Magnet des deutschen/nordeuropäischen Tourismus – ein Teil städtischen Lebens sein kann und gar ein Beispiel lebendiger, selbstbestimmter Urbanität. Gleichermaßen stellt sich die Frage, ob das Werben um eine superreiche internationale Klientel – Hafencity, Elbphilharmonie – konzeptionell sinnvoll ist und ob derartige Orte, die viel mediale Aufmerksamkeit genießen, für die städtische Bevölkerung überhaupt eine Rolle spielen.
Ebenso fehlt der Stadt eine Aufarbeitung der Tatsache, dass das einhellige Begehren hiesiger Wirtschaft und Politik, die Olympischen Spiele nach Hamburg zu holen, von der Bevölkerung unmissverständlich abgelehnt wurde. Was läuft falsch in dieser Stadt? Politische und wirtschaftliche Entscheidungszentren haben sich verselbstständigt? Wishful thinking? Luftschlösser? Ein Wolkenkuckucksheim?
Mächtig Vergnügliches
Hamburg schmückt sich mit Musicals wie ›König der Löwen‹, ›Aladdin‹, ›Phantom der Oper‹; mit Aktivitäten wie Stadtmarathon, Halbmarathon, Harley Days, Cyclassics; mit Kulturfesten wie Museums-, Theaternacht, Nacht des Wissens, Filmfest, Elbjazzfest, Altonale, dem Motorrad-Gottesdienst, dem Alstervergnügen, mit ›Du und deine Welt‹, mit dem Hafengeburtstag, mit neulich der IGA. Wir hatten Vattenfall-Lesetage, wir hatten HEW-Lesetage, wir haben nun ›Lesen ohne Atomstrom‹, wir haben Hamburger Dom zu allen Jahreszeiten, die ›Queen Mary‹ legt an.
Damit sind Event und Klamauk keineswegs vollständig aufgezählt, die Liste ließe sich fortsetzen. Mächtig Vergnügliches wird da auf die Beine gestellt, doch es handelt sich nicht um urbanes Leben, im Gegenteil. Die Stadt wird überschwemmt von den vielerlei Produkten von Hamburg-Werbung, von Hamburg-Marketing, denen ein wohlkalkuliertes geschäftliches Interesse zugrunde liegt, und damit sind wir endgültig bei den Pfeffersäcken angekommen, also bei denen, die die Geschicke dieser Stadt lenken.
»Geplante Industrialisierung«, »Kulturrevolution«
Die Thesen von Henri Lefebvre sind aktuell, sie sind mit der touristischen Angebotspalette und Hamburgs zwanghaften Ambitionen, als Weltstadt zu gelten, treffend illustriert. Fragt man nach dem realen urbanen Leben, findet man nicht mehr als zaghafte Ansätze, deren Ausgestaltung vor dem Hintergrund all der lauten, bunten, kommerziellen Aktivitäten schwierig wird.
Hinzugefügt sei, dass Lefebvre eine »geplante Industrialisierung« für erforderlich hält – ein wichtiges Thema, wenn man bedenkt, welch beschädigten Planeten uns die urwüchsigen, spontanen Industrialisierungsschritte der letzten Jahrhunderte hinterlassen haben. Außerdem hält er eine »permanente Kulturrevolution« für unabdingbar; konkrete Erfahrungen mit der chinesischen Kulturrevolution (1966-76) lagen ihm 1968 allerdings noch nicht vor.
Titelangaben
Henri Lefebvre: Das Recht auf Stadt
(Le droit à la ville, Paris 1968/2009, übersetzt von Birgit Althaler)
Hamburg: Edition Nautilus 2016
220 Seiten, 18 Euro
Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander
Reinschauen
| Leseprobe



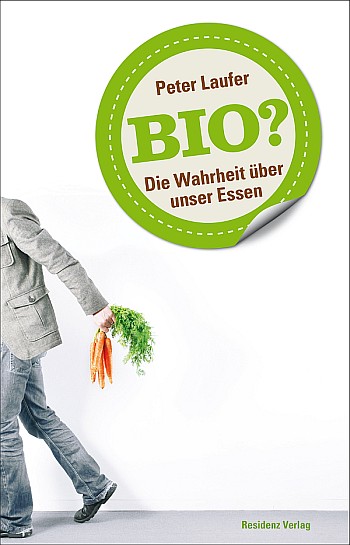
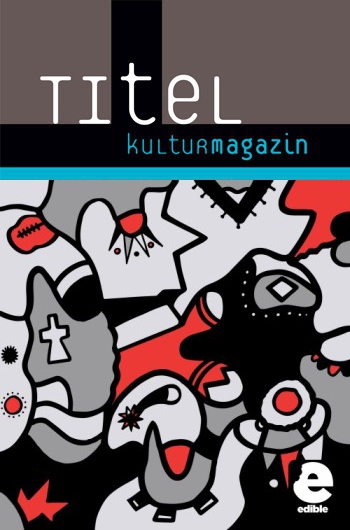
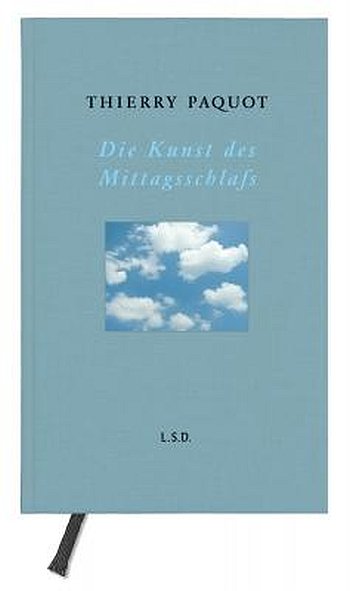




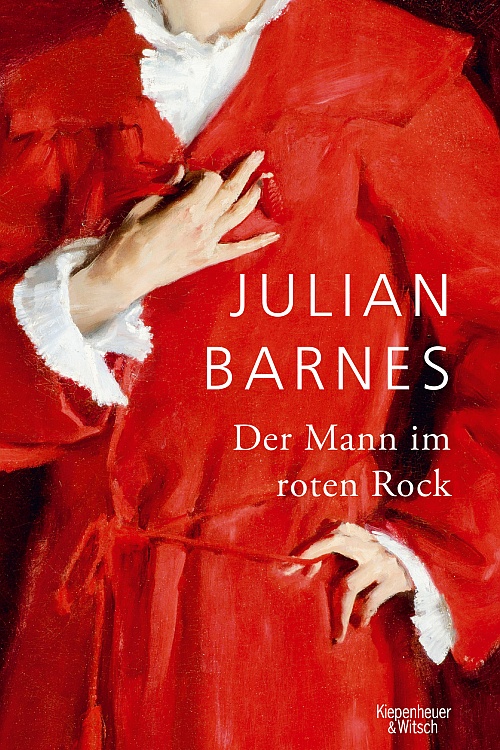
[…] droit à la ville“ sprach. Dieses Buch ist nun in deutscher Sprache erschienen, worüber Sie hier schlau machen […]