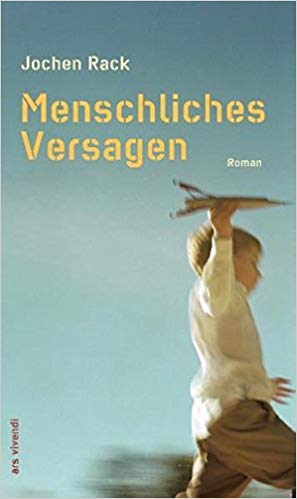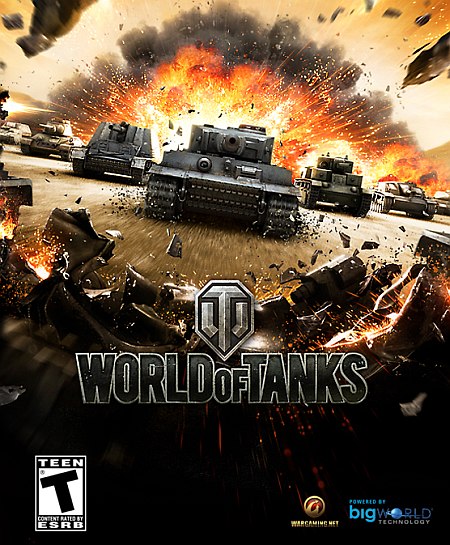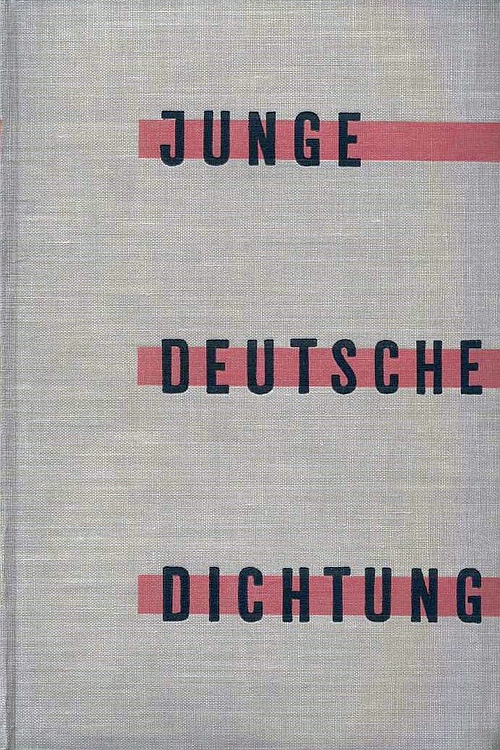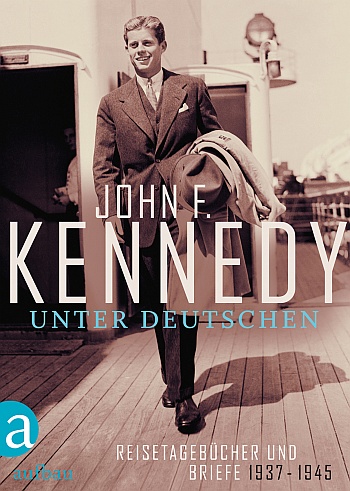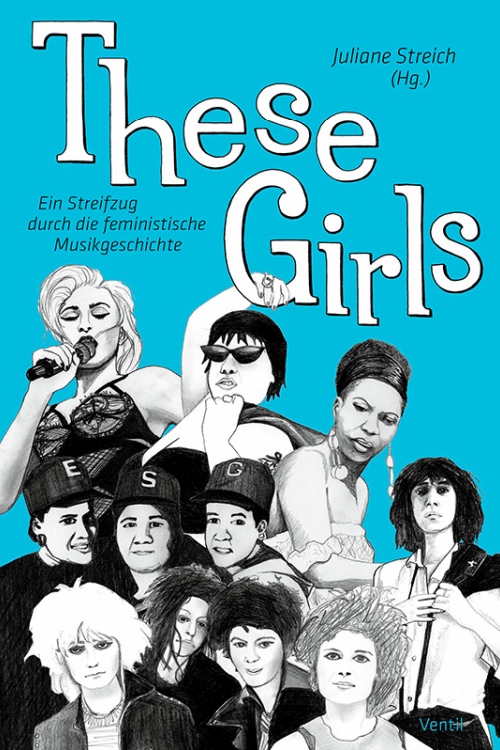Menschen | Herta Müller: Lebensangst und Worthunger
»Ich wurde lebenshungrig, gespenstisch erpicht aufs Leben, und sei es noch so kompliziert.« Herta Müller im Gespräch mit Michael Lentz. Von THEO BREUER
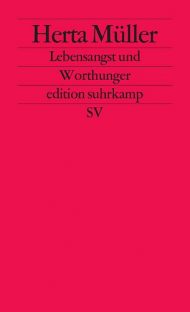 In den Tagen, als man ihr unangekündigt den Arbeitsplatz wegnahm, auch im Büro der Kollegin kein Plätzchen mehr blieb und sich schließlich auf einer zugigen Treppe der Fabrik, in der sie als Übersetzerin arbeitete, allen äugelnden Gestalten ausgesetzt, wiederfand, begann Herta Müller (statt sich mit überflüssigen Übersetzungen abzugeben) mit der Niederschrift der Erzählungen, die in ihrem ersten Buch, dem 2010 zum erstenmal in vollständiger Fassung erschienenen Erzählband Niederungen zusammengefaßt sind.
In den Tagen, als man ihr unangekündigt den Arbeitsplatz wegnahm, auch im Büro der Kollegin kein Plätzchen mehr blieb und sich schließlich auf einer zugigen Treppe der Fabrik, in der sie als Übersetzerin arbeitete, allen äugelnden Gestalten ausgesetzt, wiederfand, begann Herta Müller (statt sich mit überflüssigen Übersetzungen abzugeben) mit der Niederschrift der Erzählungen, die in ihrem ersten Buch, dem 2010 zum erstenmal in vollständiger Fassung erschienenen Erzählband Niederungen zusammengefaßt sind.
Dies sind Geschichten, die Kindheit und Jugend in einem Dorf im Banat zur Sprache bringen, jener Gegend in Rumänien also, in die Herta Müller hineingeboren wurde, um sich fortan nichts als zu wehren und in ihrem Dasein nach und nach jedes Gefühl von Heimat zu verlieren, das sie sich, am Ende auf einer kalten Treppe gelandet, mit den Wörtern, den Sätzen, den Vergleichen und Metaphern zurückerobern mußte, wollte sie, der Sprache mehr bedeutete als Floskel und Zynismus (Man hat aufgepaßt, daß die Gewalt und Lächerlichkeit dieser Sprache einem nicht auch noch in den eigenen Mund hineinrutscht. Daß sie einem nicht in den eigenen Kopf wächst), nicht frühzeitig eingehen in einer Welt, die sie mit gleichsam toten Augen anstarrte.
In jenen Tagen während der 1970er Jahren schlüpfte die Schriftstellerin Herta Müller aus dem Ei. Niederungen erschien, nachdem es zunächst vier Jahre lang vom Verlag zurückgehalten wurde, 1982 in stark zensierter Fassung.
Das ist schwer zu sagen
In Lebensangst und Worthunger stellt sich Herta Müller im Oktober 2009, drei Wochen nachdem bekannt wurde, daß sie den Nobelpreis für Literatur erhalten würde, den Fragen von Michael Lentz. Die jeweils mit einer abwehrenden Floskel – Das ist schwer zu sagen – einsetzenden, sodann sehr differenzierten, zu kleinen Aufsätzen ausufernden Antworten gewähren aufwühlende Einblicke in die ineinander verschmelzende Arbeits-, Denk-, Lebens- und Schreibweise der Autorin, ihre Auseinandersetzungen und Erfahrungen mit dem Dasein in Dorf und Diktatur, mit den sie umgebenden, sie zu beherrschen suchenden Menschen. Sie spricht über die zweifache, mit sich und miteinander tanzende, ineinander verschlungene rumäniendeutsche Sprachexistenz, die in der Müllerschen Lyrik und Prosa auf so zauberische Weise stilbildend wirkt, sowie das Ausgestalten des Romans Atemschaukel, den sie mit Oskar Pastior gemeinsam vorbereitete, bis dessen jäher Tod die gemeinsame Vollendung des Buches verhinderte:
Und wenn ich im Erfinden nicht mehr weiterwußte, habe ich in seine Gedichtbände geschaut, und dann sprangen mir die Worte zu. Ich habe gar nicht lange gesucht, zufällig einen Gedichtband aufgeschlagen, und da war es. Immer wieder sprang so ein Wort heraus. Ich brauchte ein Adjektiv, und in irgendeinem Gedicht stand es schwarz auf weiß. »Na bitte, da haben wir es doch«, hab ich mir dann gesagt. Oder in den schönen filigranen Zeichnungen von Oskar Pastior saßen Formen und Wörter für den Lagertext. Dabei hab ich immer den Eindruck gehabt, er schreibt jetzt ja doch noch mit. Und bevor ich eins seiner Bücher aufschlug, habe ich zu mir selbst gesagt: »Oskar, jetzt sag mal was.« Und er sagte was. Wenn ich es darauf anlegte, mußte er mir helfen.
Irrlauf im Kopf
Die letzten Sätze lösen alles bis dahin Gesagte auf gleichsam wundersame Art in Luft auf, als Herta Müller, die sich die Wörter zum reinen Überleben erkämpft hat, das Phänomen des Ergriffenseins beim Lesen beschreibt. Der höchste Moment ist für sie jener, der nicht mit Wörtern zu fassen ist, der Augenblick, in dem bloß fassungsloses Staunen bleibt, das sie als Irrlauf im Kopf bezeichnet: Man kann ja nicht alles in Wörtern sagen. Man denkt ja auch anders als nur in Wörtern. Und man fühlt ja sowieso nicht in Wörtern. Das meine ich damit. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt damit erklärt habe. Der »Irrlauf im Kopf«, das ist das, was einen so verblüfft, als würde man es vor Bewunderung nicht mehr aushalten.
Mir ist während der Lektüre von Lebensangst und Worthunger, als säße Herta Müller mir gegenüber. Ich höre sie die Wörter, die ich lese, sprechen, und gleichzeitig mäandern die Bücher durchs Gehirn, die mit wilden Wörtern und magischen Metaphern so manchen Irrlauf heraufbeschwören: Atemschaukel, Die blassen Herren mit den Mokkatassen, Der Fuchs war damals schon der Jäger, Der König verneigt sich und tötet, Der Mensch ist ein großer Fasan auf der Welt, Drückender Tango, Herztier, Niederungen und Reisende auf einem Bein. Ich freue mich (und bin gespannt) auf mehr.
| THEO BREUER
Titelangaben
Herta Müller: Lebensangst und Worthunger
Im Gespräch mit Michael Lentz
Leipziger Poetikvorlesung 2009
Berlin: Suhrkamp 2010
56 Seiten, 8 Euro