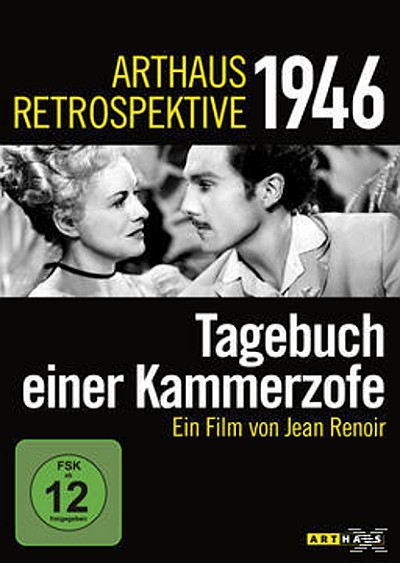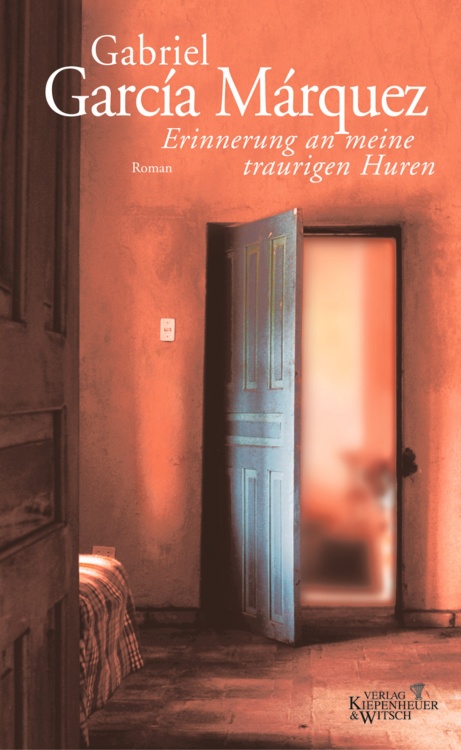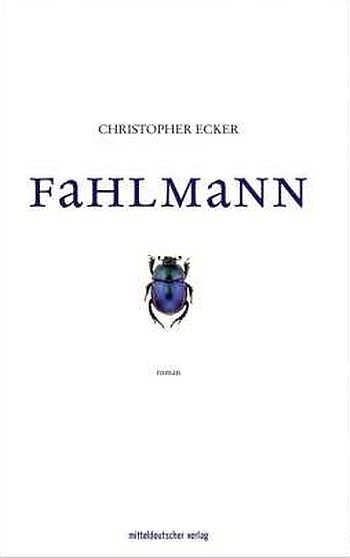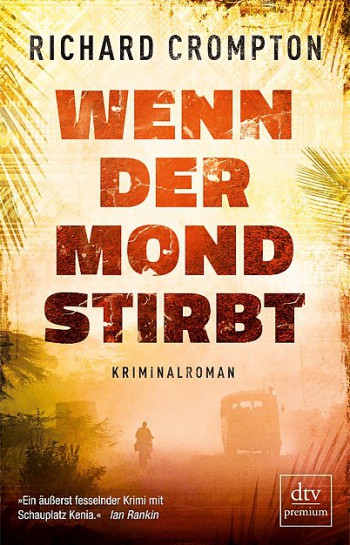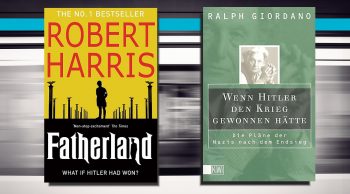Roman | Günther-Anders: Die molussische Katakombe – Die Kirschenschlacht
Günther Anders hätte einer der gefeierten deutschen Dichter und Denker werden können, hätte die Zäsur von 1933 nicht zur Verwandlung allzu vieler Deutscher in Richter und Henker geführt. Bekannt ist der politische und philosophische »Fundamentalpessimist« heute vor allem als früher Technik- und Fernsehkritiker und geistiger Vater der Anti-Atombewegung. Sowie durch seine vorübergehend eheliche, später nie ganz abgerissene intellektuelle Beziehung zu Hannah Arendt. Dass er zuallererst ein glänzender Schriftsteller war, kann man jetzt erleben. Zum 110. Geburtstag am 12. Juli ist sein Roman Die molussische Katakombe endlich komplett erschienen, und dazu hat sein Verlag noch einmal seine Dialoge mit Hannah Arendt herausgebracht, Die Kirschenschlacht. Von PIEKE BIERMANN
 Man kann Die molussische Katakombe lesen als aufs Feinste und Hintergründigste ineinander gesponnene Episoden einer vielschichtigen Parabel. Oder als Sammlung von Fabeln voller Anspielungen auf Zeitgenossen. Oder als philosophisch-politisches Lehrstück mit poetischen Mitteln. Man wird sich beim Lesen an Swifts Gulliver erinnert fühlen. Oder – womöglich zum Unmut des Autors – an Kafkas Schloss oder Prozeß. Und heute natürlich an Orwells 1984 und Farm der Tiere.
Man kann Die molussische Katakombe lesen als aufs Feinste und Hintergründigste ineinander gesponnene Episoden einer vielschichtigen Parabel. Oder als Sammlung von Fabeln voller Anspielungen auf Zeitgenossen. Oder als philosophisch-politisches Lehrstück mit poetischen Mitteln. Man wird sich beim Lesen an Swifts Gulliver erinnert fühlen. Oder – womöglich zum Unmut des Autors – an Kafkas Schloss oder Prozeß. Und heute natürlich an Orwells 1984 und Farm der Tiere.
Man kann ebenso gut zuerst einer scheinbar unliterarischen Neugier erliegen: auf eine der schicksalssattesten Irrfahrten eines Kunstwerks vom angefangenen Manuskript bis zum gedruckten Buch. Schließlich hat der Autor selbst zu Lebzeiten sein Bestes als Katastrophen-Navigator dazugegeben. Und heute, im angebrochenen Zeitalter der digitalen Reproduzierbarkeit, hat die alte Binsenweisheit habent sua fata libelli selbst etwas Fabelhaftes bekommen.
Hellsichtiges Schwarzsehen
Jedenfalls ist Die molussische Katakombe eine umwerfend hellsichtige Fiktionalisierung dessen, als was sich der NS-Staat sehr bald sehr real entpuppt haben wird. Günther Anders, damals noch vor allem bekannt unter seinem amtlichen Namen Günther Stern, hatte 1930 begonnen, sie zu schreiben. Er hatte schon 1928 Hitlers Kampf tatsächlich gelesen und – im Gegensatz zu vielen intellektuellen Zeitgenossen – ernst genommen. Er hatte daraus den Schluss gezogen, dass in solchen Zeiten Hellsicht vor allem Schwarzsehen bedeuten muss. Nicht nur aus schieren Überlebensgründen und nicht nur für einen jüdischen Intellektuellen.
Sofort nach dem Reichstagsbrand 1933 geht er auf die Flucht, zuerst ohne das Manuskript. Das fällt kurzfristig in GeStaPo-Hände, wird aber als vermeintlicher Südsee-Roman für uninteressant gehalten. Hannah Arendt bringt es ihm etwas später nach Paris mit. 1936 flieht Anders weiter in die USA, dort beendet er es 1938 und – scheint es zu vergessen über anderen, aktuelleren wichtigen Projekten und der Notwendigkeit, Geld zu verdienen. Bis 1973 bleibt das komplizierte Konvolut, wo immer er es, inzwischen in Wien lebend, aufbewahrt. Dann versucht er sich an einer Bearbeitung und scheitert.
Gutes Ende einer langen Geschichte
Noch Anfang der 90er Jahre, als sowohl sein Nachlassverwalter Gerhard Oberschlick als auch sein Verlag C.H.Beck hartnäckig Interesse anmelden, lässt er sich nur leicht widerwillig herbei, es doch zu publizieren. 1992 kommt es endlich auf die Welt, zu Anders‘ 90. Geburtstag. Allerdings zuerst, aufgrund eines kleinen Durcheinanders bei den diversen Manuskriptfassungen, ohne Anhang. Anders erlebt die Publikation gerade noch, bevor er im Dezember 1992 stirbt.
Jetzt, zu seinem 110. Geburtstag, erscheint eine wunderschöne Neuausgabe mit Anhang, Apokryphen und all den nachgelassenen Dokumenten, die er für zugehörig erklärt hatte. Gerhard Oberschlick hat sie nicht nur sorgfältig ediert, dokumentiert und kommentiert, er erzählt auch auf dreißig Seiten spannend und vergnüglich vom fatum dieses libellus, der Detektivarbeit und den verbalen Catch-Runden mit dem in jeder Beziehung widerborstig-skeptischen Autor. Ihm vor allem verdanken wir, den »Roman« über das fiktive Terrorreich Molussien überhaupt lesen zu können.
Molussien ist überall
Im molussischen Untergrund, eben der Katakombe, leben Olo und Yegussa, »Parias«, ohne Licht und Zeit. Warum sie weggesperrt sind, weiß man nicht. Das geht seit endlosen Generationen so, immer gibt es einen Älteren, Olo, und einen Jüngeren, Yegussa, und was sie sich gegenseitig erzählen, hat eine archaische Anmutung voller scheinbarer Ab- und Ausschweifungen und verrückter Namen. Das Ganze ist aufgezogen wie eine Pseudodokumentation in sechs Kapiteln, verteilt auf die 44 Tage und Nächte des letzten Lehrers Olo und des letzten Schülers Yegussa.
Vertrackterweise kann aber, was dabei gesprochen wird – über Molussien und andere Orte, Widerstand und Revolution, Lüge, Erpressung und Wahrheit – nur vom Feind überliefert werden – den alles mitschreibenden Kalfaktoren. Dann folgen ein Anhang mit angeblichen Protokollen und Bulletins, die »Molussischen Apokryphen« mit Erläuterungen zu einzelnen Kapiteln und Personen und schließlich »Dokumente zu diesem Buch« aus den 30er Jahren.
Alles in allem ein reiches anarchisches Gemisch aus Genres, Erzählebenen und -stilen. Man kann sich also, drittens, auch einfach »naiv« dem Lesevergnügen hingeben, der saft- und kraftvollen Sprache und der phantastischen bitteren Komik, die entsteht, wenn gute Schriftsteller die halluzinatorische Übertreibungsschraube so weiterdrehen, dass es Wahrheiten funkt. Und man sollte es, man entdeckt nämlich ständig, wie rasend aktuell Anders‘ Wahrheiten sind. Die Naivität hat sich schnell erledigt, das Vergnügen wächst.
Noch ein Unter-Grund
 Wer obendrein Vergnügen am Entschlüsseln des biographischen und zeitgeschichtlichen Unterbodens von Literatur hat, sollte unbedingt Die Kirschenschlacht lesen. In ihr erzählt Anders nach dem Tod von Hannah Arendt von der kurzen Zeit, in der sich die beiden als Ideal des intellektuellen Paars inszenieren konnten. Eine Frau und ein Mann, geistig und rhetorisch ebenbürtig, 1929/30 auf einem kleinen Balkon in Berlin beim wollüstigen Kirschenentsteinen »symphilosophierend«, vermutlich nicht weniger wollüstig. Heute heißt so was salopp mind-fucking, und noch immer – allen Fortschritten im Geschlechterkampf zum Trotz – gilt: Das Hohe Paar geht meistens schief. Wie und warum in diesem Fall, das erzählt Christian Dries in seiner fast ebenso langen, in »Lebenswege« und »Denkwege« unterteilten Beziehungsskizze.
Wer obendrein Vergnügen am Entschlüsseln des biographischen und zeitgeschichtlichen Unterbodens von Literatur hat, sollte unbedingt Die Kirschenschlacht lesen. In ihr erzählt Anders nach dem Tod von Hannah Arendt von der kurzen Zeit, in der sich die beiden als Ideal des intellektuellen Paars inszenieren konnten. Eine Frau und ein Mann, geistig und rhetorisch ebenbürtig, 1929/30 auf einem kleinen Balkon in Berlin beim wollüstigen Kirschenentsteinen »symphilosophierend«, vermutlich nicht weniger wollüstig. Heute heißt so was salopp mind-fucking, und noch immer – allen Fortschritten im Geschlechterkampf zum Trotz – gilt: Das Hohe Paar geht meistens schief. Wie und warum in diesem Fall, das erzählt Christian Dries in seiner fast ebenso langen, in »Lebenswege« und »Denkwege« unterteilten Beziehungsskizze.
Die Kirschenschlacht öffnet aber nicht nur anrührende Blicke auf »private« Irrungen. Die Gespräche drehen sich um Vieles, das Anders kurz danach, allein und auf das Biestigste enttarnend, in der molussischen Katakombe weiterbearbeitet – Personen wie Heidegger natürlich, Begriffe wie Monaden, Analysen wie die über eine bestimmte Verwendung des Singulars und deren antihumanistischen Kern.
| PIEKE BIERMANN
Eine erste Version dieser Rezension wurde am 12. Juli 2012 bei Deutschlandradio Kultur veröffentlicht.
Titelangaben
Günther Anders: Die molussische Katakombe
Mit Apokryphen und Dokumenten aus dem Nachlaß.
Hgg. u. mit einem neuen Nachwort versehen von Gerhard Oberschlick
München: C.H. Beck 2012.
493 Seiten, 39,95 Euro
Günther Anders: Die Kirschenschlacht – Dialoge mit Hannah Arendt
Herausgegeben von Gerhard Oberschlick. Mit einem Essay von Christian Dries
München: C.H. Beck 2011/12.
143 Seiten, 16 Euro