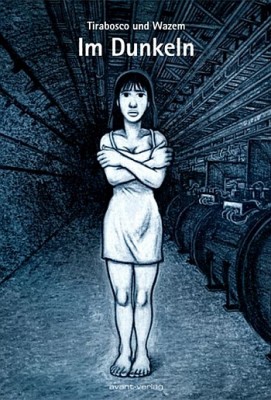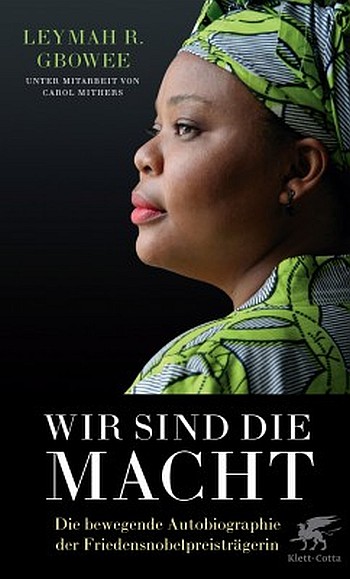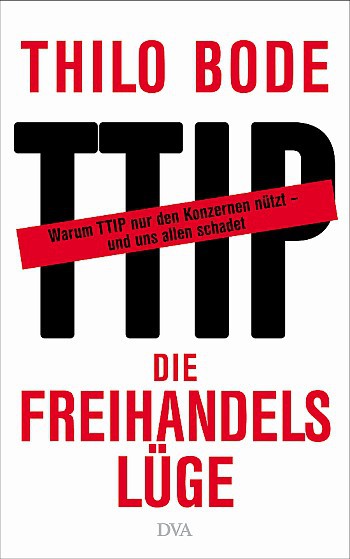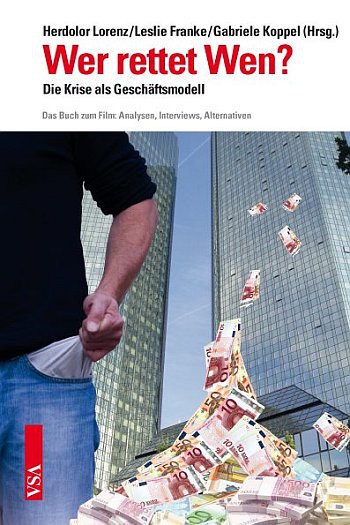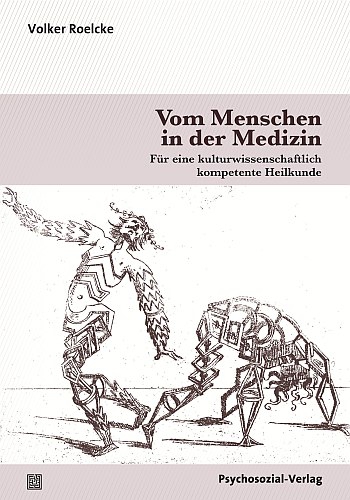Gesellschaft | Frank Schirrmacher: Ego
Frank Schirrmacher zeichnet in Ego. Das Spiel des Lebens ein dystopisches Bild unserer Gesellschaft. Der Primat der Ökonomie hat Einzug erhalten in unseren Köpfen und folgt dabei einer kühlen rationalen Handlungsmaxime, die ausschließlich nach Profit giert und jedwede Moral vertilgt. Von MARC STROTMANN
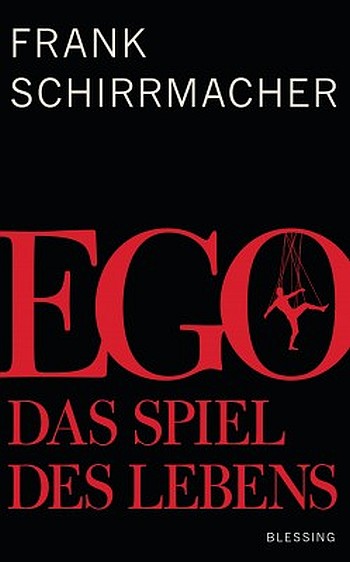
Seit der Lehmann-Pleite taumeln die westlichen Industrienationen von einer Krise in die nächste, sowohl die Euroländer als auch die USA, die ihre eigene Nation mit immensen Budgetkürzungen geißeln. Die Ohnmacht der Politik vor den Märkten nimmt immer groteskere Züge an, das italienische Wahlfiasko scheint nur ein Sinnbild von vielen. In diesen Zeiten sind Kapitalismuskritiken bei der intellektuellen Avantgarde en vogue. Der FAZ-Herausgeber Frank Schirrmacher heizt mit seiner Streitschrift Ego die Debatte weiter an. Bereits Marx postulierte, der Kapitalismus schaffe sich seine Totengräber. In diesem Sinne passt die Aussage des Spiegel-Kolumnisten Jakob Augstein, mit Schirrmachers Neuveröffentlichung sei die Kapitalismuskritik im Herzen des Kapitalismus angekommen.
Dabei wäre es verfehlt, den konservativen Feuilletonist nun als Prediger einer neuen linken Bewegung zu preisen. Schirrmachers Kritik richtet sich explizit auf die Gefahren der Ära des Informationskapitalismus, dessen Algorithmen den Menschen auf ein Minimum abstrahieren, um sein Verhalten und sein Denken zu berechnen.
Geburtsstunde des Homo oeconomicus
Als Schlüsselsituation, welche die verheerende Wende einleitet, definiert Schirrmacher das Ende des Kalten Krieges. Im ständigen Bewusstsein, ein Angriff des Feindes könnte den Endschlag bedeuten, standen sich die Großmächte USA und Sowjetunion Auge in Auge gegenüber. Jeder Schritt konnte der letzte sein, jeder Fehler den Untergang bedeuten. Um die Wachsamkeit der eigenen Truppen zu schärfen, wendeten amerikanische Physiker der »RAND Corporation« spieltheoretische Modelle an: Die Soldaten sollten im Rüstungswettkampf mit der sowjetischen Armee ein Spiel sehen, in dem es darum geht, jede Bewegung, jede Handlung des Gegners als einen Spielzug zu bewerten. Um nicht in die Falle des Mitspielers zu tappen, denn jeder Schritt konnte ein gewieftes Manöver bedeuten, um den Sieg davon zu tragen, gilt als oberste Handlungsprämisse, in jedem Fall das Schlimmste anzunehmen. Nur wer vernünftig, also rational ist, gleichbedeutend in höchstem Maße egoistisch und ausschließlich an sich selbst denkt, dem gelingt es, seinem Gegenüber nicht auf dem Leim zu gehen. Der moderne Homo oeconomicus war geboren, der als Entscheidungsmaxime nur seinem Eigennutz folgt. Jede Interaktion lässt sich gleich einer mathematischen Formel berechnen. Mit dem Zerfall der Sowjetunion transportierten die Physiker die spieltheoretischen Modelle in die Sphäre der Ökonomie und die Logik des kühl, rationalen Homo oeconomicus fand Eingang in die Gesellschaft.
Darauf beruht die Basis für Schirrmachers Argumentationslinie. Die egoistische Handlungsmaxime eignete sich ideal für die Logik der ökonomischen Märkte. In Verbindung mit den digitalen Errungenschaften lässt sich das Verhalten des Gegenspielers minutiös berechnen. Ganze Abteilungen der Investmentbanken seien damit beschäftigt, die Absichten konkurrierender Händler aus einem riesigen Datenmaterial mithilfe von Computern und der Spieltheorie in atemberaubender Geschwindigkeit zu entschlüsseln und ihr eigenes Handeln danach auszurichten, schreibt Schirrmacher. Wer am Markt im Kampf bestehen will, hat nur sein eigenes Wohl im Sinn, Kooperation ist dem Niedergang gleichzusetzen.
Düstere Szenarien
Die Crux besteht nun darin, dass das Denken des Homo oeconomicus nicht in der Arena der Ökonomie verhaften bleibt, sondern in sämtliche gesellschaftlichen Sphären der Gesellschaft sickert. Das ist die Pointe, die Schirrmacher setzt und in halsbrecherischem Tempo serviert. Wir selbst entwickeln uns zunehmend zu rationalen Monstern, die sich egoistisch und misstrauisch gegenüber unseren Mitmenschen verhalten. Durch die Möglichkeiten der modernen Technik tröpfelt uns die Ökonomie diese Handlungsmaxime ein, damit sich unser Verhalten, Denken und Handeln vorhersagen, in Zukunft gar steuern lässt. Starker Tobak den Schirrmacher in reißerischer Sprache präsentiert. Es mangelt an empirischen Belegen und doch fällt es schwer, sich der Sprachgewalt des Journalisten zu entziehen. Er beleuchtet die Debatte nicht unter akademischen, vielmehr unter feuilletonistischen Aspekten und liefert dabei einige reizvolle Denkanstöße. Die Logik des Marktes breitet sich aus wie ein Virus, die Politik weiß sie schon längst nicht mehr zu bändigen, sondern ordnet sich ihr unter. »Die politischen Akteure sitzen in der Falle. Dass das so war, sagten sie selbst, sagten Medien, Analysen, sah jeder, der die Nachrichten anschaltete«, hält Schirrmacher fest. Die Irrungen und Wirrungen der Eurokrise haben mehr denn je verdeutlicht, dass die Parlamente sich in der Rolle der Getriebenen wiederfinden, statt als treibende Kraft zu agieren.
Bei Weitem nicht das einzige düstere Szenario, welches der Autor aufzeichnet. Das Verkommen des primären Bildungsideals macht Schirrmacher als weitere Folgeerscheinung aus. Es gehe nicht mehr darum, Wissen anzuhäufen, sondern Informationen, mit denen sich nach Marktregeln erfolgreich spielen lässt. Der rationale Spieler handelt nach der Logik des Homo oeconomicus keinesfalls primär mit ehrlichen Mitteln. Mit allen Mitteln soll ein künstliches Ich geschaffen werden, Lebensläufe werden poliert und modelliert, man denke nur an Facebook, damit sie sich gleich einer Ware mit hohem Profit verkaufen lassen. Diese Logik erfordert Eigenverantwortung, jeder ist seines Glückes Schmied oder wie in der Werbung propagiert: »Du kannst alles sein, was du sein willst!« Schirrmacher bedient sich für diese Diagnose noch stärker dem ökonomischen Vokabular, jeder Mensch müsse zum Mensch seines eigenen Ichs werden. Der Gedanke ist nicht neu – bereits Michel Foucault erkannte die wachsende Tendenz des unternehmerischen Selbst – und doch hat er aufgrund der schirrmacherischen Heftigkeit seine Geltung.
Aufregend zukunftsweisend
Es ist unzweifelhaft, dass Schirrmachers Thesen Kontroversen hervorrufen. Kritiker werden sie als antiamerikanistisch deuten oder als Verteufelung des modernen Fortschritts im Stile eines Erben Adornos. Wieder andere werden die mangelnde Beweislage anfechten. Dennoch bietet Ego genug Anknüpfungspunkte, die der Kapitalismusdebatte neue Anreize bieten. Wer sich auf Schirrmachers Werk einlässt, kann einige aufregende und zukunftsweisende Ansichten gewinnen.
Titelangaben
Frank Schirrmacher: Ego. Das Spiel des Lebens
München: Blessing 2013
352 Seiten. 19,99 Euro