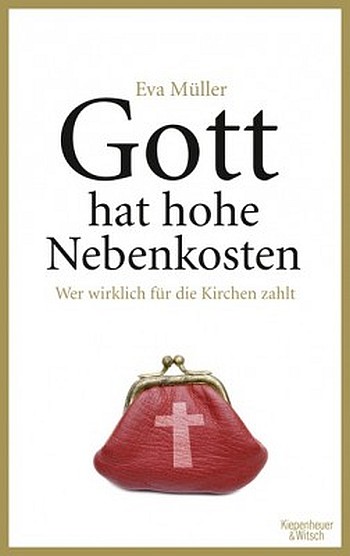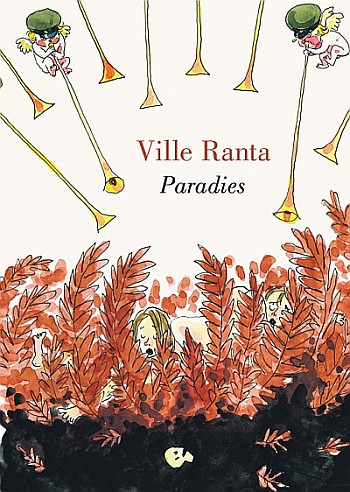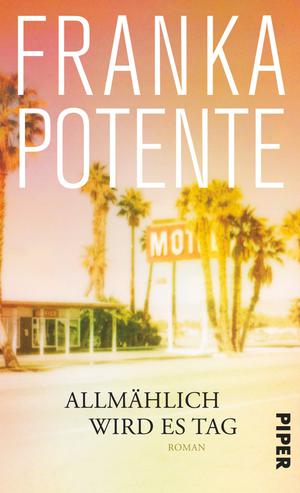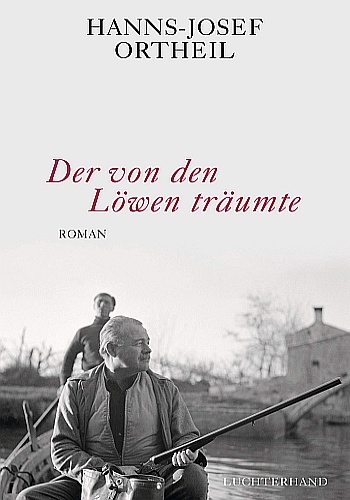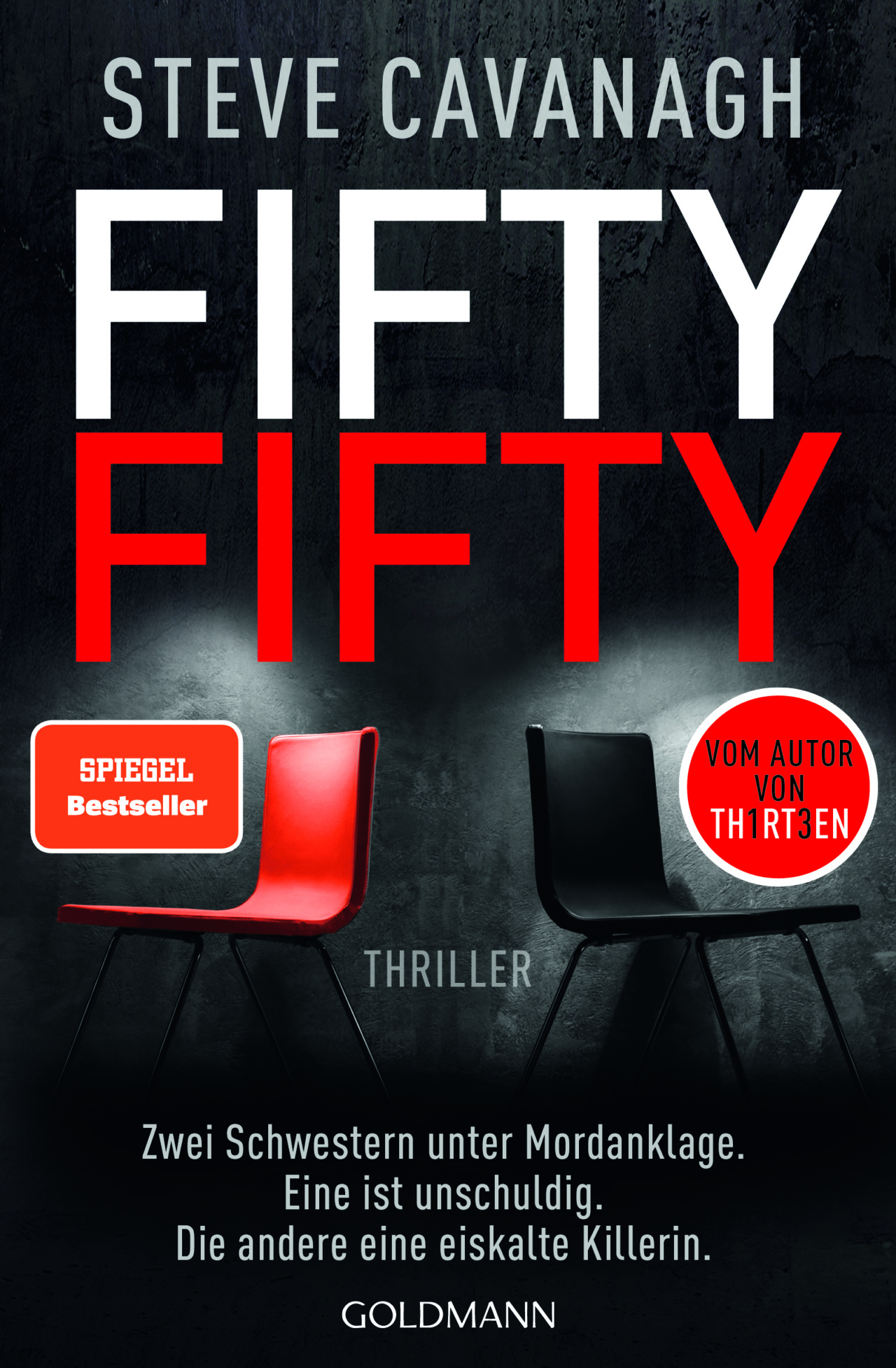Roman | Alberto Manguel: Zwei Liebhaber des Schattens
Die beiden so eben bei S. Fischer erschienen neuen Kurzromane – so der Autor – Zwei Liebhaber des Schattens von Alberto Manguel führen den Leser in die Dunkelkammer des Hades. Die Aufnahmen eines Fotografen als auch die Heimreise eines Südamerikaners verheißen nichts Gutes. Von HUBERT HOLZMANN
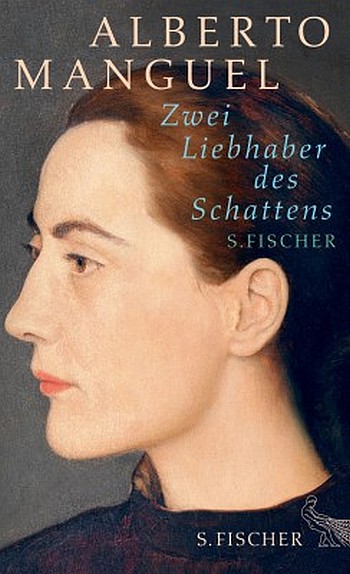
Der argentinische Übersetzer, Literaturdozent und Dichter Alberto Manguel veröffentlicht seit mehr als 30 Jahren Bücher, die den Leser selbst zum Thema haben: Von Atlantis bis Utopia ist ein Führer zu den imaginären Schauplätzen der Weltliteratur (1981), Eine Geschichte des Lesens (1998), Im Spiegelreich (1999), Tagebuch eines Lesers (2005), Die Bibliothek bei Nacht (2007). Alberto Manguel ist zeit seines Lebens ein Suchender – in Bibliotheken, Archiven, Büchersammlungen. In seinem neuesten Romanband Zwei Liebhaber des Schattens wird solch ein verlorener, phantastischer Archivfund einer vergessenen Bibliothek Kompositionsanlass für den ersten der beiden Kurzromane Ein allzu penibler Liebhaber.
In dieser dem Umfang und Konzept nach eher eine Novelle zu nennende Geschichte – Manguel bezeichnet es als »Pasticcio«, einem Gemeinschaftswerk – trägt der »Archivar« Manguel doch seine Geschichte aus Poitiers, das sich anders als andere französische Städte »peu à peu offenbart, Detail um Detail, ohne dem Besucher je wirklich zu gestatten, es in seiner Gänze zu erfassen«, aus verschiedensten Quellen zusammen. Und damit ist auch bereits der archimedische Punkt der Geschichte, die sich auf einige durchaus realistisch aufzustöbernde Texte gründet, erfasst. Denn die Suche nach dem Detail bildet den Kern der Handlung.
Doch zunächst stellt sich die Frage, ob nicht der Argentinier und Wahlfranzose aus der Sicht eines Stadtschreibers Alberto Manguel erzählt? Vielleicht. Jedenfalls gibt er seiner Liebesgeschichte einen quasi wissenschaftlichen Anstrich, stattet die Begebenheit mit einem »penibel« literaturwissenschaftlichen Vortext aus. Die Hinführung zum eigentlichen Gegenstand ist eine Vermessung der historischen und lokalen Umgebung, sie macht den Eindruck von Wissenschaftlichkeit, ist beinahe lehrreich. Es gibt also für eine schulmäßige Novelle den perfekten Rahmen. Manguel umkreist den Gegenstand, erfasst sein Umfeld, zitiert Zeitzeugen, blickt in Kommentare zum Tagebuch des Helden. Und erst später beginnt er, das Leben des Anatole Vasanpeine nachzuerzählen. Nicht immer ganz ohne Fiktion – wie er selbst betont.
»Der Liebhaber als Held«
Anatole Vasanpeine lebt am Rande der Gesellschaft am Ende des 19. Jahrhunderts. Er verdient seinen Lebensunterhalt als Bademeister und Aufseher einer der Badeanstalten und haust allein in seinem Labor. Die Badegäste interessieren ihn allem Anschein nicht. Er nimmt sie nicht einmal wahr. Jedenfalls nicht als Person. Denn er bemerkt nur die winzigen Details, etwa die Hände beim Lösen des Billets. Wie ein Anatom nimmt er einzelne Segmente des Körpers wahr. Niemals das Ganze.
Er treibt seine Suche nach diesen Teilen so weit, dass er beginnt, durch Ritzen und Spalten der Umkleidekabinen zu schauen. Vasanpeine entlarvt sich als Voyeur. Die Kamera als distanzierendes Auge darf nicht fehlen. Sie hält für ihn einen Bestand an Einzelheiten fest: einzelne Augen, die Lippen, ein Kinn, einen Finger, verschiedene Hautpartien und auch schon mal ein delikateres Körperteil. Vergangene Bilder von Badeanstalten entstehen vor unseren Augen. Etwa das »Porträt der Gabrielle d’Estrées und der Duchesse de Villars« aus der Schule von Fontainebleau aus dem 16. Jahrhundert: Der berühmte Fingerzeig auf die Brustwarze. Hier als vorausgedeutete Schwangerschaft. Bei Vasanpeine ist es keine Deutung. Vielmehr eine schrittweise Bestandsaufnahme und eine Suche nach einzelnen Puzzleteilen, ein Stückwerk.
Den Menschen als existierendes Ganzes erkennt Vasanpeine zum ersten Mal, als er vom Pfeil Amors getroffen wird. Völlig unvorbereitet. Außerhalb seiner Badestube. An dieser Stelle schaltet sich der Autor ein. Bemerkt die Unvollständigkeit der historischen Dokumentation, kündigt intuitive Ausgestaltung an. Extrem »penibel« nicht nur der Liebhaber, auch der Erzähler. Authentizität als Spiegel der literarischen Fiktion. Vasanpeine sieht erstmals die »kleine rundliche, schlurfende Gestalt« einer Frau, kugelförmig – Manguel äußert Mythologieverdacht.
Sein Held blickt diesmal nicht durch die Linse seiner Kamera, sondern durch die Glasscheibe eines Cafés, in dem er sitzt. Ein weiteres Mal also auch hier der trennende Abstand. Kein direktes Greifen, Begreifen möglich. Er springt auf, verfolgt die Gestalt durch das Gassengewirr, den Irrgarten der Stadt. Schafft es bis zu ihrer Wohnung. Der Held ein Stalker.
Manguel distanziert mit einem Verweis auf klassisch lateinische Quellen – »als fons et origo der Dichter-Inspiration«. Vasanpeine erklettert eine Mauer und fotografiert die Gestalt, als diese sich entkleidet. Danach: ein Flash. Schockstarre. Und Reinigung durch das Feuer – wie bei Canetti. Oder gilt vielleicht doch Platens Tristan-Vers: »Wer die Schönheit angeschaut mit Augen/ Ist dem Tode schon anheimgegeben«. Ob Vasanpeine in seinem Foto allerdings die Schönheit auffangen konnte, wird hier nicht verraten.
Dauerlauf durch die Strafbezirke
Zu einem Dauer- und Irrlauf durch verschiedene Stadtbezirke wird auch Manguels zweiter Kurzroman Die Rückkehr. Der Argentinier parodiert hier Dantes Commedia, die Höllenfahrt. Der alte Antiquar Néstor Andrés Fabris kehrt nach langen Jahren seines römischen Exils nach Hause zurück, in sein südamerikanisches Heimatland, das sich durch Militärdiktatur und Zwangsregime vollständig verändert hat. Er will zur Hochzeit seines Patenkindes reisen.
Doch die Reise ist eine Rückkehr ins Reich der Schatten. Als Fabris den Boden seines Landes betritt, noch am Flughafengelände, erlebt er die erste unangenehme Begegnung mit einer Toilettenfrau. Auch die Taxifahrt wird merkwürdig. Führt nur scheinbar ans gewünschte Ziel. Es ereignen sich einige Zufälle, Wechselfälle, kurze Spiegelungen der Vergangenheit in Fabris´ Wirklichkeit. Er trifft einen alten Freund, seine längst verschollene Freundin Marta. Doch sie entschwinden ihm wieder. »Tempus fugit!«
Er geht. Wie in einer Geisterstadt. »Der schmutzige Gang kam ihm unglaublich lang und verwaist vor. Staub und Dreck lagen in dichten Flocken auf den Türschwellen der Läden, und die Schaufenster waren von einer trüben Schicht bedeckt. Die Neonröhren an der niedrigen Decke flackerten unangenehm und verliehen der Passage während der Lichtintervalle etwas Höhlenartiges.« Fabris´ Weg führt hinüber in ein anderes Reich: Er sieht einen »riesigen Bus mit roten und gelben Streifen… Die Tür öffnete sich zischend, und eine tiefe, modulierte Stimme fragte ihn: `Wollen Sie zusteigen?´«
Am Lenker sitzt Fabris´ früherer Professor Grossman. Nun in der Rolle des Jenseitsführers, der den ehemaligen Schüler ins Reich der Verstorbenen führt: wie einen Neuankömmling. Die Rundfahrt führt vorbei an den Folterknechten der Diktatur, an den Gewinnern, an den Opfern. Er führt ihn auch zu seiner ehemaligen Geliebten Marta. Ein Zurück gibt es für ihn nicht mehr: Denn zurückgewiesen hat er das rettende »Sträußlein«, den öffnenden Schlüssel, der Dantes Held den Weg noch bereitet. Eine düstere Lektüre.
| HUBERT HOLZMANN
Titelangaben
Alberto Manguel: Zwei Liebhaber des Schattens
Übersetzt von Gottwalt Pankow und Lisa Grüneisen
Frankfurt/M.: S. Fischer 2013
160 Seiten. 18,99 Euro
Reinschauen
Leseprobe