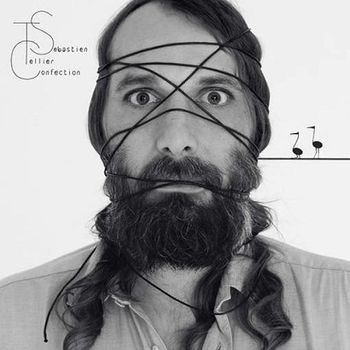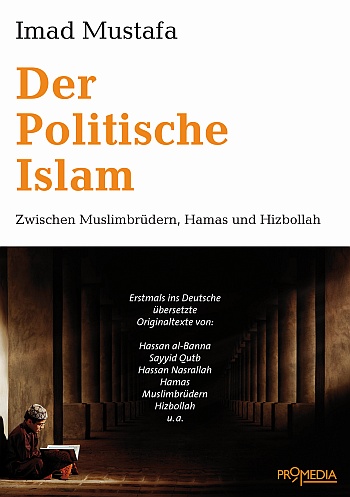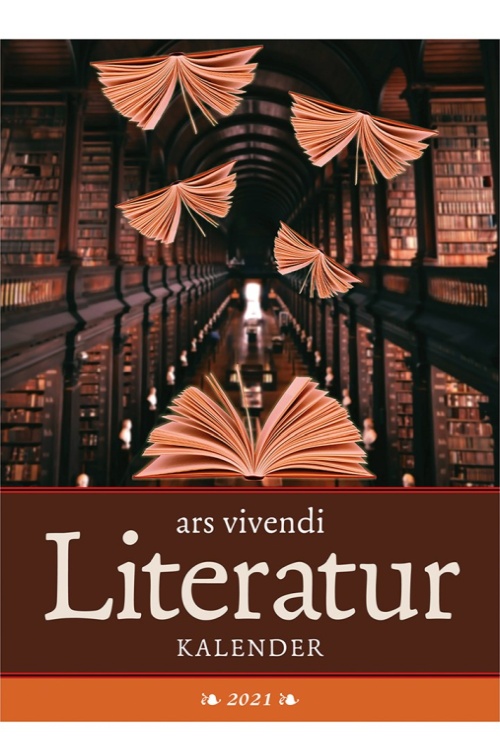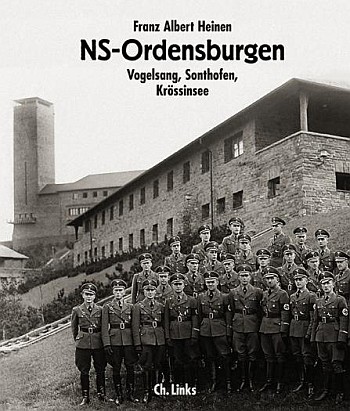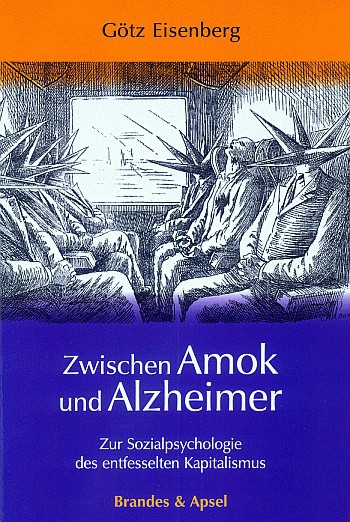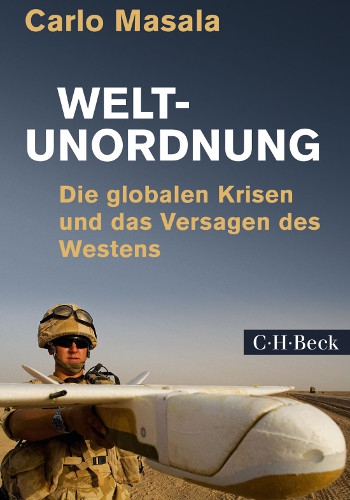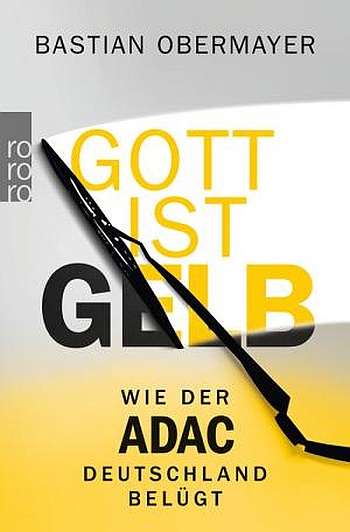Sachbuch | Yang Jisheng: Grabstein
Was geschieht, wenn Menschlichkeit plötzlich keine Rolle mehr spielt? Was trennt den Menschen vom Tier? Was können wir einander antun und warum? Was kann die Gesellschaft dem Individuum antun? Wann verliert ein Staatssystem seine Daseinsberechtigung? Und wie kann es sein, dass sechsunddreißig Millionen Menschen verhungern in einer Zeit ohne Krieg, ohne Naturkatastrophen und bei gefüllten Nahrungsmittelspeichern? VIOLA STOCKER ließ sich von Yang Jishengs Grabstein. Die große chinesische Hungerkatastrophe 1958 – 1962 diese und weitere Fragen erklären.
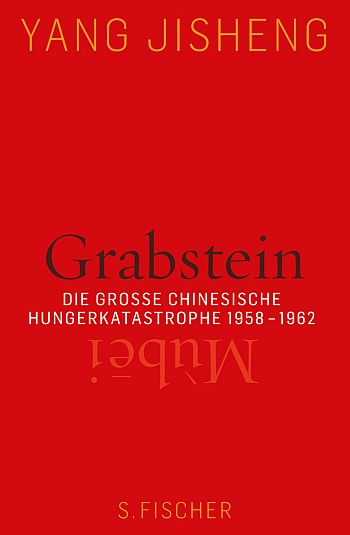
Yang Jisheng verlor seinen Ziehvater. Er verhungerte 1959, als Yang Jisheng in Xishui zur Ausbildung weilte. Yang Jisheng selbst studierte später in Beijing, trat der kommunistischen Partei bei und arbeitete als Journalist für die Xinhua News Agency. Als solcher hatte er als Mitglied der offiziellen Presseagentur Zugang zu Statistiken und Dokumenten der Partei, die der allgemeinen Öffentlichkeit nicht bekannt waren. Das Elend seines Ziehvaters aufzudecken und einer ganzen Generation endlich ein Grabmal zu setzen, nennt er als Grundmotivation seiner Dokumentation.
Gründliche Dokumentation unbegreiflicher Geschehnisse
Die Ereignisse, die den Lesern dargestellt werden, sind im Grunde genommen unaussprechlicher Art. Yang Jisheng bedient sich deshalb einer Taktik. Er listet Statistiken, er zitiert Zeugenaussagen, er benennt Dokumente um letztendlich allen das bewusst zu machen, was in unserem Bewusstsein als zoon politicon nicht vorgesehen ist: dass Menschen sich gegenseitig töten und quälen und zwar nicht in einer Situation existenzieller Drohung wie es in Kriegen geschieht, sondern in Zeiten des Friedens und des Aufschwungs.
Yang Jisheng analysiert akribisch die Situation in vielen Provinzen Chinas. Henan, Gansu, Sichuan oder Anhui, die Schicksale gleichen sich auf grausame Weise. Menschen verhungern, Fälle von Kannibalismus werden von den Behörden unter den Tisch gekehrt, Felder liegen brach und Parteikader sind nicht in der Lage, das Gewicht des Elends zu verstehen. Seine Beschreibungen bewusst zu lesen, verursacht nahezu körperlichen Schmerz. Während der Lektüre stellt sich auf jeder Seite die Frage nach dem Warum.
Erklärungsversuche für das Unerklärbare
Entsprechend begibt sich auch Yang Jisheng auf die Suche nach den Gründen für diese furchtbare Hungerkatastrophe. In den chinesischen Annalen selbst wird das Ausmaß der Hungersnot noch immer verharmlost, es gibt weder stichhaltige Zahlen noch eine gründliche Aufarbeitung der Katastrophe innerhalb des politischen Systems. Vielmehr war sich bis weit in die 90er Jahre die politische Rhetorik einig, dass die Hungertoten Opfer einer Serie von Naturkatastrophen geworden seien.
Dass dem nicht so ist, wird dank Yang Jishengs Analysen schnell deutlich. Weder meteorologische Daten noch Augenzeugenberichte stützen die offizielle Version der Regierung, vielmehr kann Yang Jisheng dank der Augenzeugenberichte und interner Dokumente eine eigene, schlüssigere Argumentationskette aufweisen. Dass er sie als Mitglied der kommunistischen Partei in einem immer noch undemokratischen System überhaupt veröffentlichen durfte, ist durchaus erstaunlich.
Des Pudels Kern: Volkskommunen in einem totalitären System
Es schleicht sich schnell der Verdacht ein, dass Yang Jisheng mit einem System abrechnet, von dem sich die aktuelle politische Elite Chinas längst verabschiedet hat. Akribisch erklärt Yang Jisheng, wie der Aufbau der Volkskommunen in China und die damit einhergehende Kollektivierungswelle die ursprüngliche Organisation der Landwirtschaft auf den Kopf stellte und jahrhundertealte Gefüge aus den Angeln hob. Es wurde nicht mehr gepflanzt und geerntet wie vormals, mit dem Resultat, dass ab 1958 die Ernten verkamen oder verspätet eingebracht wurden, mit wiederum dem Ergebnis, dass die Bauern kaum etwas für den Eigenbedarf übrig hatten, da die staatlichen Ankaufquoten unbedingt erfüllt werden müssen.
Ebenso kontraproduktiv gestaltete sich die Einführung von Gemeinschaftsküchen. Yang Jisheng sieht sie zusammen mit den Volkskommunen als zentrale Elemente eines totalitären Systems. Mao Zedong wünschte sich freie Mahlzeiten für sein Volk, was in der Anfangszeit der Gemeinschaftsküchen zu Prasserei und Misswirtschaft und in der Folge sowohl zu Verknappung der Nahrungsmittel als auch zu willkürlichem Essenentzug als Erziehungsmaßnahme der Kader gegenüber dem Volk führte. Yang Jishengs Darstellung der Geschehnisse in den verschiedenen Provinzen ist verstörend.
Totalitarismus und Größenwahn
Die Wurzel allen Übels aber liegt natürlich im totalitären System Mao Zedongs. Ein politisches System, das sich um einen gottgleichen Führer zentriert, so Yang Jisheng, hat keine Möglichkeit, interne Kontrollmechanismen zu etablieren. Letztendlich wären es aber gerade sie, die Fehlerdetektion im System und entsprechende Korrekturen ermöglichten. So geschah es, dass es eben zu Mao Zedongs Lebenszeit nicht zu Fehlerkorrekturen kam, da Mao keinerlei Kritik an der eigenen Person dulden konnte. Kritiker und Realpolitiker wurden auf Anweisung Maos zurechtgewiesen, gedemütigt und auch aller Ämter enthoben. Die Angst regierte mit im System Maos.
Yang Jisheng hat mit Grabstein ein wichtiges Buch geschrieben. Wir sollten es alle lesen und uns der Grausamkeit, deren wir als Gattung Mensch fähig sein können, sehr wohl bewusst sein. Gleichzeitig darf man nicht vergessen, dass Yang Jisheng als Autor und Journalist eines Systems schreibt, das derzeit auf dem Weg zu einer Weltmacht ist, einer Position, die in den letzten zwanzig Jahren Demokratien vorbehalten waren. Man kann nur hoffen, dass die atemberaubende und schockierende Offenheit, mit der Yang Jisheng die größte menschliche Katastrophe Chinas im letzten Jahrhundert beschreibt, nicht ohne Echo verhallt. In China ist sein Buch verboten. Immer noch gehen Staat und Justiz nicht zimperlich um mit Systemkritikern und Intellektuellen und auch wenn westliche Wirtschaftssysteme und moderne Technologien längst Fuß in China gefasst haben, ist die Volksrepublik keine Demokratie.
| VIOLA STOCKER
Titelangaben:
Yang Jisheng: Grabstein – Mùbei. Die große chinesische Hungerkatastrophe 1958-1962
Aus dem Chinesischen von Hans Peter Hoffmann
Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag 2012. 800 Seiten. 28 Euro