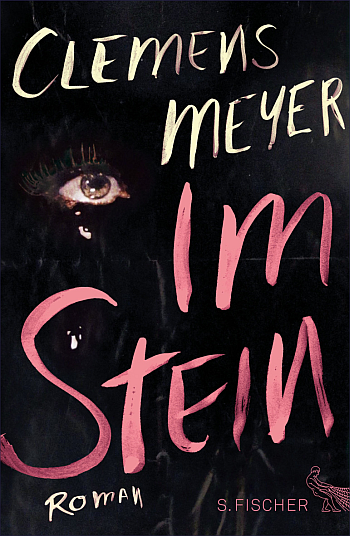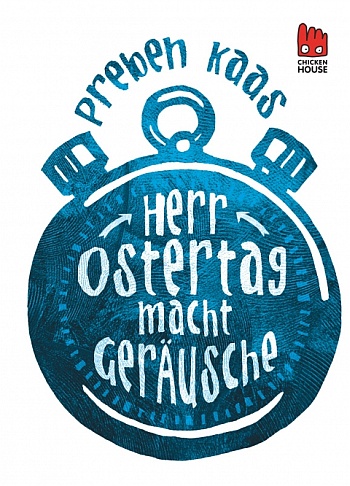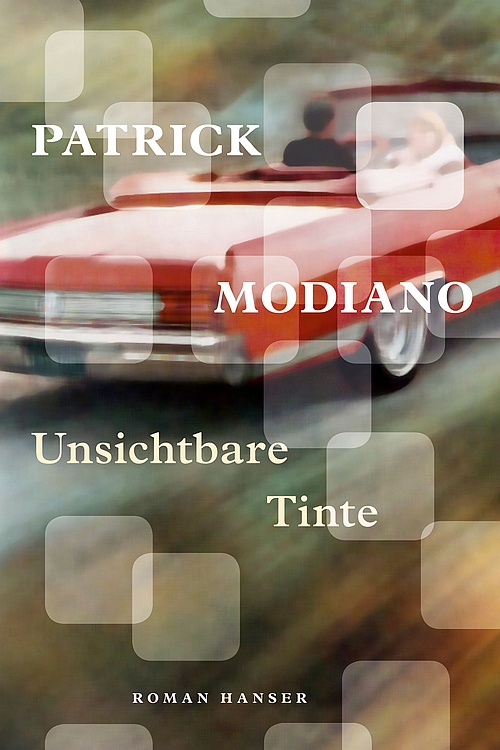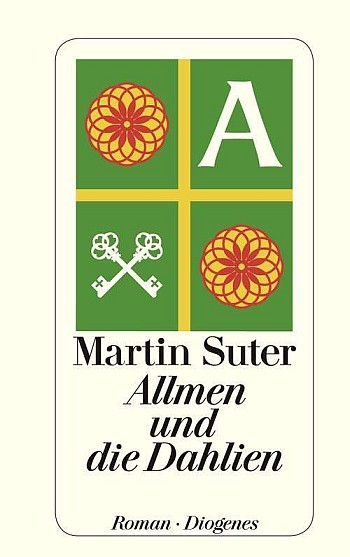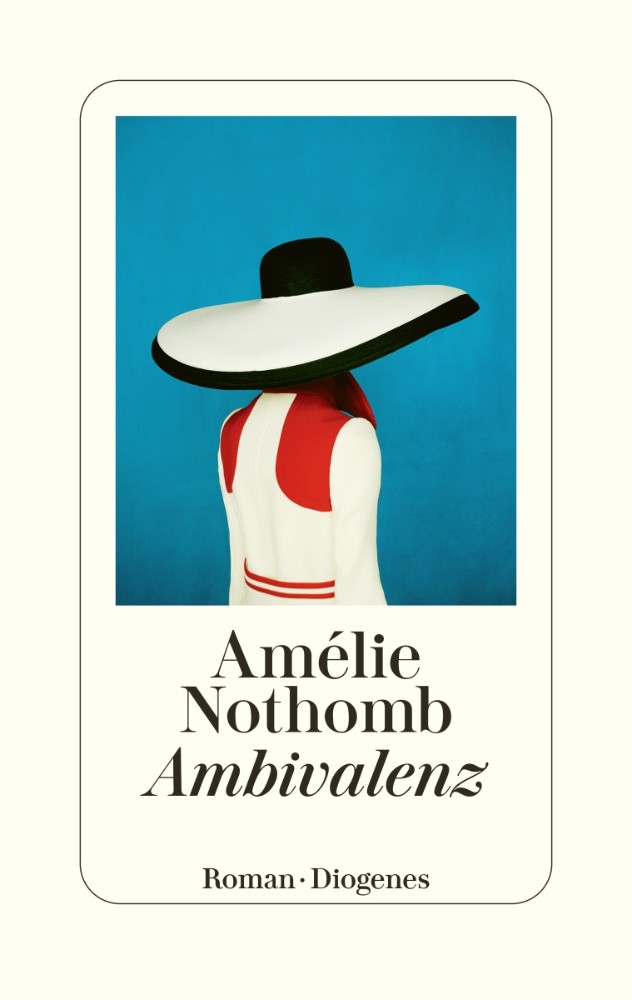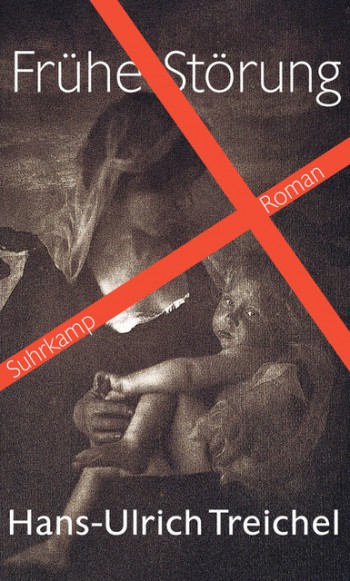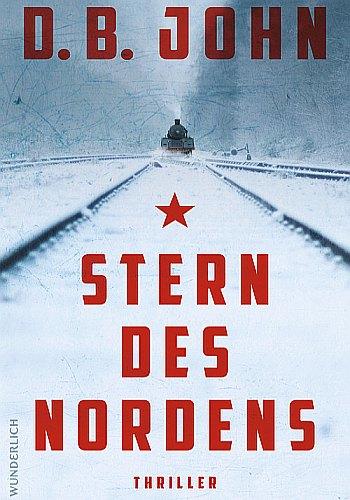Roman | Antonio Callado: Der Tote im See
Ein britischer Abenteurer verschwindet 1925 im brasilianischen Urwald auf der Suche nach einer sagenumwobenen untergegangenen Stadt. Schon bald danach beginnen Militär, Presse und Abenteurer sein Verschwinden zu ergründen, jedoch ohne Erfolg. 1952 macht sich auch der brasilianische Journalist Antonio Callado im Auftrag einer Zeitung auf eine Expedition, um herauszufinden, wie Colonel Fawcett verschwunden ist und wer Der Tote im See wirklich ist. – VIOLA STOCKER lässt sich auf ein Abenteuer ein und entdeckt eine vergessene Kultur.

Callados Werk mutet zunächst wie ein Abenteuerbericht an, so fantastisch wirkt, was er zu sagen hat. Denn Colonel Percy Fawcett ist ein Entdecker, Patriarch und Abenteurer, wie das viktorianische England ihn nicht idealer hätte formen können. 1867 in Torquay geboren, faszinierten ihn stets Geheimnisse und fremde Kulturen. Er war zusammen mit seiner Gattin Mitglied in der theosophischen Gesellschaft und untersuchte als Offizier der britischen Armee im heutigen Sri Lanka an Felswänden alte Inschriften. Allerdings gelang ihm keine bedeutende Entdeckung.
Colonel Fawcett jagte Träumen hinterher, die er in alten Berichten z.B. in der Nationalbibliothek von Rio de Janeiro, gefunden hatte. Schatzsucher schrieben bereits 1753 von einer legendären verlassenen Stadt im Urwald und überlieferten Schriftzeichen aus den Ruinen, die nach Fawcetts Ansichten mit jenen in Sri Lanka identisch waren. 1925 versuchte er bereits zum zweiten Mal zusammen mit seinem Sohn Jack und einem weiteren jungen Mann, die Stadt zu erreichen. Er sollte nicht nach England zurückkehren. Jahre später, im Jahr 1951, wurden am Rio Culuene Knochen ausgegraben, die Fawcett zugeschrieben wurden. Callado reiste für seine Zeitung zusammen mit Fawcetts weiterem Sohn Brian in den Urwald Brasiliens.
Ein Bilderbuchabenteuer – oder Ein Volk ohne Geschichte
Dass jene Expedition erfolglos blieb und auch der Knochenfund nicht Colonel Fawcett zugeordnet werden konnte, bleibt für den Ausgang des Berichts nebensächlich. Antonio Callado schreibt weit mehr als eine Reportage über einen ermordeten Abenteurer. Früh wird deutlich, dass die Expedition ein ganz anderes Ziel hat, nämlich das Herz Brasiliens, den Regenwald, die Identität eines Volkes, das aus Nachkommen von Eroberern und indigenen Brasilianern, die mit der restlichen Kultur nichts zu tun haben, besteht.
Während Callado sich weniger den überlieferten Tatsachen zu Fawcetts Verschwinden widmet als er sich auf die psychologischen Hintergründe für des Colonels Abenteuersucht konzentriert, verdeutlicht sich ihm der Unterschied zwischen Briten und Brasilianern. Die Engländer, so der Journalist, haben ein Reich, ein Empire, aufgebaut. In der Vergangenheit war dies ein Reich von räumlicher und kultureller Größe, doch nach Verlust der imperialen Macht Großbritanniens verlagerte sich diese Größe in den spirituellen Bereich. Die theosophische Gesellschaft hatte reichlich Zulauf zur Jahrhundertwende und die Sucht nach geheimnisvollen Entdeckungen seitens Fawcetts lässt sich laut Callado mit dem Wunsch nach der Errichtung einer geistigen Führerschaft Großbritanniens in Einklang bringen.
Für Callado ist dies nur ein Nebenschauplatz. Denn auf dieser Expedition, die er 1952 beschrieb, lernte er erstmals sein eigenes Volk kennen. Die indigenen Ureinwohner Brasiliens, die für den Patriarchen und Eroberer Fawcett allenfalls Komparsen auf seiner Mission sein konnten, waren für den Journalisten ein Faszinosum. Ihr exotisches Erscheinungsbild, ihr Humor, ihre Kindlichkeit und ihr Stolz beeindruckten ihn ebenso wie das Engagement, das die staatliche Entwicklungsorganisation unter der Führung von Orlando Villas Bôas für die Kalapalos aufbrachte.
Ein Plädoyer für eine gemeinsame Kultur
Callados Reportage gerät schließlich zu einem Werk ganz anderer Art. Der Journalist, der das Verschwinden eines Abenteurers im brasilianischen Urwald erkunden wollte, interessiert sich bald nicht mehr für einen tyrannischen, arroganten Engländer, dem es nie um eine Kultur, sondern immer bloß um ein Abenteuer ging. Vielmehr beginnt er, die Ureinwohner, die Kalapalos zu beobachten, er bewundert die Arbeit der brasilianischen Behörden, die versuchen, ein Volk zu einen, das aus unterschiedlichen Wurzeln besteht.
Ein Vergleich mit dem britischen Imperialismus zeigt, wie wenig sich laut Callado die britischen Eroberer um das Schicksal der unterlegenen Völker scheren. Er zeichnet ein Bild von einer dekadenten, spätviktorianischen Gesellschaft, die nirgends auf der Welt auf britischen Lebensstil verzichten möchte. Orlando Villas Bôas dagegen, und mit ihm die brasilianische Regierung, begegnen den indigenen Brasilianern mit der Neugierde der Forscher und der Geduld eines Bruders. Antonio Callado bemerkt erstaunt, dass die Wohnanlagen der Regierungsangestellten kaum komfortabler als die Indiohütten sind und beginnt nach der Identität seines Volkes zu suchen, das auf einem Gebiet lebt, in dem zwei Lebensformen sich Raum und Zeit teilen, die unterschiedlicher nicht sein könnten.
Ontogenese der Menschheit
Callado sah in den Indios seine eigenen Vorfahren. Er trat ihnen nicht mit unserer heutigen wissenschaftlichen Neugier gegenüber, mit der die Regierungen Reservate einrichten und man versucht, den indigenen Stämmen ihre ursprüngliche Lebensweise zu erhalten. Für Callado wäre ein solches Verhalten ein Negativum gewesen. Er sah in den Kalapalos sich selbst, Bauern, Handwerker, Künstler, die ein entsprechendes Anrecht auf Bildung, Kultur und Wohlstand hatten. Er wünschte sich für seine aufstrebende Nation, dass die unterschiedlichen Völker endlich zusammenwachsen könnten. Die Erzählung vom Toten im See sollte ein Grundstein einer gemeinsamen brasilianischen Kulturgeschichte werden.
| VIOLA STOCKER
Titelangaben:
Antonio Callado: Der Tote im See. Leben und Verschwinden des Colonel Fawcett im brasilianischen Regenwald
Aus dem brasilianischen Portugiesisch von Peter Kultzen
Berlin: Berenberg 2013
120 Seiten. 20.- Euro
Reinschauen
Leseprobe