Interview | Prof. Dr. Stefan Scherer, Geschäftsführer des Instituts für Germanistik am Karlsruhe Institute of Technology (KIT) und Tatort-Experte
Die Germanistik am Karlsruher Institut für Technologie befindet sich im Umbruch. Aufgrund der Vertiefung durch Linguistik und Wissenschaftskommunikation firmiert sie nicht mehr unter »Institut für Literaturwissenschaft«, sondern heißt jetzt »Institut für Germanistik: Literatur, Sprache, Medien«. Populärkultur versus Höhenkammliteratur ist zum Beispiel ein Thema in dem schon länger etablierten Zweig der Medienwissenschaft am KIT. Über den aktuellen Stand der Germanistik und ihre Zukunftsperspektiven an der ehemaligen Technischen Universität, die sich stets mehr der Technik als der Geisteswissenschaft verschrieben hat, sprach Jennifer Warzecha mit Prof. Dr. Stefan Scherer, Germanistikprofessor und Geschäftsführer des Instituts für Germanistik am KIT sowie Tatort-Experte.

Das KIT entstand 2008 aus einem Zusammenschluss des Karlsruher Forschungszentrums und der ehemaligen Universität. Dominierend sind seit eh und je die Ingenieurs- und Naturwissenschaften. Ihre Fakultät ist gegenüber den anderen Fakultäten sehr klein. Im Zeichen mobiler Kommunikation, Internet, Digitalisierung und der Dominanz von Naturwissenschaftsthemen in den Medien gewinnt man zunehmend den Eindruck, dass Geisteswissenschaften lediglich noch technische Phänomene erklären und dadurch in ihrer Wichtigkeit betonen. Verkommen die Geisteswissenschaften zu dienlichen Hilfswissenschaften?
Stefan Scherer: Nein, Geisteswissenschaften sind keine Hilfswissenschaften. Als Ergebnis ihrer Forschung gibt es zwar kein konkretes Produkt, keine sichtbare Dienstleistung. Geisteswissenschaften erbringen aber auch Leistungen für die Gesellschaft. Allerdings produzieren sie solche, die nicht sofort vermarktet werden. Vielmehr adressieren sie eine ganze Kette aus Akteuren, Handlungen und Vorgängen – angefangen von der Schule bis hin zur Öffentlichkeitsarbeit.
Geisteswissenschaften haben im Vergleich zu Ingenieurs- und Naturwissenschaften andere Funktionen. Sie fragen zum Beispiel danach, wie der Kapitalismus funktioniert, wie kulturelle Erzeugnisse zustande kommen und in ihrem jeweiligen System funktionieren. Die Germanistik, speziell die Linguistik, fragt danach, wie ein Satz funktioniert, wie sprachliche Informationen entstehen, übertragen werden und wie ein Text letztendlich seine kommunikativen oder auf emotionalen Wirkungen erzielen kann. Das sind Grundpfeiler dessen, was wir täglich anwenden – unsere Sprache oder Dinge, die wir in unserer Freizeit nutzen wie das Theater. Keiner würde das bis in seine Grundfesten hinein erforschen und ergründen, wenn die Geistes- und Sozialwissenschaften wegbrächen. Aus der beruflichen Perspektive gesehen kommen auch unsere Absolventen im Arbeitsmarkt unter, auch wenn es etwas länger dauert. Wer gut verdienen möchte, sollte aber sowieso nicht gerade Germanistik studieren. Der Vorteil eines solchen Studiums liegt eindeutig darin, dass wir keine Spezialisten, sondern Generalisten ausbilden.
Können Sie sich vorstellen, dass das KIT Ihre Fakultät zugunsten des technischen Profils abschaffen könnte?
Nein. Wir haben hier immer wieder Berührungspunkte, die sich verstärkt in unseren Schwerpunktbildungen rund um das Themenfeld »Mensch und Technik« bewegen. Ein Beispiel waren die Forschungen zur »Technikreflexion in Fernsehserien«. Hier habe ich, grob gesprochen, zusammen mit weiteren Wissenschaftlern den Bezug der Literaturwissenschaft, gebündelt in der Erforschung der Frage nach der Serialität, hin zur Realität erforscht: Wie reflektieren also Fernsehserien wie Mad Men die Wirkung neuer Technologien (zum Beispiel das Kopiergerät) im Blick auf Akzeptanz- oder zumindest Resonanzbedingungen, wäre eine dieser Fragen, für die sich dann auch Ingenieure interessieren, weil sie die jeweiligen kulturellen Umstände und Situationen beachten müssen, wenn sie ein Produkt entwickeln, das eben auch ankommen muss. Kulturelle Faktoren des Alltags spielen hier eine ganz entscheidende Rolle.
Apropos Realität: Wie muss man sich denn den typischen Germanisten oder die typische Germanistin vorstellen, sofern es ihn oder sie tatsächlich gibt? Als »verstaubten« Bibliothekar?
Den oder die Germanist/in gibt es tatsächlich nicht. Die Bandbreite des Faches ist groß, angefangen von der Mediävistik bis hin zur Medienkulturwissenschaft. Wir arbeiten in Projekten, die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert werden. Wir arbeiten also gar nicht mehr immer nur in Bibliotheken, sondern zum Beispiel auch als Computerphilologen oder mit riesigen Datenmengen wie 900-Tatort-Filmen, die wir wissenschaftlich, auch datenbankgestützt auswerten.
War das schon einmal anders?
Anfangs bestand der Hauptanteil der Germanisten bzw. Germanistikstudenten aus zukünftigen Lehrern. Hauptaufgabe war die Lehrerausbildung zum Gymnasiallehrer oder zur -lehrerin. Sie hat also das Fach zunächst überhaupt etabliert. In den 1970er Jahren kam die Germanistik als Fach in eine Krise. Zuerst hat man nur Lektoren ausgebildet, dann Journalisten oder Mitarbeiter der Public Relations – dies verstärkt seit den 1980er Jahren. Der Grund liegt in den Facetten, die das Fach bietet. Sie gehen weit über das Verstehen und die Analyse von Texten oder Wörtern, das Literaturverständnis sowie deren Interpretation hinaus. Diese Kompetenzen allein reichen aber dafür aus, dass zum Beispiel (angehende) Journalisten und Mitarbeiter in der Öffentlichkeitsarbeit hier ihre Fähigkeiten ausbauen können. Wir bieten unseren Studenten die Möglichkeit, »Berufsorientierte Zusatzqualifikationen« (BOZ) wie das Schreiben für die Zeitung, die Erstellung von Magazinen etc. zu erwerben. Ich persönlich finde das nur bedingt zielführend, wenn die fachwissenschaftlichen Anteile zu kurz kommen. Wir sind eine wissenschaftliche Einrichtung, wir befassen uns mit Theorie und wissenschaftlichen Aufgabenstellungen. Die Praxis lernt man in dem Fall tatsächlich besser in der Praxis, also in den Betrieben selbst.
Apropos Gegenwart und Zukunft: die Themen Feministische Literaturwissenschaft, Gender, Werke ohne Autor-Ich im Sinne des französischen Poststrukturalismus‘, Publikumsforschung und Rezeptionsästhetik, Literatursoziologie (Buchmarkt und andere Distributionssysteme) – welches davon ist noch einer intensiveren germanistischen Fragestellung wert?
Jedes Thema bzw. jeder methodische Zugang ist auf seine Art mit seiner speziellen Ausrichtung interessant. Bei der empirischen Literaturwissenschaft geht es um die Erforschung des Leseverhaltens, und damit um Prozessorientierung. Die Feministische Literaturwissenschaft erforscht die Literatur aus einem anderen Blickwinkel, dem der Frau. Ausgangspunkt ist da die feministische Bewegung der 1970er Jahre. Generell ist das wie bei jedem Forschungsthema. Man sucht sich eine Sache oder einen Punkt, die oder der noch nicht erforscht ist. Dann stellt man die Forschungsfrage, stellt Hypothesen auf, geht den Forschungsprozess bis hin zum Schluss. Am Ende findet der Forscher die Antwort auf seine Forschungsfrage und beschließt damit sein Erkenntnisinteresse.
Hilft denn die Beschäftigung mit der Mediävistik dabei, ein besseres Verständnis für die deutsche Sprache und Rechtschreibung zu schaffen?
Der Umgang mit der deutschen Sprache generell hilft auf jeden Fall dabei, ein besseres Verständnis dafür zu erhalten, wie die Sprache funktioniert, weil man sich mit ihr beschäftigt und auseinandersetzt. Zugleich entdeckt man als Forscher ältere Kulturzeugnisse der Sprache. Die Forscher nutzen dann ihre analytischen Kompetenzen, um festzustellen, wie die Sprache funktioniert: im historischen Verlauf die Mediävistik, in der Gegenwartssprache die Linguistik.
Ihre Reputation im Wissenschaftsbetrieb hängt ein Stück weit – neben der Qualität – auch von der Anzahl der Publikationen ab, die Sie veröffentlichen. Wie viele sind es bei Ihnen pro Jahr?
Das sind in etwa drei bis vier, je nachdem, ob noch ein Buch dabei ist – da dauert die Veröffentlichung länger. Manchmal sind es vier bis fünf Aufsätze, die ich veröffentliche. Hinzu kommen die Praxis-Projekte in Zusammenarbeit mit den Studenten, wie sie bei der Herstellung eines Fallada-Handbuches stattfindet. Doktoranden veröffentlichen mitunter viel mehr. Oft tun sie das über Zweitverwertungen. Das kommt für mich aus Gewissensgründen nicht infrage.
Immer mehr Menschen lesen Bücher als E-Book oder nutzen zur Recherche oder zum Lesen von Büchern das Internet. Hat sich durch die Digitalisierung von Inhalten etwas an ihrer Qualität verändert, weil sie flüchtiger bzw. kurzfristiger verfügbar sind als gedruckte Werke?
Die Zugriffsmöglichkeiten auf Literatur und ihre Quellen sind besser geworden, die Zugriffe auf Datenbanken sind gestiegen – eben, weil es seit der »Geburt« des Internets einfacher ist, an Literatur zu kommen. Dennoch nutzen die Menschen immer noch wie eh und je gerne Bücher zur Recherche, zumal die materielle Anmutung oder die andere Handhabbarkeit gegenüber Dateien hineinspielt.
Digitale Texte – bedeuten sie einen Verlust der Originalität oder beherbergen sie durch die Möglichkeit, sie auch nach Veröffentlichung noch nachbessern zu können, in Wahrheit eine bessere Korrekturfunktion?
Die Digitalisierung ist einfach eine Entwicklung, die stattfindet. Sie zu bewerten, halte ich für überflüssig! Die Digitalisierung ersetzt aber nicht das Buch. Es ist eine kulturwissenschaftliche Erkenntnis, dass ein neues Medium bisher noch nicht das bestehende andere ausgeschaltet hat. Es wird weiterhin Menschen geben, die das haptische Erlebnis, in einem Buch zu blättern, schätzen werden.
Zum Schluss zur Zukunft der Germanistik: wohin geht es, Computerlinguistik oder Hochsprache?
Literatur wird es immer geben, weil der Reiz ihres Daseins darin liegt, dass Menschen das Erleben der Figuren und deren Handlungen in allen literarischen Formen auch im Sinne der aristotelischen Katharsis nachvollziehen können. Das bietet den Lesern Orientierung in ihrer Lebenswelt und zeigt Perspektiven auf. Utopien und die der Literatur ganz eigene Eigenschaft der Fiktion können Wirklichkeit werden dadurch, dass wir als Leser die Handlung selbst erleben und daraus Handlungsanweisungen für unser Leben entnehmen können.
| Das Interview führte Jennifer Warzecha.
Reinschauen
Lebenslauf, neuere Publikationen und Mitarbeiter sowie Aktuelles auf der Uni-Homepage von Prof. Dr. Stefan Scherer
Publikationsliste von Prof. Dr. Stefan Scherer (pdf)
Tatort-Kritiken auf TITEL kulturmagazin
Buchempfehlung

Stefan Scherer, Simone Finkele: Germanistik studieren. Eine praxisorientierte Einführung
Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2011
152 Seiten. 17,95 Euro




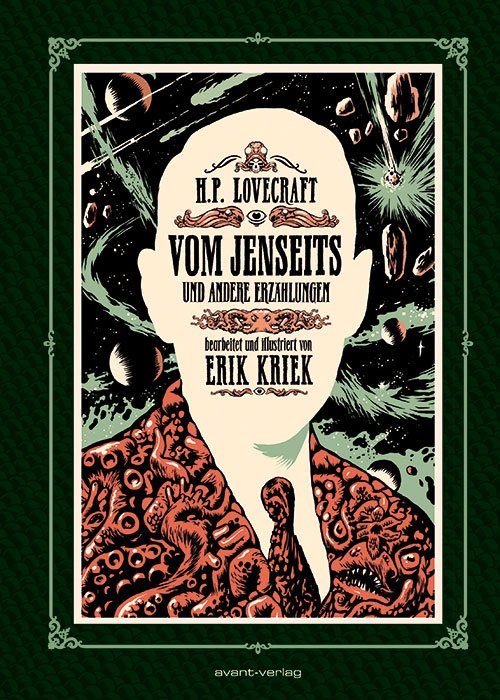
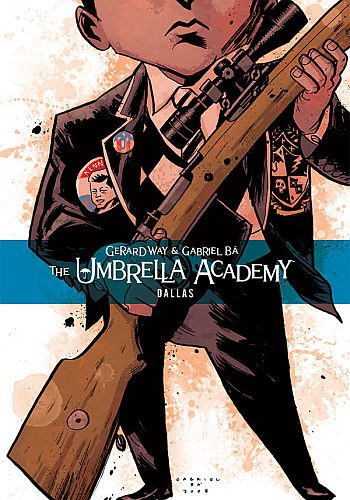

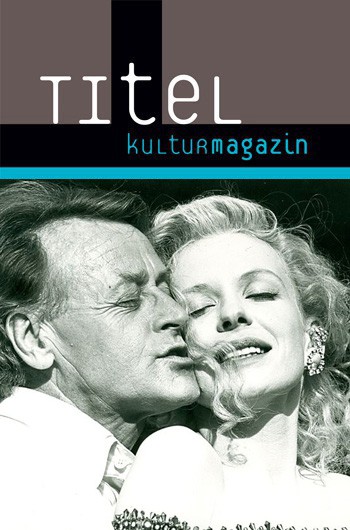
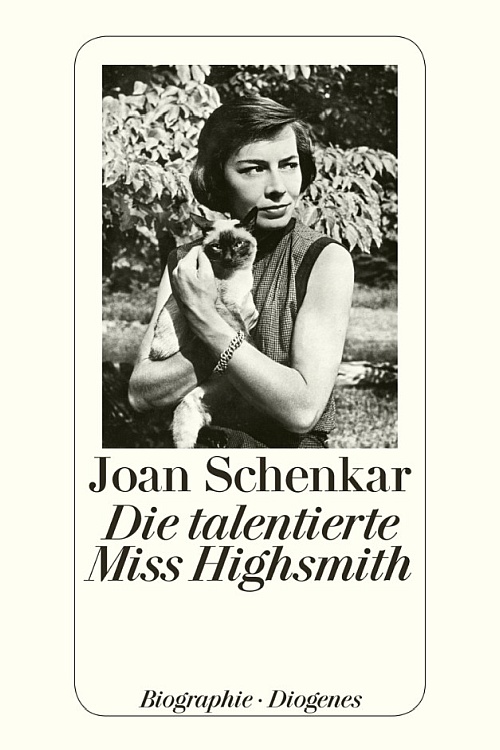


Die Frage nach dem Sinn der Germanistik ist offenbar ein running gag, der immer wieder mal aus der Gruft geholt wird. Die Begründung ihrer Existenz variiert mit dem Genie ihres Vertreters. Da haben wir nun tatsächlich etwas fast Neues (Kanzog hat vor Jahrzehnten schon Filmphilologie in München betrieben): Jetzt werden, man höre und staune, 900 (in Worten: neunhundert) Tatörter philologisch erschlossen – na, wenn das keine existenzsichernd Grundlegung für die Germanisten ist.