Thema | Germany’s Next Topmodel 
JAN FISCHER hat die erste Folge der neuen Staffel Germany’s Next Topmodel mal gründlich auseinandergenommen. In seinem großen, dreiteiligen Essay findet er unter der bunten Candy-Verpackung der Sendung eine saubere Erzählung von der Dunkelheit am Rande der Stadt.
Zum ersten Teil geht es hier.

»Die Boobs stehen in Konkurrenz zum Kopf«
– Wolfgang Joop
Die Kandidatinnen ziehen aus, voller Hoffnung auf den großen Preis – in der ersten Folge sind es 70 von angeblich 15.000, das bedeutet schon was. 25 kommen weiter. Das heißt: 45 Träume davon, zur Heldin zu werden zersplittern schon in der ersten Hälfte der ersten Sendung. Und wie die Träume da zerschellen: Kontrapunktisch inszeniert zur hoppelig-fröhlichen Gleichgültigkeit der Juroren mitten zwischen dem bunten Licht. Das ist ein Sozialdrama, so bitter und dunkel, selbst Dickens hätte Albträume bekommen. Mit der besonderen Pointe natürlich, dass die Träume selbst schon wieder Symptom von gesellschaftlichen und historischen Umständen sind, die sie zuerst produziert haben – die Träume zerschellen an sich selbst, und zwischendrin bleibt nur der schmale Grat eines nicht zu erreichenden Bildes von Perfektion: Die Heldin muss per Definition eine sein, die einzigartig ist. Das ist doch eine wahnsinnige Geschichte: Die Träume der Kandidatinnen, aufgebrochen zu einer Heldenreise, von der sie nicht wissen, wann, wie und als was sie wieder zurückkehren – und dann zerbrechen sie gleich in der ersten Viertelstunde an ihrer selbst gemachten Unmöglichkeit, fallen irgendwo rechts oder links bzw. bei zu dick oder zu dünn oder zu »madamig« oder zu »natürlich« auf dem schmalen Grat eines nicht zu erreichenden Idealbildes einfach so runter. Irre. Böse. Brillant erzählt. Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen, weil er im Gegensatz dazu wenigstens wusste, dass er die Hauptfigur der Geschichte ist.
Döner gegen Drachen
Das Scheitern der Heldinnen an unmöglichen, sogar widersprüchlichen Idealen, inszeniert als zittrig-buntes Sozialdrama – das zieht sich auf hundert Arten durch die Sendung. Beispielsweise in der Figur Heidi, die ja schon Siegerin ist, die also – innerhalb der Erzählung – alles richtig gemacht hat und die Kritik von außen mit in die Erzählung ihres Richtigseins einarbeiten muss (denn in einer Heldengeschichte wäre es unerhört, wenn jemand plötzlich herausfände, dass die Mentorenfigur, die göttliche Mutter, fehlbar ist und schon immer war).
Die Kritikpunkte waren hauptsächlich, dass GNTM jungen Frauen ein ungesundes Körperbild vermittele – und siehe da, Heidi setzt zwei zu dünne Kandidatinnen auf die Straße, isst Mettbrötchen, irgendwas mit Leberwurst Bestrichenes und einen Döner. Der andere Kritikpunkt war, dass sie die Kandidatinnen vernachlässige, zu viel von ihnen fordert. Und siehe da, Heidi fängt sich irgendeine Tropenkrankheit ein, macht trotzdem weiter, und zahlt am Ende den Preis in einem singapurischen Krankenhaus. Außerdem vergibt sie – gütig, wie sie ist – Wolfgang Joop für seine Kritik an ihrer Sendung. Dies, Heldin, sei deine Moral, dein Arbeitsethos und deine Leitlinie für Wohlbefinden.
Dass Heidi zwischendrin ständig isst, ist ein eher spielerisches Motiv, eingefügt, damit die Presse drüber berichten kann. Dass Wolfgang Joop dabei ist, weil Heidi gütig ist – eher eine Randerzählung (die vielleicht noch ausgewalzt wird – das steckt noch erzählerisches Potenzial drin).
Aber diese Sache mit der tropischen Krankheit ist interessant, eigentlich zu gut, um nicht inszeniert zu sein. Zum ersten Mal sehen wir Heidi zerbrechen. Lang und breit wird darüber geredet, ob sie noch die Bilder an die Kandidatinnen verteilen kann, lang und breit auch darüber, dass sie eigentlich unzerstörbar ist. Sie verteilt die Bilder, sie ist nicht unzerstörbar. Nachdem lange, und immer wieder bei GNTM gesagt wurde, man solle alles geben, sich nicht so anstellen, sehen wir in der Vorschau zu zweiten Folge Heidi, wie sie fiebrig im Krankenhausbett liegt und – was völlig verständlich und geradezu unmenschlich menschlich ist – darum bittet, dass die Kamera abgestellt werden möge. Zum ersten Mal, wirklich zu erstem Mal, wird das körperliche Wohlbefinden bei GNTM über die Arbeit gestellt, der Mensch über die Rolle.
Das alles ist eine Erzählung, die auch auf die Kritik an der Sendung verweist, dass die Kandidatinnen in der Sendung überfordert würden. Heidis Krankheit, Joop, das Essen: Dahinter steckt dann die Erzählung einer Frau, die versucht, auf die Bremse zu treten, den Drachen, das Monster, das sich selbst reproduzierende System, das sie geschaffen hat ein wenig zu bändigen. Denn fest steht ja: Man kann, wenn man will, an GNTM eine Menge kritisieren. Nach allem, was die Presse berichtet, haben es weder die Kandidatinnen noch die Gewinnerinnen leicht, es soll eigenartige Knebelverträge geben, schlechte Behandlung. Außerdem, auch daran lässt sich nicht rütteln, beeinflusst GNTM das Körperbild von jungen Frauen. Nicht alle Frauen haben Modelmaße, viele wollen aber, warum auch immer, und ihre Körper geben das einfach nicht her. Sie scheitern genauso, wie die Kandidatinnen im Casting an unmöglichen Idealen. Nur von Zeit zu Zeit noch viel brutaler, und das ist bei weitem das Schlimmste: Allein. Ohne Kamera. Ohne Spiel.
In dieser ganzen Erzählung um Heidi steckt wieder eine böse Geschichte unter der Zuckerwatte: Die Geschichte von Goethes Zauberlehrling, der nicht wusste, wie er anhält, was er losgelassen hat. Nur in viel größerem Maßstab. Viel tragischer. Viel unwirklicher, aber trotzdem wahr.
| JAN FISCHER
Lesen Sie im dritten Teil des Essays wie GNTM mit Idealkörpern umgeht, die doch nicht so ideal sind und wie unprätentiös Alltagsrassismus verhandelt werden kann.
Lesen sie heute abend bei @TITEL_Kulturmag, wie unser Autor Jan Fischer die Sendung ab 20:15 live begleitet.
Reinschauen
Models verhungern für die Modeindustrie
Erster Teil dieses Essays



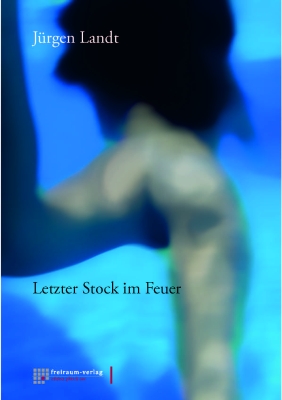





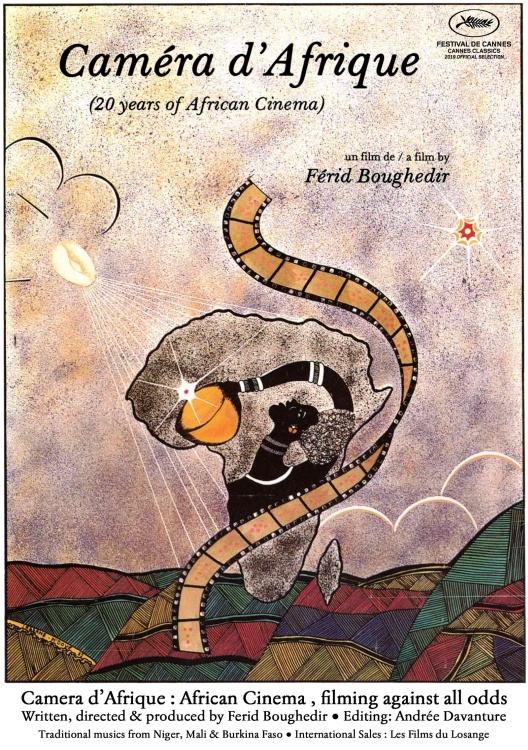
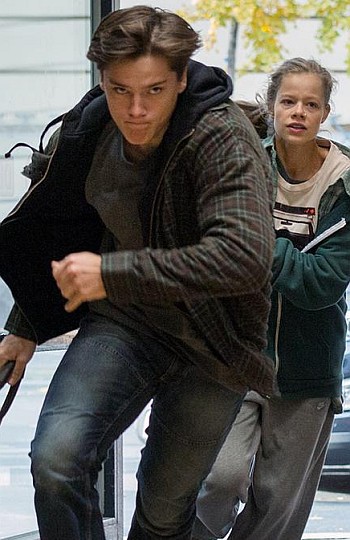
[…] Zum ersten Teil geht es hier. Zum zweiten Teil geht es hier. […]
[…] Sie im nächsten Teil des dreiteiligen Essays: Wie die Kandidatinnen an ihren eigenen Träumen scheitern. Und wie Heidi […]