Menschen | Karl Marlantes: Was es heißt, in den Krieg zu ziehen
Als Karl Marlantes 1968 für die USA in den Vietnamkrieg zieht, hat er die typischen Motive der meisten Soldaten: Er will seine Männlichkeit beweisen, er will raus aus dem Einerlei, sehnt sich nach etwas »Höherem«. Nicht nur mit Tapferkeitsorden kommt er zurück – seine Lebensbilanz »Was es heißt, in den Krieg zu ziehen« sucht nach einem Moralkodex für Kriege. Hochaktueller Stoff für hier und heute, wo es wieder mal nach einem Sieg säbelrasselnder Dummheit riecht. Von PIEKE BIERMANN
 »Das Marine Corps hatte mir das Töten beigebracht – aber nicht, wie mit dem Töten umzugehen war.« Gut 40 Jahre, bevor Karl Marlantes dieses Fazit zieht, war er der Eliteeinheit beigetreten, mit zwanzig, als Collegestudent. Marlantes, Jahrgang 1944, aufgewachsen als Sohn kleiner Leute mit skandinavischen Wurzeln im ländlichen Oregon, ist damals ein tough guy, der im rauflustigsten Sport der Welt glänzt: Football. Die Männer seiner Familie haben im Zweiten Weltkrieg gekämpft und können mit Stolz auch vom Töten und dessen Grauen erzählen, die Frauen lehren ihn mit handfestem Utilitarismus, mit dem Schmerz umzugehen, als selbst Kälbchen Ferdinand, das er liebevoll gepäppelt hat, geschlachtet wird. Er wird auch ein glänzender Yale-Student und sitzt 1968 mit dem allerfeinsten Rhodes-Stipendium im britischen Oxford.
»Das Marine Corps hatte mir das Töten beigebracht – aber nicht, wie mit dem Töten umzugehen war.« Gut 40 Jahre, bevor Karl Marlantes dieses Fazit zieht, war er der Eliteeinheit beigetreten, mit zwanzig, als Collegestudent. Marlantes, Jahrgang 1944, aufgewachsen als Sohn kleiner Leute mit skandinavischen Wurzeln im ländlichen Oregon, ist damals ein tough guy, der im rauflustigsten Sport der Welt glänzt: Football. Die Männer seiner Familie haben im Zweiten Weltkrieg gekämpft und können mit Stolz auch vom Töten und dessen Grauen erzählen, die Frauen lehren ihn mit handfestem Utilitarismus, mit dem Schmerz umzugehen, als selbst Kälbchen Ferdinand, das er liebevoll gepäppelt hat, geschlachtet wird. Er wird auch ein glänzender Yale-Student und sitzt 1968 mit dem allerfeinsten Rhodes-Stipendium im britischen Oxford.
Bespuckt, gemobbt, als babykiller beschimpft
Seit drei Jahren sind die USA in Vietnam massiv militärisch aktiv und hallt die westliche Welt wider von ebenso massivem Widerstand gegen diesen Krieg. Junge Amerikaner verbrennen ihre Einberufungsbescheide oder flüchten nach Kanada. Marlantes meldet sich zum Kriegsdienst. Warum? Aus einer »sehr gegensätzlichen Mischung aus Patriotismus, Sehnsucht nach Überhöhung und Flucht aus dem Einerlei, dem Bedürfnis, meine Männlichkeit zu beweisen, Selbsterprobung und Neugier«, resümiert er.
Ab Oktober 1968 führt er einen Zug von 40 Marines, blutjung wie er. Ein Jahr später kommt er zurück mit dem Verwundetenabzeichen Purple Heart und zwölf Tapferkeitsorden vom Feinsten. Ein hero, aber in einem Krieg, der für viele Landsleute überhaupt nicht fein ist. Er wird bespuckt, gemobbt, als babykiller beschimpft. Er schweigt, studiert zu Ende, beginnt eine Karriere.
Wie »unfein« der Vietnamkrieg war, weiß er nur zu gut: von innen. Er hat das nackte Grauen selbst erlebt – und anderen bereitet. Jahre später holt es ihn ein. Flashbacks, Alpträume, Gewaltausbrüche. Die Posttraumatische Belastungsstörung zerstört seine Ehe. Mit Stolz erzählen kann er nichts, erzählen tut er trotzdem, 30 Jahre lang, in der einzigen Form, in der er seine Wahrheit verarbeiten kann: fiktionalisiert zum Roman »Matterhorn«.
Vorschläge für eine veritable Revolution des Militärs
»Was es heißt, in den Krieg zu ziehen« ist sein zweites Buch, eine Mischung aus Autobiographie und radikaler Reflexion über den Krieg, also über Leben, Tod, Menschsein. Er ist kein Pazifist, für ihn wird es Krieg und also Krieger geben, solange die Welt nicht nur von guten Menschen bewohnt wird. Aber es gibt für ihn sehr wohl so etwas wie anständige Kriege(r), argumentiert er, geprägt von dem, was seine Vorfahren ihm unter dem Eindruck des Zweiten Weltkriegs beigebracht haben. Und dafür braucht es einen Moralkodex, kurz zusammengefasst: Gewalt ist nur ethisch zu rechtfertigen, wenn sie defensiv ist und bleibt. Jeder Angriffskrieg, zum Beispiel die angeblich »präventive« Irak-Invasion, ist so moralisch wie ein Lynchmob.
Marlantes entwickelt konkrete Vorschläge, wie aus dem Moralkodex Praxis werden kann – sie reichen von der Kindererziehung über eine veritable Revolution des Militärs bis einer neuen »Kriegsmythologie«. Für deutsche Leser mit der europäischen Aufklärung im Gepäck mag das oft auftauchende (und nicht immer korrekt eingedeutschte) Wort »spirituell« nach Esoterik klingen. Marlantes ist kein Esoteriker, sondern einer, der sensibel und aus Erfahrung über Krieg nachdenkt. Leider ist Marlantes‘ zweites Buch in unnötig zähes Deutsch übersetzt, schlecht lektoriert und enthält ärgerliche Fehler – im krassen Gegensatz zu »Matterhorn«, dem man in jeder Zeile anmerkt, dass sich der Übersetzer auch mit Militärischem auskennt. Trotzdem sollte es auch hierzulande gelesen werden: nicht nur von Soldaten und deren Kriegsherren. Wie wär’s denn zum Beispiel mit einer gut lektorierten Taschenbuchausgabe, von mir aus gesponsert vom Verteidigungsministerium. Gern auch mit einem Vorwort der neuen »Mutter der Kompagnie«, statt Drohnen.
| PIEKE BIERMANN
Eine erste Version der Rezension wurde am 7. Juli 2013 bei Deutschlandradio Kultur veröffentlicht.
Titelangaben
Karl Marlantes: Was es heißt, in den Krieg zu ziehen
(What It Is Like to Go to War, 2011)
Aus dem Amerikanischen von Werner Löcher-Lawrence
Zürich: Arche 2013
319 Seiten. 19,95 Euro
Karl Marlantes: Matterhorn
(Matterhorn: A novel of the Vietnam War, 2010)
Aus dem Amerikanischen von Nikolaus Stingl
Zürich: Arche 2012
672 Seiten. 24,95 Euro



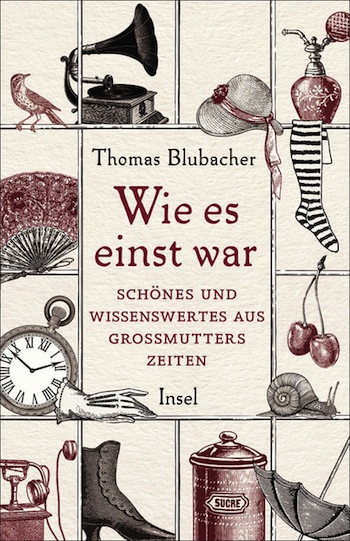



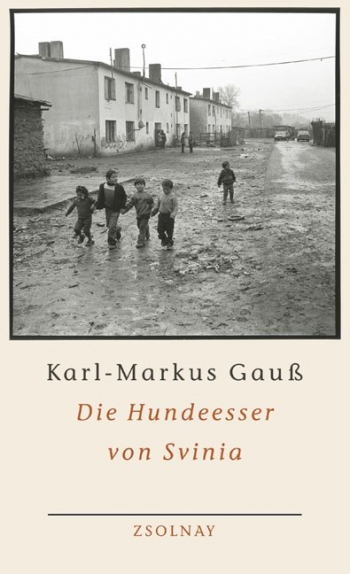
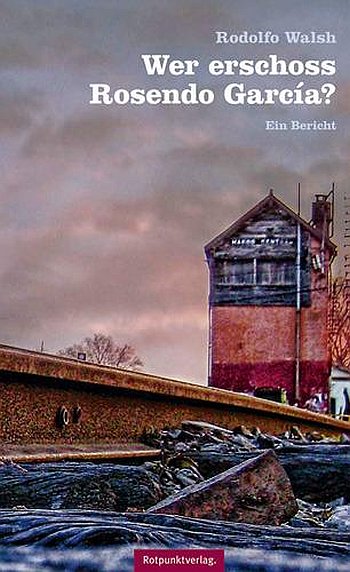

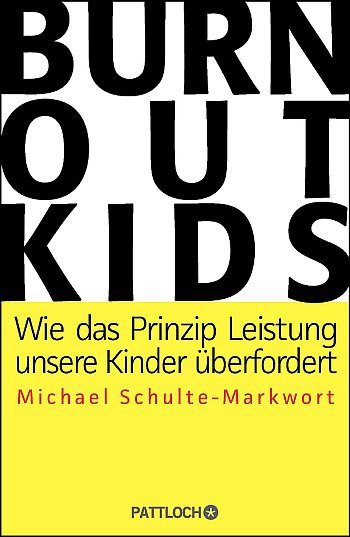
[…] | Homepage Sabine Würich | Nacktes Grauen selbst erlebt – Pieke Biermann zu Karl Marlantes: Was es heißt, in den Krieg zu ziehen | »Krieg ist immer schlimmer, als ich beschreiben kann« – Pieke Biermann zu Martha Gellhorn: […]