Kulturbuch | Felix Wemheuer: Linke und Gewalt
Gewaltdiskussion? Hat das nicht so’n Bart? Die Welt steckt voller Gewalttätigkeit. »Der reißende Strom wird gewalttätig genannt / Aber das Flußbett, das ihn einengt / Nennt keiner gewalttätig.« (Bertolt Brecht). Ist damit alles gesagt? Nicht? »Nichts auf Erden ist so weich und schwach / Wie das Wasser. / Dennoch im Angriff auf das Feste und Starke / Wird es durch nichts besiegt.« (Lao-tse) Auch nicht? Hm. Von WOLF SENFF
 Hat sich was mit Gewalt, und, Sie merken bereits, es sträubt sich einiges dagegen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Mit wem diskutiert eine Drohne, und wer Gewalt ausüben will, müsse sich, so Felix Wemheuer, fragen: »Kann man überhaupt verhindern, dass man seinen Gegnern immer ähnlicher wird?« Doch er spricht auch vom »Kampf für eine andere Gesellschaft«, und niemand, dessen Augen wach genug sind, die heutigen desolaten Zustände wahrzunehmen, dürfte dieses politische Ziel ablehnen. Es muss sich Grundlegendes ändern. Schwierig ist’s allemal.
Hat sich was mit Gewalt, und, Sie merken bereits, es sträubt sich einiges dagegen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Mit wem diskutiert eine Drohne, und wer Gewalt ausüben will, müsse sich, so Felix Wemheuer, fragen: »Kann man überhaupt verhindern, dass man seinen Gegnern immer ähnlicher wird?« Doch er spricht auch vom »Kampf für eine andere Gesellschaft«, und niemand, dessen Augen wach genug sind, die heutigen desolaten Zustände wahrzunehmen, dürfte dieses politische Ziel ablehnen. Es muss sich Grundlegendes ändern. Schwierig ist’s allemal.
»Zerstörung der Munition und Rüstungsindustrie«
Wemheuer versammelt in diesem Band Texte von achtzehn Autorinnen und Autoren, die sämtlich im Gefängnis saßen oder aus ihrer Heimat fliehen mussten. Erich Mühsam, Gustav Landauer, Rosa Luxemburg, Leo Trotzki, Martin Luther King wurden von ihren politischen Gegnern ermordet. Gewalt? Wer war zuerst da? Die Henne? Das Ei? Dass der Klügere nachgibt, ist unter diesen Verhältnissen leider gänzlich aus dem Blick geraten. Es scheint, als gäbe es den Klügeren nicht mehr.
Die Texte sind repräsentativ ausgewählt, wir finden einen Text aus dem Jahr 1921, der zur »Zerstörung der Munition und Rüstungsindustrie« aufruft und fragen spontan, ob das eine moralisch zu verurteilende Gewalttat wäre. Gibt es heutzutage gar niemanden, der das fordert? Es wäre nötiger denn je.
Koloniale Befreiung, Rassismus, Stadtguerilla
Den ersten Texten geht es um Partisanenkriege und um die Frage des Widerstands unter fremder militärischer Besatzung (Mao Zedong, Regis Debray), es geht um die Effizienz von Attentaten, um den »Tyrannenmord« (Wera Figner, Rosa Luxemburg, Leo Trotzki). Die Eskalation von Gewalt nach der Oktoberrevolution wird von Karl Kautsky und Leo Trotzki kontrovers erklärt und kontrovers beurteilt, es ist weißgott nicht so, dass man von einer politisch einseitigen Textauswahl reden könnte.
Texte von Frantz Fanon, Martin Luther King und Eldridge Cleaver setzen sich mit Gewalt im Zusammenhang kolonialer Befreiung und Rassismus auseinander, und der Band enthält kontroverse Texte zum Thema Stadtguerilla, u. a. einen Text der RAF von 1971 und eine Entgegnung Oskar Negts.
Klar konzipierte Textauswahl
Felix Wemheuer legt mit diesem Band eine breit gefächerte Auswahl vor, die Texte sind spannend und zeigen die markanten Strategien der Täter und der Opfer, besser vielleicht: der Herrscher und der Unterdrückten in den »revolutionären Zyklen des zwanzigsten Jahrhunderts«, wie Wemheuer einleitend darstellt.
Eine Textauswahl ist diesbezüglich nicht leicht, sie folgte dem Prinzip der engen Verknüpfung mit politischem Geschehen, sonst hätte man sich vielleicht einen Text von Pierre Proudhon gewünscht, der mit Bakunin zusammenarbeitete und von Karl Marx sehr geschätzt wurde, oder von Georges Sorel, der im beginnenden zwanzigsten Jahrhundert die direkte Aktion und den Generalstreik für wesentliche Mittel des politischen Kampfes hielt. Die Auswahl wird nicht leichtgefallen sein, aber dieser Band hat ein klares Konzept und bleibt überschaubar.
Titelangaben
Felix Wemheuer (Hg.): Linke und Gewalt. Pazifismus, Tyrannenmord, Befreiungskampf
Wien: Promedia 2014
176 Seiten. 12,90 Euro



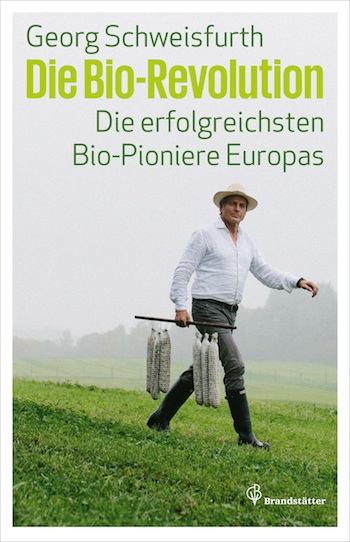
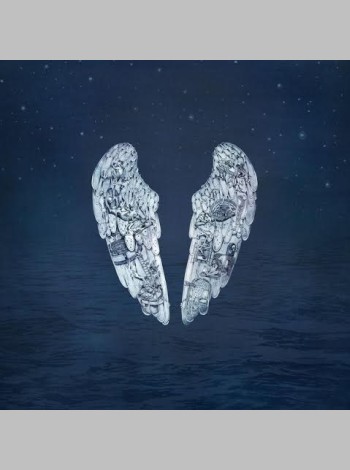
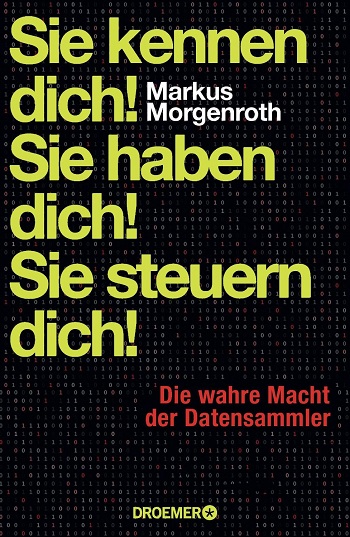

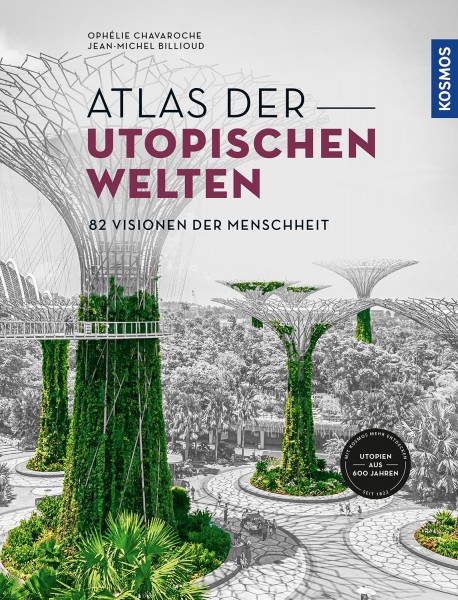

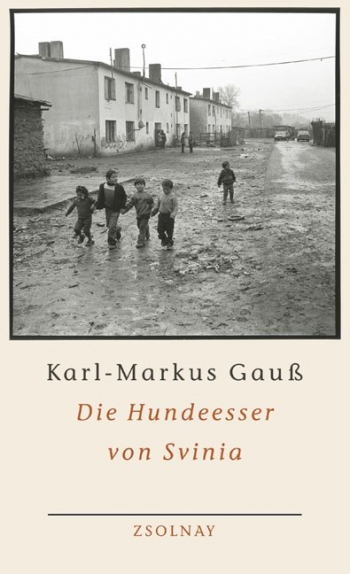

Klingt interessant, werde ich kaufen