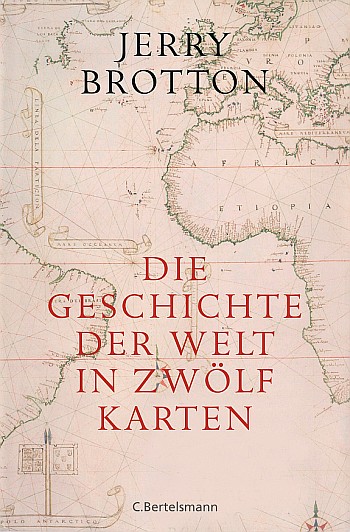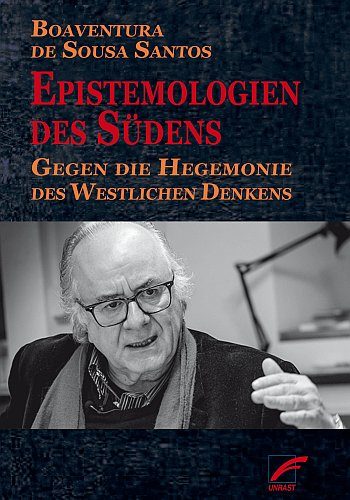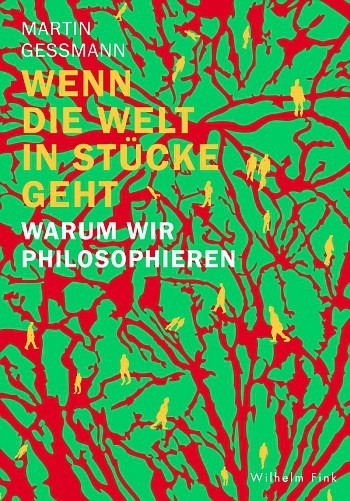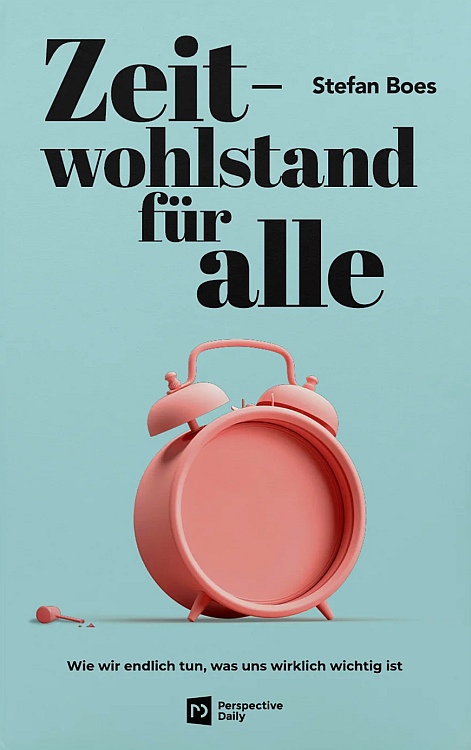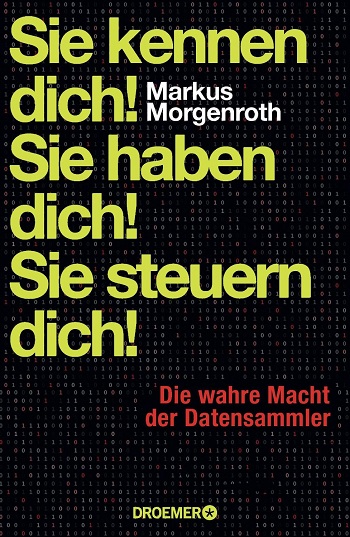Gesellschaft | Klaus Hillenbrand: Fremde im neuen Land. Deutsche Juden in Palästina und ihr Blick auf Deutschland nach 1945
Reportagen aus Deutschland nach der Katastrophe des Nationalsozialismus sind nicht allzu selten. Die Berichte, die der Journalist und Zeithistoriker Klaus Hillenbrand in Fremde im neuen Land vorstellt, bieten allerdings höchst ungewöhnliche Durchblicke. Denn sie sind geschrieben von deutschen und deutschsprachigen Juden, die oft nur wenige Jahre zuvor aus ihrer alten Heimat verjagt worden waren. Von PETER BLASTENBREI
 Alle hier präsentierten Texte stammen aus einer deutschsprachigen Zeitung, die sich lange Zeit bescheiden Mitteilungsblatt nannte. Dieses Mitteilungsblatt gehörte einem anfangs kleinen Verein, der 1932 in Tel Aviv gegründeten Hitachdut Olej Germania, der Vereinigung der Einwanderer aus Deutschland. Wie zu erwarten gewann die Hitachdut ab 1933 immer größere Bedeutung als Auffangstelle für deutschsprachige jüdische Flüchtlinge aus ganz Mitteleuropa – wenn auch weniger für Emigranten aus Deutschland selbst, von denen bis 1941 nur 55.000 den Weg nach Palästina fanden. Folgerichtig benannte sich der Verein in diesem Jahr in Irgun Olej Merkaz Europa um, Organisation der Einwanderer aus Mitteleuropa.
Alle hier präsentierten Texte stammen aus einer deutschsprachigen Zeitung, die sich lange Zeit bescheiden Mitteilungsblatt nannte. Dieses Mitteilungsblatt gehörte einem anfangs kleinen Verein, der 1932 in Tel Aviv gegründeten Hitachdut Olej Germania, der Vereinigung der Einwanderer aus Deutschland. Wie zu erwarten gewann die Hitachdut ab 1933 immer größere Bedeutung als Auffangstelle für deutschsprachige jüdische Flüchtlinge aus ganz Mitteleuropa – wenn auch weniger für Emigranten aus Deutschland selbst, von denen bis 1941 nur 55.000 den Weg nach Palästina fanden. Folgerichtig benannte sich der Verein in diesem Jahr in Irgun Olej Merkaz Europa um, Organisation der Einwanderer aus Mitteleuropa.
Hier muss nun ein kleines Missverständnis korrigiert werden: Deutsche Einwanderer integrierten sich notorisch schlecht in der jüdischen Gesellschaft Palästinas und Israels. Meist großstädtischer Herkunft und aus bürgerlichen Berufen kommend, für die man vorerst kaum Verwendung hatte, litten sie unter der Hitze, galten als überkorrekt und pedantisch und taten sich entsetzlich schwer mit der neuen Sprache. Noch um 1980 konnte man in Tel Aviv älteren deutschen Einwanderern begegnen, die froh waren, im Gespräch von Ivrit oder Englisch zu Deutsch wechseln zu können. Darauf bezieht sich der Haupttitel, aber man muss das nicht wissen, um die gebotenen Texte zu verstehen.
Juden in Deutschland nach 1945
Denn die zehn Autoren des Mitteilungsblattes, die in Hillenbrands Buch zu Wort kommen, waren alles andere als die soeben skizzierten typischen »Jeckes« – so der herabsetzende Spitzname für deutsche Juden – sondern hervorragend integrierte, fließend hebräisch sprechende und schreibende Neubürger. Einige von ihnen gehörten zur Prominenz des frühen Israel wie Gershom (Gerhard) Sholem (1897-1982), ein Jugendfreund Walter Benjamins und bedeutender Erforscher der Kabbala, oder Robert Weltsch (1891-1982), der langjährige Chefredakteur (1919-1938) der ›Jüdischen Rundschau‹ in Berlin, der größten zionistischen Wochenzeitung Deutschlands dieser Jahre.
Auch Herbert Friedenthal (1909-2003), nach 1945 besser bekannt als Herbert Freeden, dürfte vielen noch als Nahost-Korrespondent der ›Frankfurter Rundschau‹ und anderer großer deutscher Zeitungen in Erinnerung sein. Aber auch einige der weniger bekannten Autoren waren hochkarätige Journalisten und Politiker. Allein vier (Max Kreutzberger, Georg Landauer, Max Nussbaum, Hans Tramer) waren Aktivisten der Alijah Chadasha (Neue Einwanderung).
Diese 1942-1948 bestehende, vor allem bei deutschen Juden beliebte politische Partei verstand sich als zionistisch, trat aber für einen binationalen Staat und gegen eine separate israelische Staatsgründung ein. Damals anscheinend eine hoffnungslos verblasene Utopie, wird der Gedanke heute wieder aktueller, je mehr sich die offizielle israelische Staatsideologie als blutige Sackgasse erweist.
Begegnungen
Der österreichische Journalist Arthur Rosenberg (1887-1969) schließlich war offenbar kein Zionist, Palästina/Israel scheint er nie besucht zu haben. Nach seiner Flucht aus Deutschland lag sein ständiger Wohnsitz in Paris. Hier wurde er als Vertrauensmann General De Gaulles und der algerischen Nationalistenführer ab 1958 zur Schlüsselfigur früher französisch-algerischer Geheimkontakte, die schließlich 1962 zum Frieden von Évian führten. Sein Bericht aus dem Saarland 1947 (Text 13) stößt präzise bis zu den überlebenden Resten der Nazigesinnung vor.
Am meisten unter die Haut gehen wohl die Berichte von Hans Lichtwitz (1906-1990) – von ihm stammen daher zurecht die meisten Texte (sechs von insgesamt 21). Als Offizier der Jewish Brigade, einer britischen Freiwilligeneinheit aus palästinensischen Juden, begegnete er schon 1944 in Norditalien denjenigen wieder, die ihn 1939 aus Europa vertrieben hatten. Der Hass auf die Mörder ist bei Lichtwitz und seinen Männern lebendig spürbar, besonders bei Begegnungen mit SS-Männern. In den Wochen nach der Kapitulation leisteten die Soldaten der Brigade dann im Süden Österreichs unmittelbar praktische Hilfe für überlebende Juden – von diesen fast wie Wunderwesen angestaunt, angstfreie, gut ernährte und bewaffnete Juden aus Übersee.
»Für wen?«
Der zeitliche Rahmen der Texte umspannt die Zeit von Januar 1944 bis Oktober 1950. Das Interesse der Autoren richtete sich auf zwei große Themen, den Zustand Deutschlands und die Reste des deutschen Judentums.
Was Deutschland und die Deutschen betrifft, herrscht in den Berichten ein halb erstauntes Desinteresse vor. Berlin, München, Frankfurt am Main, Köln – man hatte diese Städte ja gekannt, man hatte dort gelebt, sie vielleicht sogar geliebt. Und was war nun von ihnen übrig: Trümmerhaufen, in denen sich ein reduziertes armseliges Hungerleben festklammerte. Doch musste man sich Gedanken machen um die mörderischen Herrenmenschen von gestern, die doch anscheinend so exemplarisch bestraft worden waren? Denn über allem schwebte die oft unausgesprochene Frage: Können solche Elendsgestalten doch noch einmal gefährlich werden?
Das Schicksal der Juden in Deutschland weckte bei den Autoren wärmere Sympathien. Hier spürt man viel beherrschte Trauer, wenn Berichterstatter früher blühende jüdische Gemeinden besuchten, von denen oft buchstäblich nur der alte Friedhof übrig war. Dringende Fragen werden gestellt, nach der Versorgung der Überlebenden, deutschen Juden und jüdischen Displaced Persons aus dem Osten, Entschädigungen, ersten Gedenkorten. Dass in Deutschland normales jüdisches Leben je wieder möglich sein könnte, hat keiner der Reisenden geglaubt. Alles deutete auf Aussterben der Alten, Auswanderung, Abwicklung. Quasi stellvertretend für alle fragte Hans Tramer 1950 angesichts der Restaurierung der Frankfurter Westendsynagoge (Text 20): »Für wen ?«
Dem Autor ist eine überzeugende Auswahl gelungen, in der sich Autoren der verschiedensten Temperamente und Überzeugungen wiederfinden. Seine Einleitungen und Kommentare sind gründlich und kenntnisreich, Biografien der manchmal kaum noch bekannten Autoren ergänzen die Texte.
Titelangaben
Klaus Hillenbrand: Fremde im neuen Land
Deutsche Juden in Palästina und ihr Blick auf Deutschland nach 1945
Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag 2015
Gebunden, 415 Seiten, 24,99 Euro
Erwerben Sie dieses Buch bei Osiander
Reinschauen
| Leseprobe