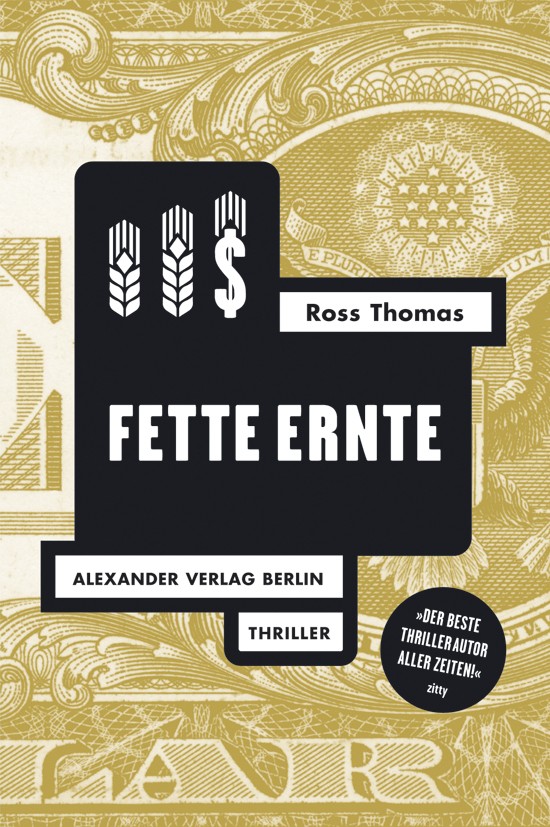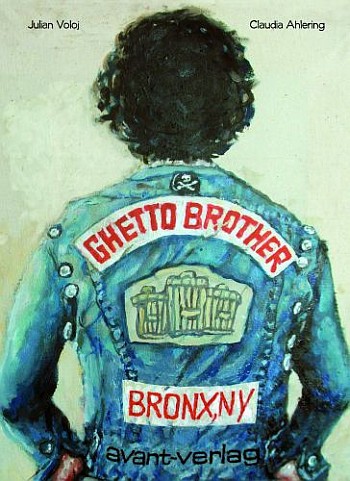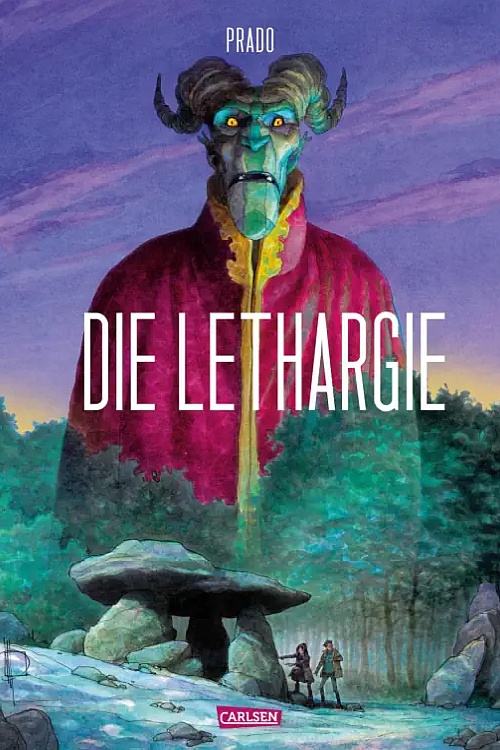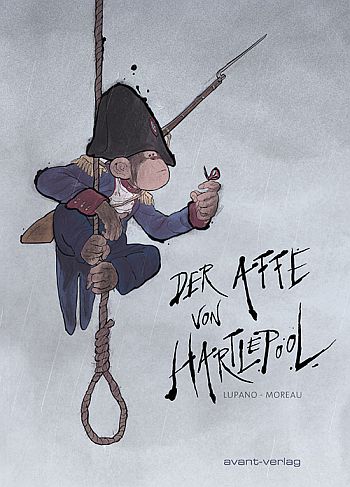Comic | Der Process nach Franz Kafka/Das Schloss nach Franz Kafka
Ob ein klassischer, längst verstorbener Dichter in der Popkultur angekommen ist, lässt sich auch daran ablesen, ob er im Comic rezipiert wurde. Wer sich dort einer zunehmenden Beliebtheit erfreut, ist der jüdisch-böhmische Schriftsteller Franz Kafka. Schon seit einiger Zeit veröffentlichen Texter und Zeichner im Knesebeck Verlag Comics über Kafka oder machen aus seinen Werken Comics. So gab es in den letzten Jahren etwa Comics zu den Erzählungen ›In der Strafkolonie‹ und ›Die Verwandlung‹. Doch vor Kurzem machten sich auch Künstler an zwei seiner Romane: ›Der Process‹ und ›Das Schloss‹ liegen jetzt auch als Comic vor. PHILIP J. DINGELDEY hat sich beide Graphic Novels angesehen.
Wie kann es gelingen, einen guten Kafka-Comic zu kreieren? Das ist nicht ganz einfach. Die meisten Texte von Kafka, inklusive seiner Romane, sind nicht nur expressionistisch bis surreal – das ließe sich ja leicht illustrieren -, nein, sondern häufig auch abstrakt, vieldeutig und ungenau. Eben dadurch sind seine rätselhaften Texte so vielschichtig, geheimnisvoll, komplex und ergo auch schwierig zu interpretieren. Unnötig zu erwähnen, dass da eine Illustrierung und comic-gemäße Zusammenfassung nicht einfach zu realisieren ist.
Der Process
 David Zane Mairowitz hat für die Comicadaption von ›Der Process‹ die Texte verfasst und Chantal Montellier hat gezeichnet. In Roman und Comic wird der Protagonist Joseph K. an seinem 30. Geburtstag verhaftet und ihm wird ein Prozess gemacht. Es wird ihm aber nie gesagt, was konkret Gegenstand des Verfahrens ist, und er bekommt nie wirklich Einblick in den Fortgang des Prozesses. Er wird zermahlen zwischen einem hochkomplexen Bürokratiemonster, das aus albtraumhaften Hinterzimmern, Dachböden, verschachtelten Gängen, rätselhaften Aussagen, Voreingenommenheit, erotischer Verführung und abstrakten und paradoxen Andeutungen besteht.
David Zane Mairowitz hat für die Comicadaption von ›Der Process‹ die Texte verfasst und Chantal Montellier hat gezeichnet. In Roman und Comic wird der Protagonist Joseph K. an seinem 30. Geburtstag verhaftet und ihm wird ein Prozess gemacht. Es wird ihm aber nie gesagt, was konkret Gegenstand des Verfahrens ist, und er bekommt nie wirklich Einblick in den Fortgang des Prozesses. Er wird zermahlen zwischen einem hochkomplexen Bürokratiemonster, das aus albtraumhaften Hinterzimmern, Dachböden, verschachtelten Gängen, rätselhaften Aussagen, Voreingenommenheit, erotischer Verführung und abstrakten und paradoxen Andeutungen besteht.
Montellier hat die Graphic Novel sehr surreal, fließend und filigran gezeichnet.
Zwischen den sehr realistischen Zeichnungen fließen immer wieder die Motive eines grotesk lachenden und scherzenden Skelettes mit Kerze und Messer in den Händen sowie einer Uhr mit in die Bilder ein. Und surreale Bilder, die eine nackte Frau, die aus einem Skelett erwächst, die eine Kerze in der Hand trägt und aus deren Hut wiederum eine Uhr schlüpft, unterstreichen auch teils das Absurde an der ganzen Handlung – fast noch besser als die Zeichnungen der verschachtelten und heruntergekommenen Gebäude und Räume, durch die K. gehen muss, um erfolglos seinen Prozess zu beeinflussen. Dadurch wird das Paradoxe, das Deterministische und Resignative klar demonstriert.
Auch andere Motive wie Phallussymbole am Bildrand untermalen die sexuelle Konnotation, wenn etwa K. diverse Frauen zu benutzen versucht. Dadurch ergeben sich aber auch einige Probleme, die die Handlung zu sehr fixieren: K. ist hier der Gestalt des Franz Kafka selbst nachempfunden, die Handlung wird auf die autobiografische Interpretation limitiert. Auch spielt hier die Handlung in Prag und K. arbeitet bei der ›Kommerzbank für das Königreich Böhmen‹ – geografisch wird der Roman nie so konkret. Durch die detaillierte, feine Zeichnung blieb Montellier aber kaum etwas anderes übrig, als auch hier sehr konkret vorzugehen und leider einiges von der Unbestimmtheit der Interpretation zu opfern.
Der Text gelang Mairowitz in weiten Teilen gut. So sind sehr viele Äquivalenzen zum sprachlichen Duktus des Romans auszumachen. Negativ ist aber zweierlei: Erstens, wenn schon der Titel in der altdeutschen Version geschrieben ist, warum ist dann die Graphic Novel in neuer Rechtschreibung verfasst? Zweitens, warum wird immer wieder eine amerikanisierte Lautsprache, wie »HEY« eingebaut, die einfach nur befremdlich in einer kafkaesken Geschichte wirkt? Und drittens, warum wird oftmals die Handlung unnötig gekürzt oder auch simplifiziert? Etwa bei der Parabel ›Vor dem Gesetz‹, die innerhalb des Romans vorgetragen wird, entsteht ein Streit zwischen K. und dem Kaplan, da K. diese Parabel als Lüge, die zur Weltordnung gemacht wird, interpretiert – eine Vorgabe, die Kafka nie so expliziert hätte. Das war sehr unkafkaesk.
Das Schloss
 Unterschiedlicher könnten die Realisierungen von ›Der Process‹ und ›Das Schloss‹ im Comic gar nicht sein. Wieder hat Mairowitz die Texte verfasst, nur gezeichnet hat diesmal der Künstler, der in der Comicszene unter dem Pseudonym Jaromír 99 bekannt ist.
Unterschiedlicher könnten die Realisierungen von ›Der Process‹ und ›Das Schloss‹ im Comic gar nicht sein. Wieder hat Mairowitz die Texte verfasst, nur gezeichnet hat diesmal der Künstler, der in der Comicszene unter dem Pseudonym Jaromír 99 bekannt ist.
In dem unvollendeten, fragmentarischen Roman Kafkas kommt der vermeintliche Landvermesser K. in ein Dorf und versucht dort, in den Kreis des Schlosses und seines Beamtenapparates aufgenommen zu werden. Auch dieser Roman ist wieder wirr, labyrinthisch – eine neue Antwort wirft nur noch mehr Fragen auf, und irgendwann bricht alles mitten im Satz zusammen. Das Schloss, abermals ein totalitärer Bürokratieapparat, bleibt unerreichbar. Und alle Dorfbewohner bleiben unterwürfig, leiden unter dem Schloss und begehren nach oben in der unklaren Hierarchie; einer Hierarchie, die auch wieder aus Hinterzimmern, Wirtinnen, Geliebten, Zimmermädchen, Boten, Dienern und diversen Beamten besteht, deren Existenz oder Physiognomie nicht einmal erwiesen oder sicher ist.
Im Unterschied zu ›Der Process‹ ist der Protagonist zwar auch hier bestrebt, das System zu durchschauen, aber er versucht nicht dagegen aufzubegehren, sondern will in den Zirkel der Macht vergeblich integriert zu werden.
Die Umsetzung dieser Graphic Novels ist komplett anders als beim ›Process‹. Die Zeichnungen sind weniger filigran, weniger realistisch, bleiben düster, fast nur konturenhaft und grob. Auf Lautmalerei bzw. andere Stilmittel und Effekte wird größtenteils verzichtet. Alles bleibt abstrakter, reduzierter. Vor allem die Düsternis der Zeichnungen vermittelt hier dem Leser die beklemmende Stimmung um das Schloss und das verschneite, (sozial) kalte Dorf.
Auch wenn ›Das Schloss‹ ergo optisch nicht so schön und filigran anzusehen ist, wie noch ›Der Process‹, so kommen diese stumpfen, dunklen Zeichnungen wohl eher dem entgegen, was Kafka veranschaulichen wollte, ohne dabei zu konkret zu werden oder eine Interpretation dem Leser vorschreiben zu wollen. Jaromír 99 scheint vielmehr mit seinen Zeichnungen eher den Ansprüchen eines Kafka-Lesers gerecht zu werden.
Mairowitz hat für seinen Text mehrere englische Übersetzungen zurate gezogen, um eine eigene anzufertigen. Diese entsprechen in der deutschen Rückübersetzung wieder weitgehend dem Original. Das plötzliche Ende, das Mairowitz hier verwendet, stammt noch aus Kafkas Manuskripten selbst, welches nicht mit den gedruckten und verlegten Versionen kongruent ist. Auch hier hat Mairowitz wieder stark kürzen müssen. Das gelingt ihm aber größtenteils sehr gut, ohne dass ihm abermals stilistisch-interpretatorische Fauxpas unterlaufen.
Comic Deluxe
Die beiden Comics ›Der Process‹‹ und ›Das Schloss‹ sind in der Reihe ›Comic Deluxe‹ erschienen – und tatsächlich ist es ein Indiz für einen Deluxe-Comic, wenn dieser das so grandiose und gleichzeitig so schwierig zu illustrierende Œuvre Franz Kafkas gewinnbringend verarbeitet. Dies zeigt, dass die Hochkultur des Kafkaesken von der Sphäre der Literatur in die Sphäre des Comics hinüber schwappt, auch wenn dabei ein wenig vom Inhalt und der Kunst Kafkas versandet.
Eigentlich kann da der Fan der niveauvollen Graphic Novels es gar nicht mehr erwarten, auch den dritten und letzten Roman Kafkas adaptiert zu sehen, nämlich ›Der Fremde‹.
| PHILIP J. DINGELDEY
Titelangaben
David Zane Mairowitz (Text)/ Chantal Montellier (Zeichnungen): Der Process nach Franz Kafka
Aus dem Englischen von Anja Kootz
München: Knesebeck Verlag, 2013
127 Seiten, 22,00 Euro
David Zane Mairowitz (Text)/ Jaromír 99 (Zeichnungen): Das Schloss nach Franz Kafka
Aus dem Englischen von Anja Kootz
München: Knesebeck Verlag, 2013
143 Seiten, 22,00 Euro
| Leseprobe