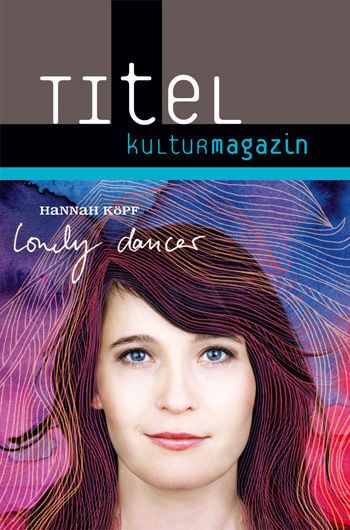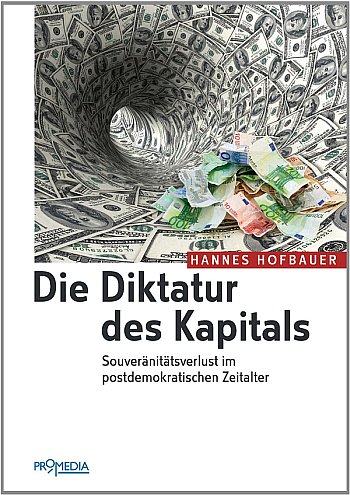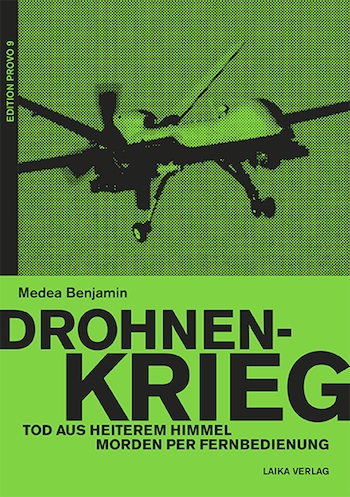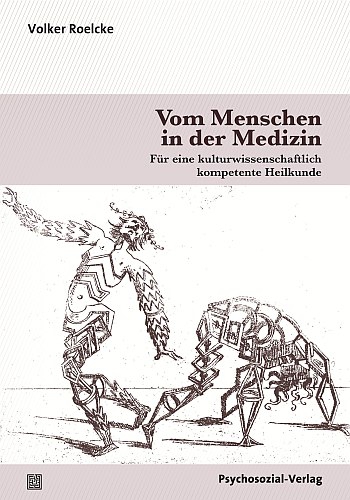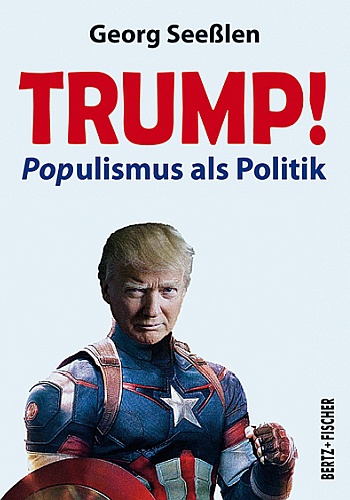Gesellschaft | Heinz Bude: Gesellschaft der Angst
Lesenswert, unbedingt. Und zwar lesenswert für den, der sich einen Eindruck von der bedrückenden Rat- und Hilflosigkeit konservativer Politik verschaffen will. Wir lesen einen kursorischen Überblick über diverse Bereiche, in denen sich Ängste artikulieren, nicht neu, nicht originell, und im letzten Teil finden sich dazu passend hymnisch getönte Sätze auf die »Amtsinhaberin«, den Inbegriff von Ruhe und Besonnenheit. Gewiss, so lässt sich die Tatsache, dass zielgerichtete Politik in Berlin nicht stattfindet, elegant schönreden. Von WOLF SENFF
 Beschwörungsformeln gegen Statuspanik. Nein, letztlich geht das nicht auf. Aber der Reihe nach. Heinz Bude verortet die Ursache für die von ihm diagnostizierte ›Gesellschaft der Angst‹ vor allem in der »latenten Statuspanik«, im »Angstgetue« der gesellschaftlichen Mittelklasse, die, noch 1962 nahezu die Hälfte der bundesrepublikanischen Bevölkerung, seit 2000 sich in große Einkommensunterschiede zergliedert habe und diverse »Milieus der Mitte« bilde.
Beschwörungsformeln gegen Statuspanik. Nein, letztlich geht das nicht auf. Aber der Reihe nach. Heinz Bude verortet die Ursache für die von ihm diagnostizierte ›Gesellschaft der Angst‹ vor allem in der »latenten Statuspanik«, im »Angstgetue« der gesellschaftlichen Mittelklasse, die, noch 1962 nahezu die Hälfte der bundesrepublikanischen Bevölkerung, seit 2000 sich in große Einkommensunterschiede zergliedert habe und diverse »Milieus der Mitte« bilde.
Selbstausbeutung, Optimierungswahn
Eine überaus erstaunliche Interpretationsleistung, sofern Heinz Bude damit die hinlänglich bekannte Tatsache umschreiben will, dass die Einkommensschere beständig weiter auseinanderklafft und die Mittelschicht ausdünnt. Man muss den feuilletonistischen Stil wohl ertragen, mit dem er allzu oft durch seine Wortwahl anstatt durch Fakten wertet. Aufschlussreich wären zum Beispiel Zahlen gewesen, mit denen er den, wie von ihm insinuiert wird, stabil gebliebenen Anteil der Mittelklasse belegt hätte – nein, hat er nicht.
Demgegenüber sei die Angst im Bereich einfacher Dienstleistungen – Putz-, Pflege-, Servicepersonal, Sicherungsdienste, Transport, Gebäudereinigung – substanziell. Dort würden in strapaziösen Jobs, die man körperlich nicht länger als zehn Jahre durchhalte, Beträge zwischen durchschnittlich neunhundert bis elfhundert Euro netto verdient, wovon weder die Familie noch Urlaub noch Alterssicherung finanzierbar sei. Nicht nur bei diesen einfachen Dienstleistungen, sondern auf allen Arbeitsplätzen leide das Personal unter Selbstausbeutung und Optimierungswahn, depressive Symptome nähmen zu.
Im Übrigen ist es frappierend, dass jemand so locker über den Niedriglohnsektor schreibt und gleichzeitig kein Wort darüber verliert, dass vierundzwanzig Prozent der Erwerbstätigen in diesem Niedriglohnsektor arbeiten müssen. »Knapp zwei Drittel aller Arbeitnehmer zwischen 25 und 40 Jahren gehen auch krank zur Arbeit« (SZ, 27.09.) Ist das eine Gesellschaft, in der man unbeschwert leben kann?
»Immer besser«, »immer sauberer«
Dass es sich bei den durch Edward Snowden öffentlich gewordenen Spionagetätigkeiten und den verborgenen Machenschaften des Finanzkapitals ebenfalls um Ängste hervorrufende, weil vermeintlich unkontrollierbare Abläufe handle, ist ebenfalls nicht besonders neu, doch damit nicht genug. Denn Angst, so Bude, »in öffentlichen Debatten als Argument vorgebracht«, entziehe sich im Prinzip jeglicher Argumentation.
Gegen »Weltuntergangsängste« wirke leider der Einwand, dass »in den alten Industrieländern« die »Luft immer besser« und die »Flüsse immer sauberer« würden, nur lächerlich. Man fragt sich, in welcher Parallelwelt Heinz Bude lebt. Luft werde »immer besser«? Ach, man wäre ja schon froh, wenn sie einfach nur gut wäre, eventuell sogar sauber, was will man mehr, und wenn in deutschen Großstädten die Feinstaubwerte nicht überschritten würden. Und die Flüsse? »Immer sauberer«? Wo liest man das? Geschenkt.
»Erschöpfungsangst«, »Bildungspanik«
Oh je. Bestimmte Formeln wie »Regime der Heuschrecken«, »Gespenst des Kapitals« würden politisch gezielt genutzt, um Ängste zu mobilisieren, vor allem in Wahlkämpfen, neu ist diese Erkenntnis nicht. Das Gegenbeispiel sei die gegenwärtige Kanzlerin, die »Amtsinhaberin«, die innere Souveränität zum Ausdruck bringe und in ihrer Person »die Angst als beherrschbar« darstelle. Das wird Frau Merkel heftig amüsieren, dass sie nun als gute Fee auftritt, gewissermaßen eine Schwamm-drüber-Fee, die alle Ängste der Bürger magisch wegsaugt.
Unter diesen Vorzeichen reduzieren sich Burn-out-Syndrom und sich ausbreitende Depression auf ein verharmlosendes »Erschöpfungsangst«, und die Sorge um eine Bildungspolitik, die mit Berufsorientierung an den Schulen und Bologna-Ausbildung an den Universitäten nur noch arbeitsmarktmäßig verwertbares Personal herstellt, wird kurzerhand zur »Bildungspanik« erklärt, er publizierte bereits 2011 über dieses Thema. Sein Ziel: dass nur der Sturm sich endlich legt. Ansonsten: alles ist gut.
Hysterische Grundstimmung
Die Lektüre wird anstrengend, weil der Eindruck entsteht, es mangele an einem roten Faden bzw. es würden lediglich diverse angstbesetzte Bereiche geschildert und damit seien sie abgehakt. Es ist ja zweifellos richtig und beileibe keine neue Erkenntnis, dass Angst zur Wirklichkeit des Menschen gehört. Aber so allgemeine Maßnahmen anzubieten wie ein Revival der selbstbewussten Lachkultur des Mittelalters oder als »Medizin gegen die Angst« eine spielerische und rebellische Volkstradition zu fördern – das wird nun der Realität ganz und gar nicht gerecht, man liest es gar als eine Verhöhnung der real Leidenden und schüttelt den Kopf über so viel Unverständnis.
Es ist dieses gnadenlose ›Weiter so‹, vor dem man sich fürchten muss und das offenbar auch die grundlegende Botschaft dieses Buches ist. Angst bewahre »zugleich die Hoffnung, dass nichts so bleiben muss, wie es ist« – doch die Lektüre bringt das Thema keinen Deut voran; wir wissen nichts über die Ursachen von Angst, uns werden keine Wege eröffnet, welche Veränderungen erforderlich wären, um Ängsten und einer sich offensichtlich konsequent ausbreitenden hysterischen Grundstimmung zu begegnen. Ein Mutmacher, darauf reduziert es sich. Sein Motto: Augen zu und durch. Wir warten weiterhin vergeblich darauf, dass von wo auch immer eine öffentliche Debatte über Ängste, ihre Ursachen und Möglichkeiten der Bewältigung initiiert wird.
Eines leuchtet sogar Lieschen Müller ein – dass nämlich, wer in Afghanistan, im Irak, in Libyen, in Syrien Kriege anzettelt, darauf gefasst sein muss, dass Flüchtlinge in Massen in Nachbarländer und nach Europa ziehen. Wäre es also eine Konsequenz, die aggressive Kriegspolitik von USA und NATO zu beenden? Das wäre vermutlich real eine Möglichkeit, Ängste begründenden Verhältnissen vorzubeugen, denn auch die »Angst vor dem Fremden«, vor dem »eingewanderten Konkurrenten« wird von Heinz Bude erwähnt, doch es bleibt leider bei der Erwähnung inklusive Appell gegen Rassismus ähnlich der Bandenwerbung in den Fußballstadien.
Das HIS verkauft sich unter Niveau
Wir lesen dieser Tage in den Zeitungen, dass die Anzahl der Amokläufe in den USA während der vergangenen Jahre laut FBI »alarmierend gestiegen« sei. In Deutschland erschienen, ausgelöst von Littleton 1999 und Bad Reichenhall 1999, intelligente Untersuchungen über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Ursachen neuer Formen von Gewalt. Fünfzehn Jahre her, und man hat den Eindruck, dass sich seitdem nichts verändert hat.
Wir erlebten die langjährige mörderische Praxis des NSU. Das ist angsteinflößende Realität, und von einer Publikation mit dem anspruchsvollen Titel »Gesellschaft der Angst«, die in dem renommierten Hamburger Institut für Sozialforschung erscheint, sollte man Aussagen erwarten dürfen, die über Allgemeinplätze und Binsenweisheiten hinausgehen – leider wird man enttäuscht.
Was bleibt, sind Fragen
Gab es die öffentliche Debatte über Ursachen und Folgen von Bad Reichenhall und Winnenden, gab es die Debatte über Ursachen von und Konsequenzen aus NSU? Die Debatte über die Konsequenzen, genau, über die Konsequenzen, als da wären der Umgang mit Vertrauensverlust, mit Verängstigung, mit verfehlter BND-Tätigkeit etc. Das NPD-Verbot wurde mal wieder aus der Lade gezogen, war aber auch schnell vorüber. In diesem Land werden Inhalte mit Vorliebe auf die lange Bank geschoben, gern auch qua Personalisierung verdrängt oder qua disziplinarischer Maßnahme bewältigt.
Und welche Rolle im Thema Angst spielt denn zusätzlich die Verelendung von Teilen der Bevölkerung, welche Rolle die willentliche Demontage staatlicher Ordnung, die Abkehr weiter Teile der Bevölkerung von Politik als einer Aufgabe der Gemeinschaft. Fragen über Fragen, die in diesem Band teils gar nicht erst gestellt, teils in bewegender Schlichtheit einfach mit: Ja, gibt’s!, beantwortet werden. So sieht’s aus. Kann man mal sehn. Eine Publikation wie diese ist Teil des Problems.
Titelangaben
Heinz Bude: Gesellschaft der Angst
Hamburg: HIS 2014
168 Seiten. 16 Euro
Nominiert für den NDR Kultur Sachbuchpreis 2014