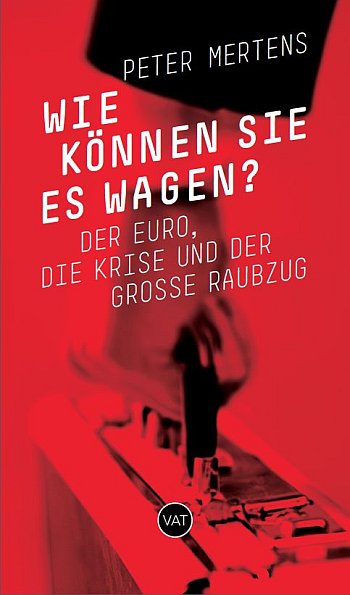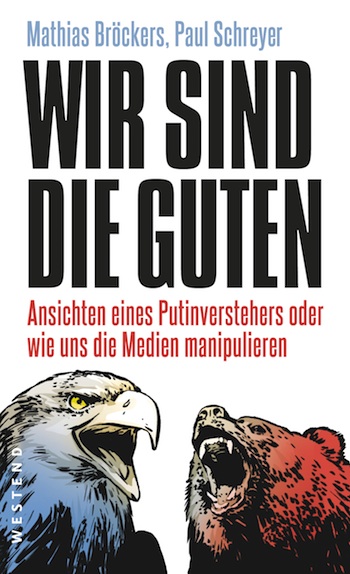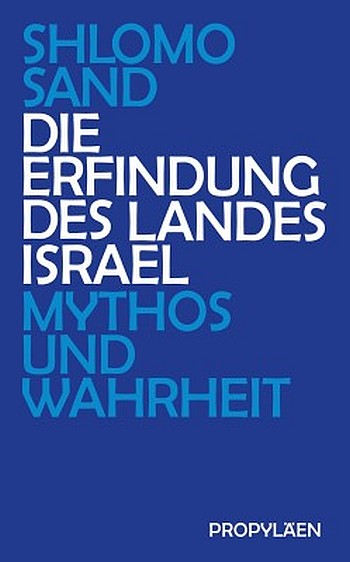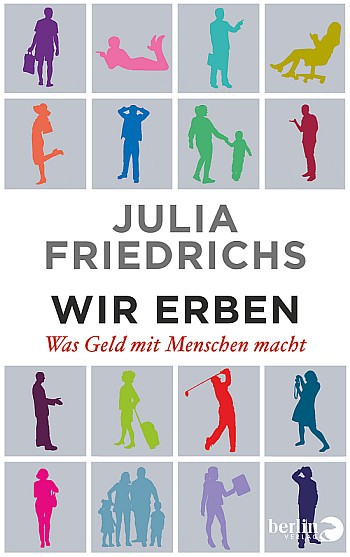Gesellschaft | Peter Burke: Die Explosion des Wissens
Im polnischen Słubice gleich gegenüber dem deutschen Frankfurt/Oder wurde Ende Oktober ein Wikipedia-Denkmal enthüllt. Auf seinem Sockel, einem Bücherberg, wird »das größte durch Menschen gemeinsam geschaffene Projekt« geehrt, in der Überzeugung, »dass die Wissensgesellschaft, deren Säule auch Wikipedia ist, im Stande sein wird, eine nachhaltige Entwicklung unserer Zivilisation, soziale Gerechtigkeit und den Völkerfrieden zu garantieren.« So optimistisch sind längst nicht alle, manche befürchten eher, dass nunmehr selbst unsere Hirnnahrung einer McDonaldisierung anheimgefallen sei. Auch der britische Kunst- und Medienhistoriker Peter Burke untersucht in ›Die Explosion des Wissens. Von der Encyclopédie bis Wikipedia‹ unter anderem, ob wir heute nicht gleichzeitig »Informationsgiganten« und »Wissenszwerge« sind. Vor allem aber legt er den zweiten Band seiner grandiosen »Sozialgeschichte des Wissens« vor, dessen erster ›Papier und Marktgeschrei. Die Geburt der Wissensgesellschaft‹ gleichzeitig auf Deutsch neu aufgelegt wird. Von PIEKE BIERMANN
 Soviel Wissen war nie! Aber wissen wir eigentlich noch? In diesem emphatisch umfassenden Sinn – sagen wir mal – des Humboldtschen Bildungsideals oder des Descartes’schen cogito ergo sum? Nein, warnen Skeptiker verschiedener Disziplinen seit langem. Die aktuelle Wissensakkumulation hat uns zum Beispiel hinterrücks die vertraute Relation von Raum und Zeit zerschlagen: Wir erfahren Dinge von sonstwo in Sekundenbruchteilen, entlegenste Weltgegenden sind nur einen Klick mit dem Finger entfernt. Welche mentalen Folgen allein das für Menschen hat, ist nicht mal ansatzweise untersucht, geschweige denn über Krankenkassenstatistiken zu rasant steigenden Depressions- und Burn-Out-Zahlen hinaus zu Wissen verarbeitet. Unsere ganze tolle Wissensakkumulation ist obendrein in Wahrheit Wissensverlust, denn was da explosionsartig akkumuliert wird, sind vor allem Informationspartikel.
Soviel Wissen war nie! Aber wissen wir eigentlich noch? In diesem emphatisch umfassenden Sinn – sagen wir mal – des Humboldtschen Bildungsideals oder des Descartes’schen cogito ergo sum? Nein, warnen Skeptiker verschiedener Disziplinen seit langem. Die aktuelle Wissensakkumulation hat uns zum Beispiel hinterrücks die vertraute Relation von Raum und Zeit zerschlagen: Wir erfahren Dinge von sonstwo in Sekundenbruchteilen, entlegenste Weltgegenden sind nur einen Klick mit dem Finger entfernt. Welche mentalen Folgen allein das für Menschen hat, ist nicht mal ansatzweise untersucht, geschweige denn über Krankenkassenstatistiken zu rasant steigenden Depressions- und Burn-Out-Zahlen hinaus zu Wissen verarbeitet. Unsere ganze tolle Wissensakkumulation ist obendrein in Wahrheit Wissensverlust, denn was da explosionsartig akkumuliert wird, sind vor allem Informationspartikel.
Prosa von »barrierefreier« Eleganz
Auch Peter Burke geht davon aus, dass wir spätestens seit der »digitalen Revolution« bloß ein Meer von Information bekommen haben, aber kein Mehr an Wissen, und sich die beiden – so eins seiner vielen griffigen Bilder – zueinander in etwa so verhalten wie Lévi-Strauss‘ »Rohes« und »Gekochtes«. Burke, eigentlich Fachmann für die frühe Neuzeit, hatte 2000 die allmähliche »Geburt der Wissensgesellschaft« (dt. 2001, ›Papier und Marktgeschrei‹) nachgezeichnet, also die etwa 250 Jahre zwischen Gutenbergs Erfindung der beweglichen Lettern und Diderots Encyclopédie. Dass sich in den fünfzig Jahren seiner eigenen Forschung und Lehre die Wissenssysteme immer schneller weiter veränderten, gab ihm den Anstoß, seiner ›Social History of Knowledge‹ (so der Originaltitel) 2012 einen zweiten Band nachzuschicken. Der ist jetzt auch bei uns erschienen, und sein deutscher Verlag bringt dankenswerterweise gleichzeitig Band 1 als wohlfeiles Paperback. Lesen kann man die ›Explosion – Von der Encyclopédie bis Wikipedia‹ aber sehr wohl einzeln, und mit größtem Gewinn.
Das liegt natürlich an Burkes Prosa, einem Prachtexemplar »barrierefreier« Eleganz, wieder hervorragend übertragen von Matthias Wolf. Und an Burkes pluralem, universalen Zugriff. Er hat sein Buch ausdrücklich als Serie von Essays angelegt: »impressionistisch in seinen Methoden und provisorisch in seinen Schlussfolgerungen«. Er will »das große Bild« entwerfen – und zwar aus der Vogelperspektive, komparativ, über nationale, soziale, disziplinäre Grenzen und Partikularperspektiven hinweg. Er betrachtet, mit anderen Worten, den ganzen Wald, ohne den Blick für faszinierende einzelne Bäume zu verlieren. Im Gegenteil, er vergnügt sich (und uns beim Lesen) mit erstaunlichsten Details.
Klammheimliches Leitmotiv für einen 3. Band
Burkes »Wald« ist die westliche Welt im weiteren Sinn, also Europa und Amerika, mit Ausflügen nach Russland, Asien, Afrika. Wie, unter welchen Bedingungen, aufgrund welcher Zwänge, ökonomisch-politisch-militärischer Interessen oder technischer Bedürfnisse wird wann wo Wissen gesammelt, analysiert, geordnet, angewandt und verbreitet? Welche Rolle spielen dabei die Wissen generierenden und definierenden Institutionen und wie funktionieren sie? Was ist der Preis des Fortschritts – zum Beispiel eben Verlust und Vernichtung von Wissen? Das sind Burkes Leitmotive, die er zum Schluss noch einmal als »Sozialgeschichte in drei Dimensionen« neu sortiert und reflektiert: geographisch, soziologisch und chronologisch.
»Veränderungen, die schnell begannen«, schreibt Burke im Schlusskapitel Chronologie des Wissens, »brauchen manchmal ziemlich lange, bis sie jeden erreicht haben.« Das klingt wie eine beruhigende Erklärung für so manchen Zickzackkurs unseres Wissens bis 2000. Oder ist es vielleicht klammheimlich das Leitmotiv für einen möglichen dritten Band über – sagen wir – die Veränderung des Wissens im Zeitalter der Geheimnislosigkeit? Etwa so: Wann wo wie ereilt uns der Erkenntnisschock angesichts des Totalverlusts unserer Privatsphäre und der Beschlagnahmung unseres privaten Wissens durch Big Data, Big Money und Geheimdienste, und was folgt daraus für das Soziale?
Eine erste Version der Rezension wurde am 10. Oktober 2014 bei Deutschlandradio Kultur veröffentlicht, ein Gespräch mit Pieke Biermann ist als Audio on Demand verfügbar.
Titelangaben
Peter Burke: Die Explosion des Wissens. Von der Encyclopédie bis Wikipedia
Aus dem Englischen von Matthias Wolf unter Mitarbeit von Sebastian Wohlfeil
Berlin: Wagenbach 2014
392 Seiten. 29,90 Euro
Peter Burke: Papier und Marktgeschrei. Die Geburt der Wissensgesellschaft
Aus dem Englischen von Matthias Wolf
Berlin: Wagenbach 2014 (Neuauflage)
256 Seiten. 19,90 Euro