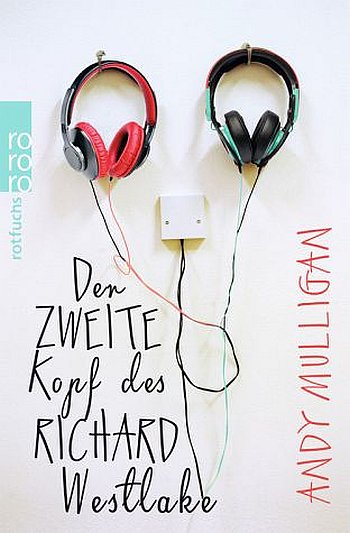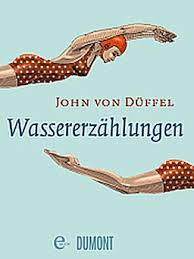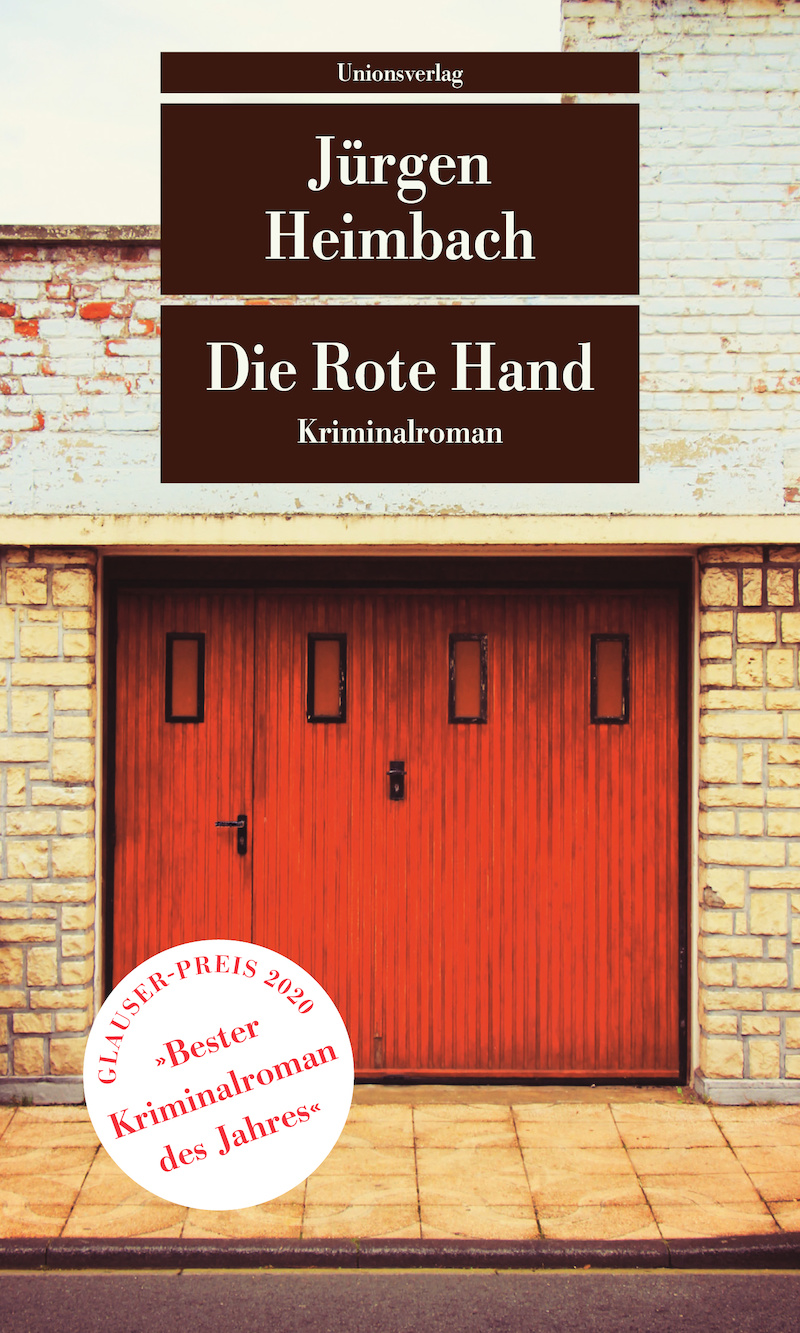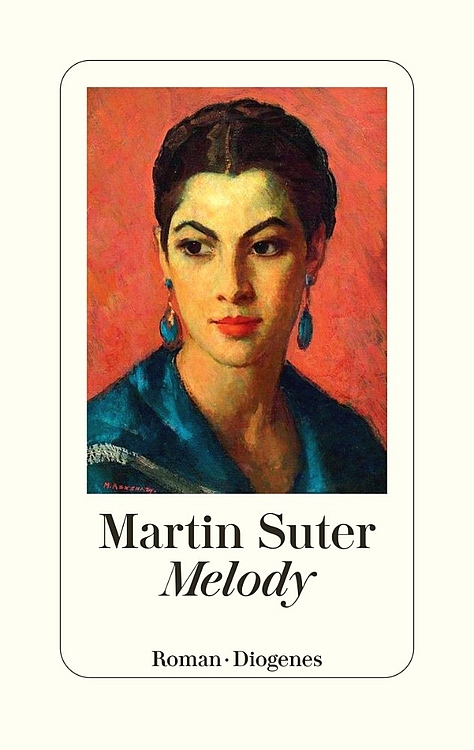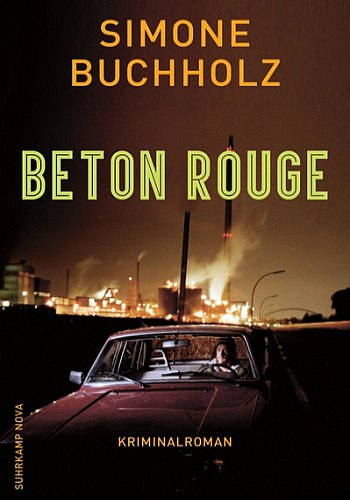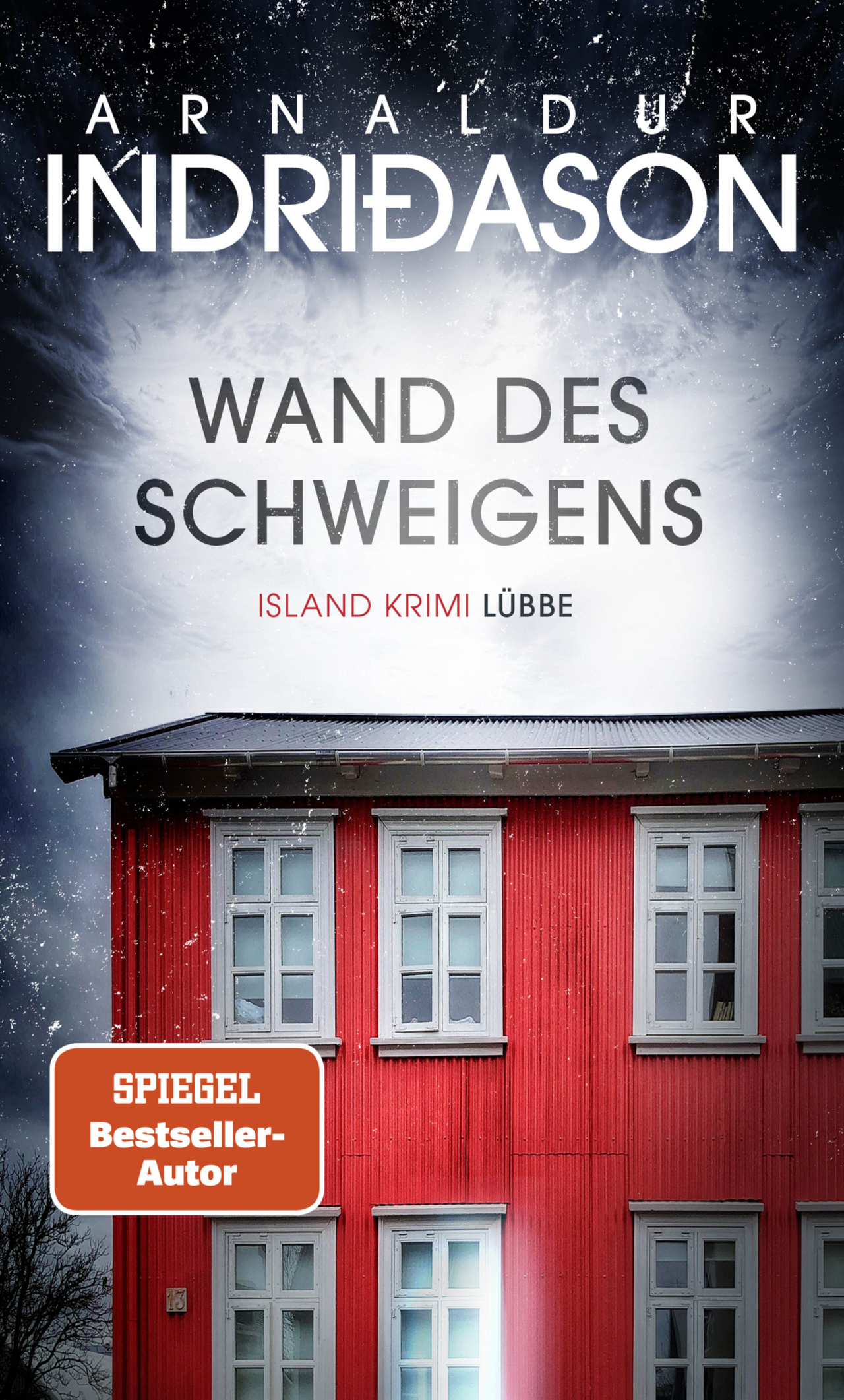Roman | Joyce Carol Oates: Die Verfluchten
»Ich habe all diese hässlichen Wörter einfach hingeschrieben und bin dabei allmählich in Fahrt gekommen. Ein stiller Schreibrausch hat mich erfasst.“, ließ die amerikanische Schriftstellerin Joyce Carol Oates eine Figur in ihrem Roman Zombie (dt. 2000) erklären. Ob es beim Lesen des neuen Romans Die Verfluchten ebenfalls zu einem »rauschhaften« Erleben kommt, erklärt PETER MOHR
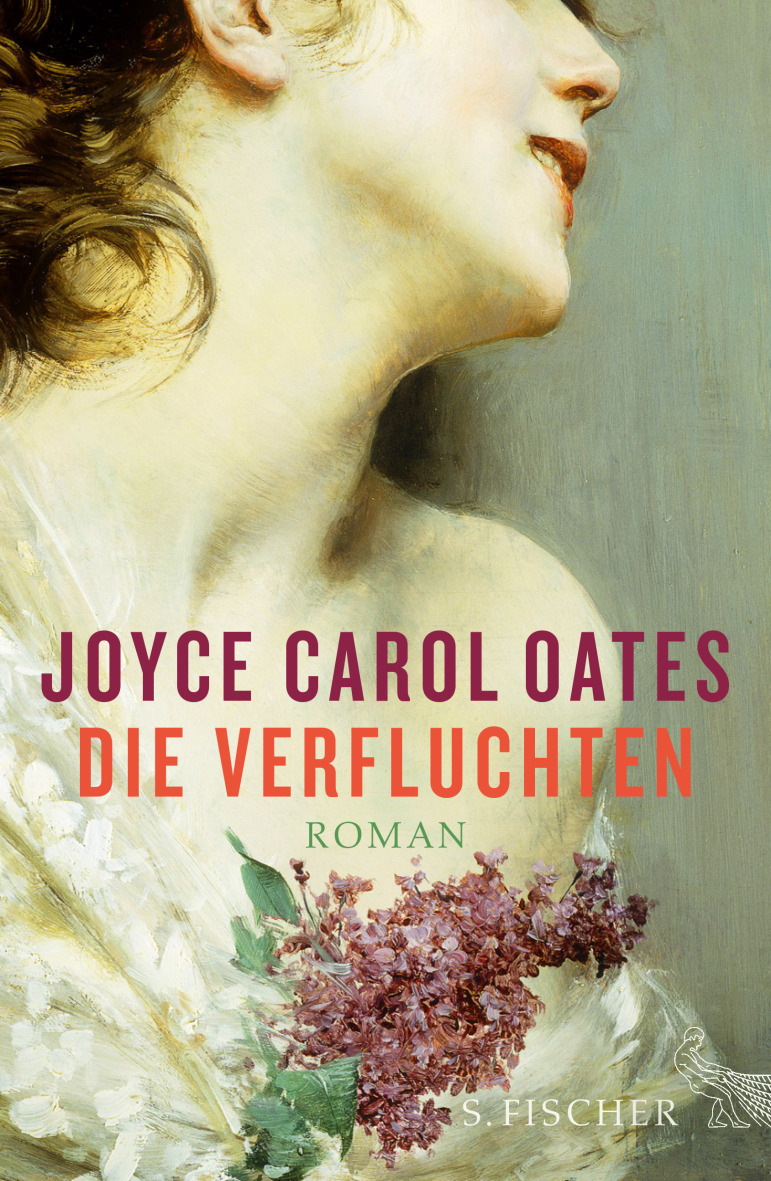 »Wenn ich nicht schreibe, dann lese ich.« Unendlich viel hat die inzwischen 76-jährige Autorin Joyce Carol Oates schon geschrieben, zuletzt zwei bewegende autobiografische Romane, und in den letzten Jahren war sie sogar als heiße Nobelpreiskandidatin gehandelt worden.
»Wenn ich nicht schreibe, dann lese ich.« Unendlich viel hat die inzwischen 76-jährige Autorin Joyce Carol Oates schon geschrieben, zuletzt zwei bewegende autobiografische Romane, und in den letzten Jahren war sie sogar als heiße Nobelpreiskandidatin gehandelt worden.
Schon als Schülerin soll sie die ersten Geschichten verfasst haben, als junge Studentin (so die Legende) schrieb sie pro Semester einen Roman, die Veröffentlichung ihres ersten Bandes mit Kurzgeschichten liegt schon fast fünfzig Jahre zurück, und bereits 1969 erhielt sie für den Roman Them den National Book Award.
Inzwischen sind es rund 60 (publizierte) Romane, über 100 Kurzgeschichten, dazu zahllose Essays, Theaterstücke, Drehbücher, Kritiken und wissenschaftliche Aufsätze. Kann man da noch unbekanntes literarisches Terrain erobern?
Joyce Carol Oates hat dies offensichtlich zumindest versucht – mit einer Mischung aus Gesellschaftskritik, Schauergeschichte und historischer Klatsch- und Tratschstory. Über dreißig Jahre soll die Autorin an diesem umfangreichen Wälzer, der uns an den Anfang des 20. Jahrhunderts versetzt, geschrieben haben. Wir befinden uns in den Jahren 1905/1906, als die bekannte Universitätsstadt Princeton (dort lebt Oates seit fast vierzig Jahren) in Aufruhr gerät, weil sich allerlei schaurige, unerklärliche Dinge zutragen.
Annabel Slade, die Enkelin des einstigen Uni-Präsidenten Winslow Slade, wird während ihrer Trauung aus der Kirche entführt. »So wendet sich die Braut blicklos von ihrem Bräutigam ab, lässt ihr Blumenbouquet zu Boden fallen, sieht weder nach links noch nach rechts, sondern mit starrem Blick zu der gebieterischen Gestalt in der Tür, eilt mit der beschädigten Anmut eines verletzten Vögelchens durch den Gang, die Lippen zu einem verführerischen Lächeln leicht geöffnet.“ An dieser Stelle ließe sich schon trefflich über die »Anmut eines verletzten Vögelchens« streiten, doch hier geht es nicht nur sprachlich, sondern auch inhaltlich reichlich verwegen zu.
Die junge Annabel wird nämlich von einem krötenähnlichen Dämon aus der Kirche gelockt. Dies ist so etwas wie der Startschuss zu einer blutigen Geisterbahnfahrt, in deren Verlauf unglaubliche Verbrechen geschehen und auch noch zwei Geschwister der jungen Frau Slade ums Leben kommen.
Der Unhold verbirgt sich offensichtlich hinter vielen Masken oder in vielen Körpern. Er treibt sein Unwesen als Axson Mayte, Count English oder gar als leibhaftiger Sherlock Holmes, mal begleitet von einer aufreizenden Blondine, mal von einem schwulem Vampir.
Joyce Carol Oates erzählt diese ausufernde Klatsch- und Tratschgeschichte aus der Perspektive des fiktiven Historikers M.W. van Dyck II, der sich allerdings mehr und mehr als geschwätziger Wichtigtuer denn als faktenorientierter Wissenschaftler präsentiert.
Auch die Auftritte realer historischer Figuren wie US-Präsident Woodrow Wilson (1856-1924) und die beiden Schriftsteller Upton Sinclair und Jack London können diesen Roman nicht retten. Auch diese Episoden sind allzu stark auf vordergründige Effekte und Polemik ausgelegt. Der von diversen Krankheiten gezeichnete Wilson konsumiert eine Menge Drogen und pumpt sich in der Folge selbst den Magen aus.
Upton Sinclair und Jack London werden auf ziemlich banale Art und Weise gegeneinander ausgespielt: der eine ist naiv, ehrlich und bescheiden (Sinclair), der andere wichtigtuerisch, rassistisch und dem Alkohol verfallen. Im dramaturgischen Finale gibt es sogar noch den waghalsigen erzählerischen Salto zum Krimi. Ein honoriger Bürger von Princeton entpuppt sich dabei als Leichenschänder. Am Ende der Lektüre ist man als Leser erleichtert und (die Anleihe zum Titel sei erlaubt) »verflucht« im Nachhinein die Opulenz dieses Romans.
Die viel zitierte dichterische Fantasie hat Joyce Carol Oates bis über die Schmerzgrenze hinaus ausgereizt und ein schauriges, völlig disparates literarisches Monstrum vorgelegt. Alles andere als eine Empfehlung für den Nobelpreis.
Titelangaben
Joyce Carol Oates: Die Verfluchten
Aus dem Amerikanischen von Silvia Morawetz
Frankfurt/M.: S. Fischer Verlag 2014
750 Seiten. 26,99 Euro