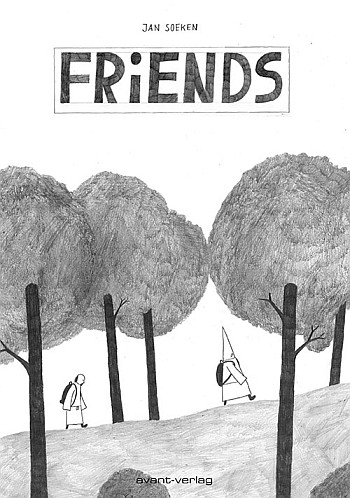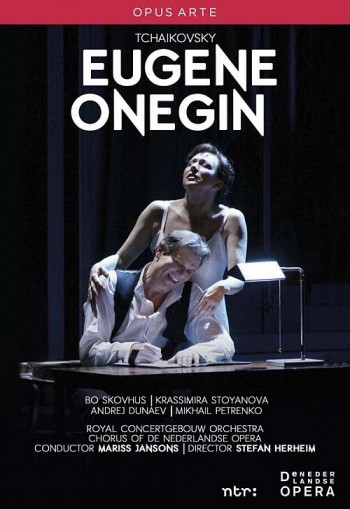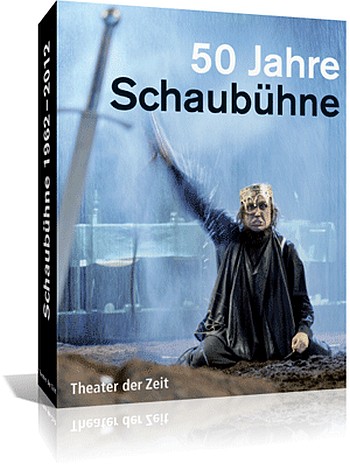Bühne | Im Theater: Rusalka im Theater Pforzheim
Es gibt Themen und Motive, die gleichsam Fiktion und Realität begleiten. Die Liebe ist so ein Motiv, das die Nixe Rusalka (Banu Böke) sogar die Grenze zwischen Mensch und Natur überschreiten lässt. Auch die Frage von Identität und Unerreichbarkeit ist Thema des lyrischen Märchens in drei Akten von Antonín Dvořák, basierend auf dem Libretto von Jaroslav Kvapil. Von JENNIFER WARZECHA
 Der Inhalt des Librettos orientiert sich dabei stark an Hans Christian Andersens ›Die kleine Meerjungfrau‹, das deutsche Märchendrama ›Die versunkene Glocke‹ von Gerhart Hauptmann und die Erzählung ›Undine‹ von Friedrich de la Motte Fouqué.
Der Inhalt des Librettos orientiert sich dabei stark an Hans Christian Andersens ›Die kleine Meerjungfrau‹, das deutsche Märchendrama ›Die versunkene Glocke‹ von Gerhart Hauptmann und die Erzählung ›Undine‹ von Friedrich de la Motte Fouqué.
Die Pforzheimer Inszenierung nimmt sich des Stoffes der ›Kleinen Meerjungfrau‹ an. Die Nixe »Rusalka« sehnt sich danach, Liebe zu empfinden. Sie opfert ihre Stimme zugunsten der Verwandlung in einen Menschen. Dieser Mensch möchte lieben und dem Objekt der Begierde, dem Prinzen (Reto Rosin), begegnen. Auch der Tod kommt dabei als zentrales Motiv zum Tragen: Er entscheidet nicht nur über Rusalkas Rückkehr in den See, sondern auch über Vereinigung oder Trennung der beiden Liebenden. In Pforzheim kommt es bei der Inszenierung von Bettina Lell, unter der Dramaturgie von Isabelle Bischof und der musikalischen Leitung von Martin Hannus, dabei zu einem überraschenden Ende.
Kunstmärchen im Zeichen der Romantik
Der Wassermann (Cornelius Burger) steht dabei durch seine Maske, die gleichermaßen sein Gesicht abbildet, als Synonym für die Wasserwelt, weshalb im 3. Akt nicht er, sondern stellvertretend für ihn, seine Stimme vom Tonband ertönt.
Sanfte Streicher unter anderem von Oboe, Harfe und Geige der Musiker der Badischen Philharmonie Pforzheim, mit Einspielern des Chors des Theaters Pforzheim, unterstreichen die mythische Reise durch menschliche und natürliche Sphären und schaffen eine romantische und geheimnisvolle Atmosphäre. Diese orientiert sich an einem Bühnenbild, das teilweise durch Waldszenerien an die literarische Epoche der Romantik erinnert. In dieser ist das »Kunstmärchen aus verschiedenen Kunstmärchen und Opernlibretti«, wie es Operndirektor Wolf Widder auf der anschließenden Premierenfeier bezeichnet, ausgehend von den Diskursen über Natur und Wissenschaft des 19. Jahrhunderts, situiert.
Liebe allein reicht nicht
Passend hierzu singt Rusalka bereits im 1. Akt das ›Lied an den Mond‹. »Bleib‘ noch ein Weilchen bei mir. Sag‘, wo mag mein Liebster sein? Sag‘ ihm von meiner Liebkosung! Möge er im Augenblick seines Traums an mich denken.« Auch der Traum als Symbol der tieferen Wirklichkeit und Möglichkeiten steckt nicht nur im Lied, sondern auch in der Aussage des ganzen Stückes. Diese Wirklichkeit in einer anderen Welt, der Menschenwelt, erreicht Rusalka nicht. Ihr fehlt die Sprache, denn sie war der Preis dafür, dass sie Mensch werden durfte. Damit fehlt ihr auch die Möglichkeit, sich ganz dem Prinzen hinzugeben. Schon alleine im Sinne der Sprechakttheorie kann ihrer gefühlsmäßigen Liebe keine Handlung nachfolgen.
 Rusalkas immer wieder zu sehender verängstigter Blick – etwa, wenn der Prinz im 1. Akt sich an sie heranschleicht und sich an sie anschmiegen möchte – vergegenwärtigen dabei zusätzlich die Angst der Figur Rusalka vor dem Fremden, dem Menschlichen. Gerade deshalb ist der Prinz in den einzelnen Szenen immer wieder irritiert von der Kühle, die Rusalka ausstrahlt – unterstrichen von den meist silbern oder schwarz im hellen Scheinwerferlicht erstrahlenden Kleidern der Protagonistin. Den Kontrast hierzu bilden die Szenen im 2. Akt ab, innerhalb dessen sich Prinz und Fremde Fürstin (Marie-Kristin Schäfer) begegnen, sie sich in gemusterter und durchsichtiger Strumpfhose, samt rotem Kleid und Negligé gekleidet, an ihn heranpirscht und sich beide, umhüllt von rotem Scheinwerferlicht, in der rechten oberen Luke lieben.
Rusalkas immer wieder zu sehender verängstigter Blick – etwa, wenn der Prinz im 1. Akt sich an sie heranschleicht und sich an sie anschmiegen möchte – vergegenwärtigen dabei zusätzlich die Angst der Figur Rusalka vor dem Fremden, dem Menschlichen. Gerade deshalb ist der Prinz in den einzelnen Szenen immer wieder irritiert von der Kühle, die Rusalka ausstrahlt – unterstrichen von den meist silbern oder schwarz im hellen Scheinwerferlicht erstrahlenden Kleidern der Protagonistin. Den Kontrast hierzu bilden die Szenen im 2. Akt ab, innerhalb dessen sich Prinz und Fremde Fürstin (Marie-Kristin Schäfer) begegnen, sie sich in gemusterter und durchsichtiger Strumpfhose, samt rotem Kleid und Negligé gekleidet, an ihn heranpirscht und sich beide, umhüllt von rotem Scheinwerferlicht, in der rechten oberen Luke lieben.
 Wie immer in Szenen, die ihr emotional Angst bereiten, schneidet sich auch hier Rusalka einen Teil ihres Kleides an der langen Schleppe ab. Charakterstark und von Charisma zeugend ist die Figur Rusalka gerade durch ihre traurigen Blicke, untermalt von entsprechenden Liedklängen. Rusalka äußert sich und ihre Gefühle auch über die Musik. Entscheidend sind Sprachklang und Leitmotiv. Dieses wird von tiefen Streichern und einer rhythmischen Tonwiederholung mit einer Vorschlagsfigur gespielt.
Wie immer in Szenen, die ihr emotional Angst bereiten, schneidet sich auch hier Rusalka einen Teil ihres Kleides an der langen Schleppe ab. Charakterstark und von Charisma zeugend ist die Figur Rusalka gerade durch ihre traurigen Blicke, untermalt von entsprechenden Liedklängen. Rusalka äußert sich und ihre Gefühle auch über die Musik. Entscheidend sind Sprachklang und Leitmotiv. Dieses wird von tiefen Streichern und einer rhythmischen Tonwiederholung mit einer Vorschlagsfigur gespielt.
Weitere Motive entwickeln sich als Teil der Wasserwelt in der Melodik. In der Menschenwelt gibt es keine Leitmotive. Die Musik ist durch eine markante rhythmische Gliederung markiert, die sich beispielsweise in den Dienerfiguren des Musikdramas zeigt. Die Fremde Fürstin singt ihre Beschimpfungen immer in der gleich währenden rhythmischen Figur. Dvořák kommt es im Zuge der Gestaltung der Menschenwelt nicht auf die Gestaltung von Stimmungen, sondern auf die traditioneller Arien und Duette, an.
Neben dem Zusammenspiel von Musik und Figurendramatik überzeugt insgesamt das Zusammenspiel der Figuren, gerade durch ihre jeweiligen Charakterstärken.
Inszenierung und Zugangsweise überzeugen
 Gleichsam ist das Musikdrama – begrifflich angelehnt an Richard Wagner, dessen Werke Dvorak kannte und schätzte – eine Frage nach dem Glück, denn wie die Elfen im dritten Akt singen »Du wolltest Mensch werden, suchtest das größte Glück bei den Menschen. Sie wollen Dich nicht mehr«, ist Rusalka auf der Suche nach Identität und Glück und ermöglicht damit dem Zuschauer eine moderne Sichtweise auf das Stück. Sie weint, ergriffen von der Botschaft, und dreht mit geradezu schmerzverzerrtem Gesicht den Rücken zum Publikum.
Gleichsam ist das Musikdrama – begrifflich angelehnt an Richard Wagner, dessen Werke Dvorak kannte und schätzte – eine Frage nach dem Glück, denn wie die Elfen im dritten Akt singen »Du wolltest Mensch werden, suchtest das größte Glück bei den Menschen. Sie wollen Dich nicht mehr«, ist Rusalka auf der Suche nach Identität und Glück und ermöglicht damit dem Zuschauer eine moderne Sichtweise auf das Stück. Sie weint, ergriffen von der Botschaft, und dreht mit geradezu schmerzverzerrtem Gesicht den Rücken zum Publikum.
Noch mehr grämt sich am Ende der Prinz, reckt sich vom linken Bühnenrand ausgehend empor zu ihr, himmelt sie an. Beide buhlen tänzerisch ein letztes Mal umeinander. Er bittet sie um Verzeihung. Sie zeigt eine Gefühlsregung und blinzelt ihm zu. Sie kündigt den Kuss an, der ihm den Tod bringen wird. Das Motiv des Todeskusses existiert auch bei Hauptmann. Rusalkas Prinz sinkt herab und stirbt. Sie versöhnt sich mit ihrer Schuld und der Menschenwelt. Ob sie zum Irrlicht wird, als Teil der Unterwasser- oder der Menschenwelt weiterexistiert, bleibt offen. Damit verschwimmt auch der Gegensatz zwischen den beiden Welten und verleiht dem Stück den Zug der Moderne. Ein am Ende tosender Applaus im gut gefüllten Großen Haus des Stadttheaters belohnt diesen Ansatz. Eine rundherum gelungene Inszenierung.
Fotos: Sabine Haymann
Titelangaben
Musikalische Leitung: Martin Hannus
Inszenierung: Bettina Lell
Bühne und Kostüme: Beate Zoff
Choreinstudierung (Einspieler): Salome Tendies
Dramaturgie: Isabelle Bischof