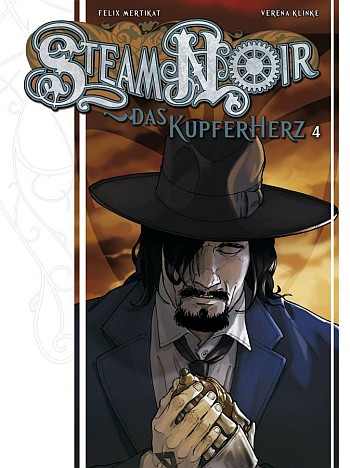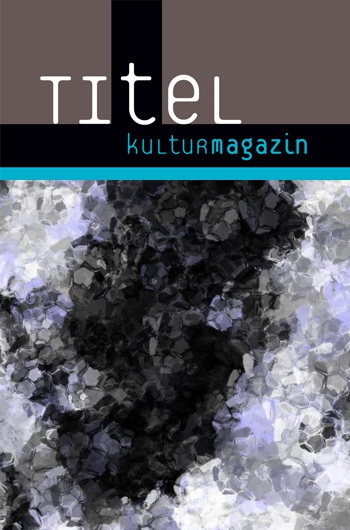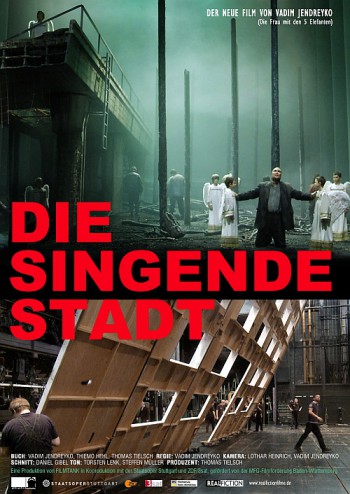Bühne | Richard Wagners ›Parsifal‹ am Badischen Staatstheater Karlsruhe
»Genie oder Wahnsinniger?« Dies ist sicherlich eine der ersten Fragen, die man sich als Wagner-Interpret stellt. Vor allem, wenn man nicht nur sein Werk selbst betrachtet, sondern auch Wagners eigene Bekundungen über das Werk hinaus. Der Wunsch nach einem Gesamtkunstwerk, resultierend aus der Verbindung von Musik, Text und Schauspiel, samt entsprechender Dramaturgie und künstlerischer Inszenierung, steht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite steht der Wunsch danach, die übersinnliche und die realistisch erfahrbare Welt zu verändern. Wagner – ein religiöser Erneuerer oder ein Spinner? Von JENNIFER WARZECHA

Foto: Jochen Klenk
Sinnbildlich Sexualität, Sünde und Weiblichkeit verkörpernd, überzeugt denn auch Kundry (charakterstark und gesanglich überzeugend: Christina Niessen), neben Parsifal (tiefgründig und charakterstark, gesanglich ebenso überzeugend: Jeffrey Dowd a.G./Erik Nelson Werner) und Amfortas (Sinn- und Heilssuche genauso überzeugend verkörpernd: Renatus Meszar), am meisten. Damit überzeugt die (mit zwei Pausen) fünfeinhalb Stunden andauernde Vorstellung auch insgesamt: Sowohl die mehr gesprochenen als gesungenen Texte, als auch die musikalische Einrahmung (musikalische Leitung: GMD Justin Brown/Johannes Willig) und das schlicht, aber treffend gestaltete Bühnenbild (Bühne: Tilo Steffens) lassen den Kern der Wagner’schen Oper in klarem Licht erscheinen: die sprichwörtliche Suche nach sich selbst und dem Ursprung allen Seins. Dieses ist gestört durch den der Bibel, und damit der Entstehungsgeschichte des religiös orientierten protestantischen und katholischen Menschen, nachempfundenen Sündenfall der Urmenschen Adam und Eva.

Foto: Jochen Klenk
In einer anderen Szene der Oper wird Kundry ebenfalls zur Gefahr für Parsifals Heil – dann nämlich, als sie ihre zuerst bieder in karierter Schuluniform daherkommenden und dann durch adrette Röckchen sehr sinnlich wirkenden Damen aus dem Elysium anleitet, Parsifal zu verführen.
Der Kunstwerkcharakter ermöglicht die Suche nach Antworten
Amfortas aber hat gerade deswegen eine Wunde, weil er den schönen Mädchen, die Klingsor herbeigezaubert und mit denen er Amfortas verführen wollte, nicht widerstehen konnte. Erst am Ende, als Amfortas sich weigert, anlässlich der Totenfeier seines Vaters Titurel (überzeugend: Avtandil Kaspeli) den Gral »zum letzten Mal« zu enthüllen, schließt Parsifal die Wunde. Amfortas ist erlöst, seine Sinnsuche damit beendet. Auch Kundry bleibt nichts anderes übrig, als nach Erlösung zu suchen. Sie verlachte einst die Erlöserfigur der christlichen Religionslehre, Jesus Christus. Sie fordert von Parsifal Mitleid, das gleiche Mitleid, das er für Amfortas empfindet, und das so zum rettenden Anker der Oper wird. Bis Kundry am Ende durch den neuen Gralskönig Parsifal getauft wird, wirkt sie als ambivalente Figur: Auf der einen Seite ist sie von sanfter Natur in der Welt der Gralsritter: Hier verkörpert sie die büßende Dienerin. In Klingsors Welt ist sie eine, die durch ihre Verführungskünste Verderben stiftet. Nicht umsonst ist die Figur angelehnt an »Urteufelin«, »Höllenrose«, »Herodias« und »Gundryggia«, als solche angelehnt an Figuren des Versepos ›Atta Troll‹ von Heinrich Heine – wie das Programmheft berichtet. Kurz vor ihrer Taufe durch Parsifal wäscht sie diesem die Füße. Diese Szene erinnert an die Waschung der Füße Jesus‘ durch Maria Magdalena. Und – wie für Wagner nicht untypisch – durchziehen immer wieder ähnliche Szenen die Oper. Zum Beispiel als Kundry, Gurnemanz und Parsifal auf der fahrenden Bühne stehen und diese während ihrer Umdrehungen die Szene zeigen, in der der biblische Abraham sich anschickt, seinen Sohn Isaak zu opfern, oder die, in der Jesus selbst sein Kreuz nach Golgatha trägt, oder die, in der Prometheus an einen Felsen gekettet ist.

Foto: Jochen Klenk
Der Oper und ihren Besuchern selbst gibt Wagner gerade durch ihren Charakter als Kunstwerk die Chance, sämtliche Fragen, wie die der Sexualität, an die Religion zu stellen und sie damit auch zu hinterfragen. So stellt sich zum Beispiel Kundry im Zuge der Individualisierung und des Feminismus‘ die Frage danach, wer sie sei und warum ihre Sexualität vonseiten Klingsors instrumentalisiert werde – ganz moderne Fragen, die bei Wagner bereits die Dramatik des 20. Jahrhunderts (Harold Pinter, Tennessee Williams und Alban Berg) andeuten. Ergänzt wird dies durch ebenso moderne Weltanschauungen in Form der Anlehnungen an Motive aus Buddhismus und Hinduismus und der Schopenhauer’schen Moralphilosophie im Zeichen des Mitleids und der daraus resultierenden Aufhebung des Leidens. Genie oder Wahnsinniger? – Eine sicher auch nicht leicht zu beantwortende Frage. In Karlsruhe jedenfalls belohnt ein tosender Applaus im bis auf den letzten Platz gefüllten Großen Haus des Badischen Staatstheaters Wagner selbst und Wagners Versuch eines Gesamtkunstwerks. Einziges Manko: Die langen musikalischen Partituren verlängern die einzelnen Szenenfolgen und machen es dem Zuschauer bei aller Qualität manchmal schwer, dem Ganzen mit aller Konzentration zu folgen.
| JENNIFER WARZECHA
| Titelfoto: FALK VON TRAUBENBERG
Titelangaben
Richard Wagners ›Parsifal‹ am Badischen Staatstheater in Karlsruhe
Regie: Keith Warner
Bühne: Tilo Steffens
Kostüme: Julia Müer
Amfortas: Renatus Meszar
Titurel: Avtandil Kaspeli
Gurnemanz: Alfred Reiter/Friedemann Röhlig
Parsifal: Erik Nelson Werner/Jeffrey Dowd
Klingsor: Jaco Venter
Kundry: Christina Niessen
Erster Gralsritter: James Edgar Knight
Zweiter Gralsritter: Luiz Molz