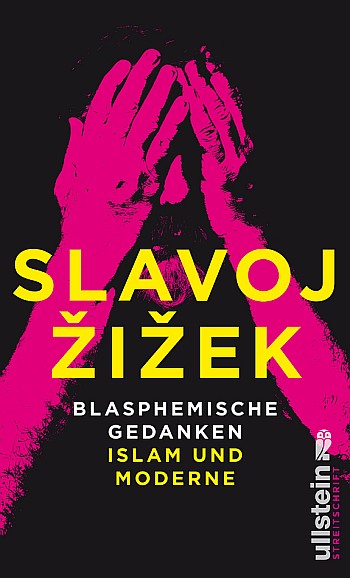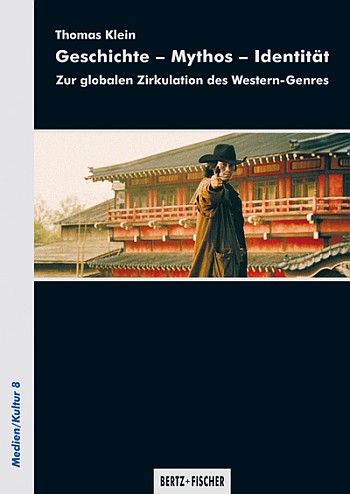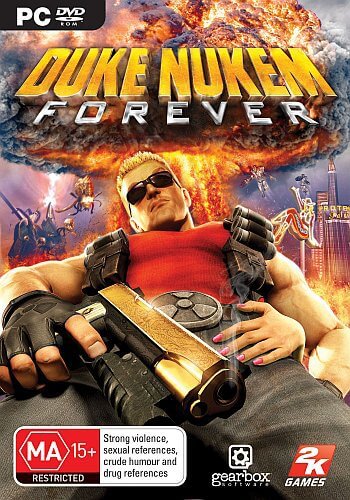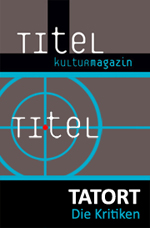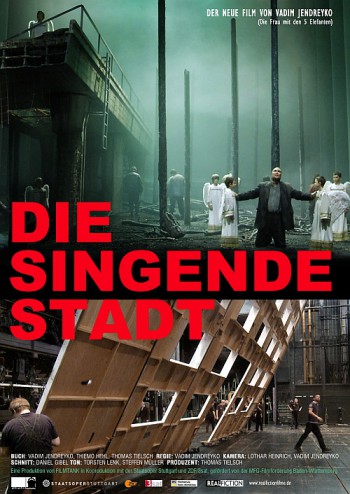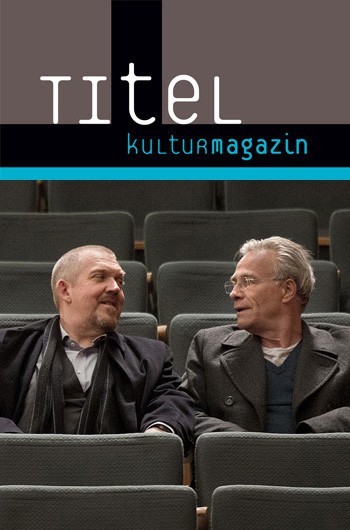Sachbuch | Anmerkungen zu Thomas Klein: Geschichte – Mythos – Identität. Zur globalen Zirkulation des Western-Genres
Man sollte über den Western vielleicht keine nüchternen Texte verfassen, das ist nur unter Schwierigkeiten möglich, und Thomas Klein weist in seiner hier rezensierten grundlegenden Untersuchung zurecht wiederholt darauf hin, dass dieses Genre sich facettenreich entwickelt und sich erfolgreich behauptet, indem es seine Erscheinung chamäleongleich verändert. Nun denn. Vielleicht gibt es dennoch einige Leitfäden. Von WOLF SENFF

Brainwash
Hier fand politische Indoktrination statt, die Kultur der USA wurde »gesäubert« und zwecks imperialer Verbreitung instrumentalisiert; wir kennen diverse Beispiele, etwa die kaltblütig betriebene Säuberung der Film- und TV-Industrie, die Verhöre von Bertolt Brecht vor dem ›Ausschuss für unamerikanische Umtriebe‹, die für Arthur Miller und Pete Seeger verhängten Haftstrafen, weil sie sich weigerten, vor dem Ausschuss auszusagen etc. p.p. – Beispiele im Überfluss.
Dass der Western vor dem kulturellen Brainwash des McCarthyismus auf intellektuell anspruchsvollem Niveau stand, lässt sich an Beispielen der vierziger Jahre problemlos belegen, etwa an Howard Hughes‘ ›The Outlaw‹ (1943), in dem die Geschichte Billy the Kids erzählt wird, von feiner ironischer Brechung unterlegt. Eine Original Schwarzwälder Kuckucksuhr misst die Frist bis zum Duell, welches dann doch einer spontanen Abrüstung wegen ausfällt.
Doc Holiday etc.
Wir erleben einen ans Absurde grenzenden Nervenzusammenbruch von Pat Garrett: »It sure is funny how two or three trails can cross and get all tangled up«, einen einsichtigen Billy the Kid: »Last night I was ready to kill you but in the daylight I can see things much better«, sowie Jane Russell als Rio, die für ein Pferd eingetauscht wird, und auch das darf als ironische Brechung verstanden werden. So kann’s gehen im Western.
›The Outlaw‹ amüsiert sich über Klischees, auch der Schluss ist ironisch gebrochen. Die zentralen Figuren Pat Garrett, Doc Holiday und Billy the Kid haben ihre Erfahrungen mit Freundschaft und Liebe verarbeitet, sie begegnen den Wechselfällen des Lebens konsequent, aber mit Humor und Gelassenheit, ›reif‹ und ›erwachsen‹.
Ein Western-Mythos welkt
 Demgegenüber ist ›Pat Garrett jagt Billy the Kid‹, das Monumentalwerk Sam Peckinpahs von 1973, eher seicht, Ironie als Nebeneffekt, die Spannung beruht häufig auf kalkulierten Schockeffekten, schön schaurig wird der Schluss wie einst bei RTL Reality-TV inszeniert. Der kommerzielle Erfolg ist nicht zuletzt durch das Auftreten und die Musik Bob Dylans eingeplant, so gelingt Western mehr schlecht als recht.
Demgegenüber ist ›Pat Garrett jagt Billy the Kid‹, das Monumentalwerk Sam Peckinpahs von 1973, eher seicht, Ironie als Nebeneffekt, die Spannung beruht häufig auf kalkulierten Schockeffekten, schön schaurig wird der Schluss wie einst bei RTL Reality-TV inszeniert. Der kommerzielle Erfolg ist nicht zuletzt durch das Auftreten und die Musik Bob Dylans eingeplant, so gelingt Western mehr schlecht als recht.
Generell lässt sich an der Wyatt Earp/Doc Holiday-Erzählung der Niedergang eines zentralen Western-Mythos verfolgen; die bislang letzte Version, ›Wyatt Earp‹ (Lawrence Kasdan, 1994 mit Kevin Costner) war ein Debakel, der Film wurde mit diversen ›Razzie Awards‹, ›Zitronen‹, ausgezeichnet, u.a. für den ›worst director‹ und den ›worst actor‹.
Revolverhelden der 40er
Auf einem dem ›Outlaw‹ vergleichbaren anspruchsvollen Niveau liegt ›The Gunfighter‹ (Henry King, 1950), in dem Jimmy Ringo (Gregory Peck), der Revolverheld, immer wieder deutlich macht, wie verhasst ihm die eigene Lebensweise ist, drei Jahre zuvor ähnlich bereis in ›Gunfighters‹ (George Waggner, 1947) – wie sich heutzutage wohl die ›National Rifle Association of America‹ zu einem solchen Film stellen würde? Ein späteres Beispiel aus den Fünfzigern ist ›Red Sundown‹ (Jack Arnold, 1955), in dem die expansiven Pläne eines tyrannischen Rinderbarons, die von der Bank gefördert werden, zu Fall gebracht werden – wenn das keine aktuellen Themen sind!
Auch ›My Darling Clementine‹ (John Ford, 1946), in dem Henry Fonda als Wyatt Earp auftritt, hängt nicht an Klischees, sondern es ist in diesem Fall die angegriffene Gesundheit, die den Helden das Leben kostet. Ungewohnte Verhältnisse für einen Western, will sagen ›My Darling Clementine‹ spielt auf hohem Niveau.
Der Bruch des McCarthyismus
 Der Western schlug jedoch spätestens seit Mitte der fünfziger Jahre andere Wege ein, vergleichbar dem Krimi, dessen Film-noir-Tradition unter der Propaganda des Kalten Krieges versiegte. Es wäre aufschlussreich, diesen Bruch detailliert zu untersuchen und nachzuweisen. Neu ist auch, dass der Western nun das Thema Sex und Gewalt – an das in ›The Outlaw‹ noch kein Gedanke verschwendet wird – in Besitz nimmt, unübersehbar z. B. in ›Forty Guns‹ (Samuel Fuller, USA 1957), und Vergewaltigung leitet ›Last Train from Gun Hill‹ (John Sturges, USA 1959) ein, einen Film, in dem ein lapidares Resumee gezogen wird: »The human race stinks«.
Der Western schlug jedoch spätestens seit Mitte der fünfziger Jahre andere Wege ein, vergleichbar dem Krimi, dessen Film-noir-Tradition unter der Propaganda des Kalten Krieges versiegte. Es wäre aufschlussreich, diesen Bruch detailliert zu untersuchen und nachzuweisen. Neu ist auch, dass der Western nun das Thema Sex und Gewalt – an das in ›The Outlaw‹ noch kein Gedanke verschwendet wird – in Besitz nimmt, unübersehbar z. B. in ›Forty Guns‹ (Samuel Fuller, USA 1957), und Vergewaltigung leitet ›Last Train from Gun Hill‹ (John Sturges, USA 1959) ein, einen Film, in dem ein lapidares Resumee gezogen wird: »The human race stinks«.
›Man in the Shadow‹ (Jack Arnold, 1957) ist ein Hybrid aus Krimi und Western; der Sheriff fährt Buick und tippt Schreibmaschine, der mächtige Rancher umgibt sich mit zeitgenössischem Hochsicherheitsaccessoire, u. a. einem zähnefletschenden German shepherd. Probleme von Herrschaft und Demokratie treten so offensichtlich zutage, dass man sich fragt, weshalb sie bis heute gänzlich unverändert fortbestehen.
Produktive Jahrhundertmitte
Zugegeben, ein Notebook hätte dem Sheriff das Tippen erleichtert und ein Handy hätte das Geschehen beschleunigt, aber neue Technologien lösen keine gesellschaftlichen Probleme. Aber nett. Sofern man über Schwarzweiß und ein Übermaß an musikalischem Beiwerk hinwegsieht.
Die vierziger, die fünfziger und noch die sechziger Jahre sind höchst produktiv, liefern aber alles in allem mehr Quantität als Qualität, und angesichts einzelner Anleihen aus der japanischen Samurai/Ronin-Tradition – ›Die glorreichen Sieben‹ (John Sturges, USA 1960) sind eine Adaption von Akira Kurosawas ›Die sieben Samurai‹ (Japan 1954) – wirkt das Genre hilf- und orientierungslos.
Neue Tendenzen
Kritik an den Klischees des eigenen Genres und Ironie begegnen uns wieder in den Italo-Western der frühen sechziger Jahre, europäische Filmproduktionen, die an die positiven Traditionen anknüpfen und das Genre relaunchen, verbunden jedoch mit einer Brutalisierung des Genres. Gegen Ende der Sechziger hat man den Eindruck, das Genre fasere aus, es tritt mit Terence Hill und Bud Spencer als ein Vorläufer der ›Spaßgesellschaft‹ so infantil auf, als wolle es sein eigener Totengräber sein.
›Barquero‹ (Gordon Douglas, USA 1970) zieht Spannung aus einer schrägen Figurenkonstellation mit Lee van Cleef als Fährmann und einer Horde Banditen, denen er die Überfahrt mit der Fähre verwehrt – die Fähre verbleibt am anderen Ufer –, wodurch eine eigenwillige Handlungsstruktur entsteht. In Kid Vengeance (Joe Manduke, USA 1977) wird ein Kind zum Racheengel, der Western bemüht emotional anrührende neue Motive – ›human interest‹ wird vom Boulevard abgekupfert – und führt darüber hinaus ein kaltblütiges Vergnügen am Töten vor, dazu gibt’s rohe Sexualität inklusive Vergewaltigung.
Anpassungsfähig, wandlungsfähig, stabil
 Das Genre erweist sich als wandlungsfähig und höchst lebendig, indem es sich atmosphärische Tendenzen der Zeit einverleibt. Wir stoßen immer wieder auf ernstzunehmende Produktionen wie ›Unforgiven‹ (Emanzipation/ Clint Eastwood, USA 1992), ›Brokeback Mountain‹ (Homosexualität/ Ang Lee, USA/ Kanada 2005), ›Django Unchained‹ (Rassismus/ Quentin Tarantino, USA 2012).
Das Genre erweist sich als wandlungsfähig und höchst lebendig, indem es sich atmosphärische Tendenzen der Zeit einverleibt. Wir stoßen immer wieder auf ernstzunehmende Produktionen wie ›Unforgiven‹ (Emanzipation/ Clint Eastwood, USA 1992), ›Brokeback Mountain‹ (Homosexualität/ Ang Lee, USA/ Kanada 2005), ›Django Unchained‹ (Rassismus/ Quentin Tarantino, USA 2012).
Demgegenüber bleibt in Japan die Tradition der Samurai/Ronin-Filme ungebrochen; die TV-Serie ›Zatoichi‹ lief mit großem Erfolg seit den sechziger Jahren bis zum Ableben des Hauptdarstellers in den frühen neunziger Jahren. ›Zatoichi, der blinde Samurai‹, eine herrlich ironische Zugabe, wurde als Kinofilm 2003 von Takeshi Kitano inszeniert. Die Tradition des Western ist, wie wir sehen, trotz aller Barrieren global zuverlässig verwurzelt, sie tritt in Japan in vertrauter nationaler Eigenart auf, wir dürfen neugierig bleiben.
Reinschauen
| Thomas Klein: Geschichte – Mythos – Identität. Zur globalen Zirkulation des Western-Genres
Im TITEL kulturmagazin