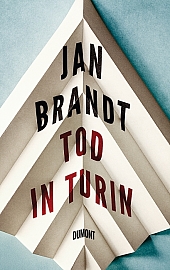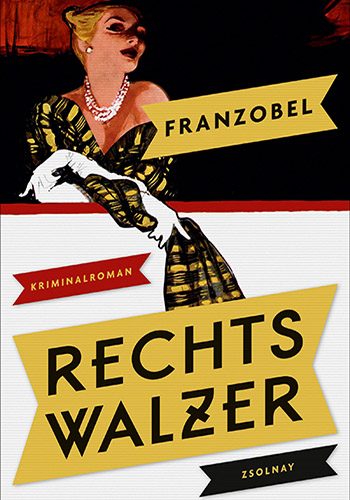Roman | Milan Kundera: Das Fest der Bedeutungslosigkeit
Milan Kundera zeigt in seinem neuesten Roman ›Das Fest der Bedeutungslosigkeit‹, dass er dem Ruf, einer der bedeutensten zeitgenössischen Romanciers Europas zu sein, mehr als gerecht wird. Die Erkenntnisse, an denen er VIOLA STOCKER teilhaben ließ, zeugen von großer Weisheit und Gleichmut des Alters. All der Zorn, der ihn als Ausgeschlossenen verfolgt hatte, scheint verflogen und seine traurige Komik gipfelt im Bild des französischen Bauern Stalin, der es nicht mag, wenn Genosse Kalinin Statuen französischer Königinnen anpinkelt.
 Kundera verflicht kunstvoll einzelne Handlungsstränge miteinander. Es sind Geschichten leisen und traurigen Scheiterns von Menschen, die sich nur flüchtig kennen und einander begegnen, dann wieder auseinandergehen, ohne dass die Begegnung etwas bewirkt hätte.
Kundera verflicht kunstvoll einzelne Handlungsstränge miteinander. Es sind Geschichten leisen und traurigen Scheiterns von Menschen, die sich nur flüchtig kennen und einander begegnen, dann wieder auseinandergehen, ohne dass die Begegnung etwas bewirkt hätte.
Interessant ist dabei, dass die einzelnen Figuren zwar auf einem intellektuell hohen Level konversieren, die prägenden Erfahrungen aber immer banal und bedeutungslos sind. Als wollte Kundera darauf hinweisen, dass unser ganzes Wissen und die universitäre Vorbildung uns nicht davon abhalten können, nichts zu verstehen.
Bescheidene Philosophie und tiefes Mitgefühl
Damit reiht Kundera sich in den illustren Reigen der Kritiker unserer wissensversessenen und humorlosen Gesellschaft ein. Sokrates bekannte, nichts zu wissen und Kant hatte die reine Vernunft kritisiert. Es ist nur logisch, dass Alain, Ramon, Charles, Caliban und D’Ardelo sich auf einem ›Das Fest der Bedeutungslosigkeit‹ wieder treffen, zu dem jeder nur halb widerwillig geht, um eine alternde französische Schönheit zu treffen, deren einziges Verdienst am Abend darin besteht, eine Feder auf ihrem Zeigefinger landen zu lassen. In einer unerträglichen Leichtigkeit des Seins verlässt sie daraufhin den Abend.
Ramon und D’Ardelo sind Kollegen, beide emeritierte Dozenten und bereit, einander in leeren Worthülsen zu übertreffen. Ramon sagt einer Geburtstagsparty D’Ardelos aus schlechtem Gewissen zu, nachdem D’Ardelo ihm offenbart hat, dass er an Krebs erkrankt ist. Pikantes Detail: dem ist nicht so und D’Ardelo folgte nur einer tragikomischen Laune. Alle spielen also eine Rolle, nur Caliban, der Schauspieler, hat kein Engagement. Ein einziges Mal gab er den Caliban in Shakespeares Sturm, seitdem arbeitet er als Aushilfskellner für Charles, der Stalins Witze liebt und einen Cateringservice betreibt. Aus Frustration über die Humorlosigkeit der Gesellschaft haben Charles und Caliban eine Sprache erfunden, die sie für Pakistanisch ausgeben und in der sie sich auf Gesellschaften unterhalten.
Am Nabel der Welt
Derweil grübelt Alain über den Bauchnabel der Frauen als erotisches Symbol unserer Zeit und kann nicht akzeptieren, dass seine Mutter ihn als kleinen Jungen verlassen, abgenabelt hat. Er fühlt sich schuldig am Scheitern seiner Familie und verpflichtet, das Handeln seiner Mutter für ihn durch eine erdachte Geschichte plausibel zu machen. In langen Konversationen mit einer Fotografie seiner Mutter kreist er um das ewig gleiche Thema, ohne den Nabel der Welt zu ergründen. Er wünscht sich einen Engel, der ihn, den Entschuldiger, rettet.
Charles, der an seine kranke Mutter denkt, erfindet ebenfalls einen Engel für ein erdachtes Theaterstück, doch es ist Caliban, der, in eine abstruse Konversation mit einem portugiesischen Dienstmädchen versunken, seinen Engel wirklich findet. Die Schöne scheint Calibans Pakistanisch zu verstehen. Doch das Mädchen lässt sich nicht küssen, es ist keusch, engelsgleich und nabellos und Caliban und Charles suchen Alain auf, um ihren Frust in einer Flasche Armagnac zu ertränken. Nun verbinden sich die Handlungsstränge. Caliban fällt und schlägt auf, Stalin schlägt mit der Faust auf den Tisch, ein Engel fällt und Kalinin jagt, von endlosem Harndrang und Stalin verfolgt, durch die Stadt.
Ein Ende im Grünen
Alle Freunde und Bekannten treffen sich verkatert nach der Cocktailparty im Jardin du Luxembourg wieder. Alain spricht mit seiner imaginären Mutter, Ramon fürchtet die Menschenschlange vor dem Museum, Charles ist zu seiner Mutter gefahren, die im Sterben liegt, statt eines Engels ist Caliban vom Stuhl gefallen und sie begegnen dem scheins todkranken D’Ardelo. Statt Chagall im Museum zu sehen, dessen religiös und transzendent anmutende Bilder Charles‘ Engeln sehr nahe kommen, machen sie einen Spaziergang im Park.
Kinder feiern ein Fest, das niemand kennt, als plötzlich ein schnauzbärtiger Jäger einen spitzbärtigen Herrn durch den Park jagt. Ein Dorfcasanova und letzter Republiktreuer, der nicht möchte, dass ein alter Mann vor den Königinnen Frankreichs uriniert? Oder Stalin, der seinen alten getreuen Gefährten wie ein Gespenst immer noch durch die Bürgerlichkeit der französischen Gesellschaft sprengt? Ein Kinderchor vervollkommnet eine absurde und surrealistische Szenerie, in der Kundera als selbstgewählte Gottheit noch einmal in aller Leichtigkeit in seinem Grundthema schwelgt: der Bedeutungslosigkeit.
Titelangaben
Milan Kundera: Das Fest der Bedeutungslosigkeit
Aus dem Französischen von Uli Aumüller
München: Carl Hanser Verlag 2015
144 Seiten. 16,90 Euro
Reinschauen
| Leseprobe