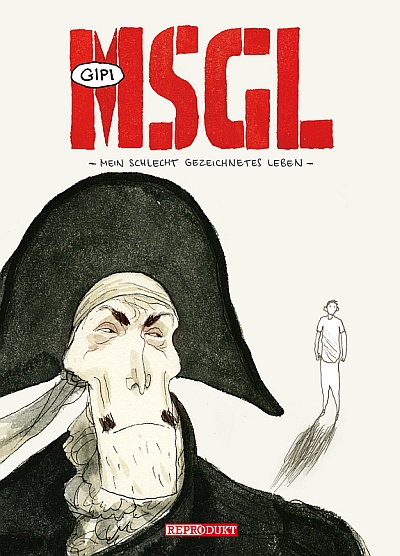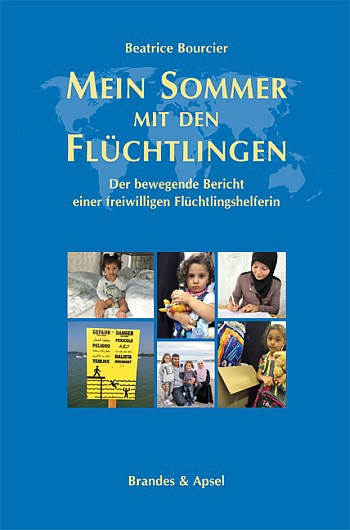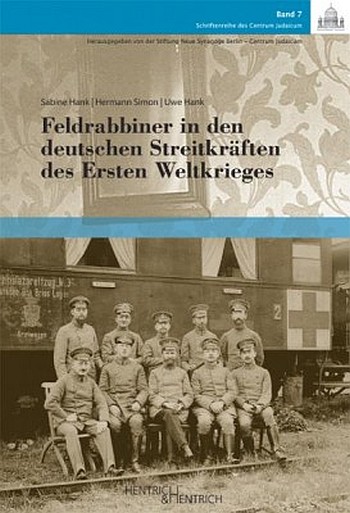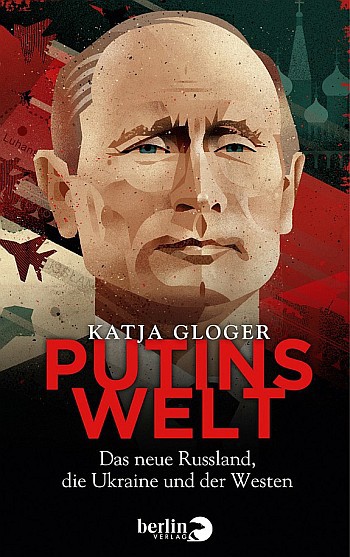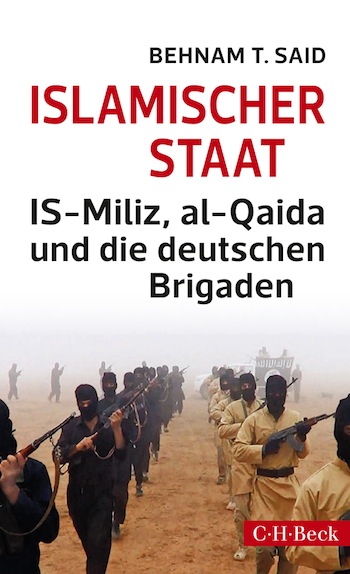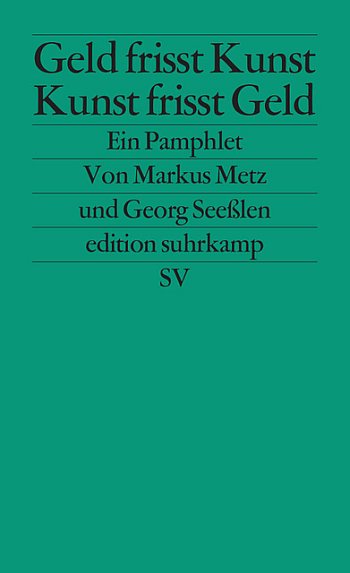Gesellschaft | Tahar Ben Jelloun: Der Islam, der uns Angst macht
Die Ereignisse vom 7. Januar 2015 in Paris haben alle französischen Intellektuellen erschüttert, besonders tief aber diejenigen, die aus der islamischen Kultur Nordafrikas kommen und schon lange im französischen Leben eingewurzelt sind. Tahar Ben Jelloun hat nicht erst mit dem Anschlag auf ›Charlie Hébdo‹ angefangen, über den Islam und den Westen nachzudenken, wie ›Der Islam, der uns Angst macht‹ belegt. Von PETER BLASTENBREI
 Der Band stellt elf Texte Ben Jellouns aus den Jahren seit 2012 zusammen. Abgesehen vom titelgebenden Aufsatz, der mit 42 Seiten ein Drittel des Buches ausmacht, umfassen die Beiträge, die für verschiedene Zeitungen wie ›Libération‹, ›Le Monde‹ oder ›La Repubblica‹ und Anthologien geschrieben wurden, jeweils nur wenige Seiten. Anlässe waren durchweg gewalttätige Ausschreitungen von radikalisierten Muslimen wie der Anschlag auf die jüdische Schule in Toulouse 2012, der Anschlag auf das Jüdische Museum in Brüssel 2014, die Attentate vom 7. Januar oder auch allgemeiner die Ausbreitung des IS in Syrien und Irak.
Der Band stellt elf Texte Ben Jellouns aus den Jahren seit 2012 zusammen. Abgesehen vom titelgebenden Aufsatz, der mit 42 Seiten ein Drittel des Buches ausmacht, umfassen die Beiträge, die für verschiedene Zeitungen wie ›Libération‹, ›Le Monde‹ oder ›La Repubblica‹ und Anthologien geschrieben wurden, jeweils nur wenige Seiten. Anlässe waren durchweg gewalttätige Ausschreitungen von radikalisierten Muslimen wie der Anschlag auf die jüdische Schule in Toulouse 2012, der Anschlag auf das Jüdische Museum in Brüssel 2014, die Attentate vom 7. Januar oder auch allgemeiner die Ausbreitung des IS in Syrien und Irak.
Alle Texte hier kreisen um einige wenige, sich ständig, fast monomanisch wiederholende Fragen. Wie war das möglich? Was waren das für Leute? Ist der Islam überhaupt mit dem Westen kompatibel? Ist er per se gewalttätig? Hat am Ende die europäische Islamophobie Berechtigung? Was kann getan werden?
Die Antworten sind leider oft vage genug formuliert, Teile von Argumentationen finden nicht zusammen. Vieles bleibt daher oberflächlich und unbefriedigend, einigen wenigen tiefer gehenden Fragen weicht der Autor sogar aus. Die Sachinformationen hat man schon oft exakter und detaillierter gelesen, auch Ben Jellouns Lösungsideen sind wenig originell (Sanierung der Banlieues, bessere Erziehung, Überwachung von Moscheen und Predigern in Frankreich, finanzielle Austrocknung des IS im Nahen Osten).
Ratlos
Hinzu kommt, dass der Autor sich in Ost-Arabien kaum auskennt und auf französische Zeitungsberichte angewiesen ist. Fast unvermeidlich schleichen sich so in Texte zu Vorgängen dort Sachfehler und Fehlurteile ein. Der infernalische Hass, mit dem der Autor Präsident Assad und Vladimir Putin bedenkt, überrascht dennoch – vor allem angesichts des ansonsten ruhigen und zurückhaltenden Tons. Ganz unverständlich bleibt schließlich, wie Raschid Rida (1865-1935), einer der ganz wenigen Araber, die mit europäischen Rassenlehren liebäugelten, auf Ben Jellouns Liste reformistischer Muslime geraten konnte, in der Ali Abd al-Rázik (1887/88-1966), der anerkannte Vater des islamischen Säkularismus, fehlt.
Der Autor vermittelt so den Eindruck eines wohlmeinenden, aber sehr ratlosen Intellektuellen. Eines guten französischen Staatsbürgers und überzeugten Säkularisten, der vor allem »seinen« Islam vor der Beschmutzung durch die Mörder retten will, die sich ständig auf ihn berufen. Und eines frommen Muslims, der nicht weniger seinen Glauben an die fortdauernde universale Tragfähigkeit des laizistischen französischen Gesellschaftsmodells verteidigt. Der daher verzweifelt nach den Motiven der Attentäter forscht und um irgendeine Abhilfe ringt, mit der ganzen moralischen und politischen Komplexität des Problems aber sichtlich überfordert ist.
Die laizistische und intellektuell aufgeschlossene französische Gesellschaft ist Ben Jelloun vielleicht noch mehr neue Heimat geworden als das reale Frankreich, als er 1971 vor dem Polizeiterror in seinem Geburtsland Marokko fliehen musste. Dieses Frankreich nahm ihn gastfreundlich auf, gab ihm Luft zum Arbeiten und Freiheit zum Veröffentlichen und schenkte ihm schnell Anerkennung als Schriftsteller. 1987 erhielt er als erster Autor arabischer Herkunft den Prix Goncourt, die höchste literarische Auszeichnung des Landes, dem seitdem zahlreiche andere Preise gefolgt sind.
Zweimal Islam, zweimal Frankreich
Die spezielle Bindung an das französische Lebensmodell, die sich daraus ergab, ist für dieses Buch zum Problem geworden und erklärt letztlich wohl am besten Ben Jellouns Ratlosigkeit, insofern nämlich, als sie dem Autor offenbar nicht erlaubt, französische Zustände auch nur beiläufig zu kritisieren. Sicher, die Misere der Banlieues mit ihrer Jugendarbeitslosigkeit von 45 Prozent wird erwähnt, mehr aber nicht; ebenso finden sich Reminiszenzen an längst vergangene koloniale Missgriffe. Aber muss man denn wirklich das Unrecht, das Muslime (und doch wohl nicht nur sie) angesichts der Haltung der Regierung Hollande beim Gazakrieg 2014 empfanden, relativieren (»ihrer Meinung nach«, S. 24) ?
Aber es gab und gibt nun leider auch ein anderes Frankreich, eines, das gar nicht gut zu seinen Gästen ist, und das in diesem Weltbild nicht vorkommt. In Ben Jellouns Worten fanden die nordafrikanischen Arbeitsemigranten in Frankreich »kein Paradies« vor (S. 43). Man kann das auch anders ausdrücken: allein im Jahr seiner Ankunft, 1971/72, kamen in diesem Land über 100 algerische Gastarbeiter bei rassistischen Übergriffen um, die meist straflos blieben.
Sollte man also vielleicht nicht einmal probeweise auf griffige Slogans verzichten wie, die Attentäter vom 7. Januar hätten »auf die Freiheit, die Demokratie, auf das Frankreich Voltaires« geschossen (S.9, 27, 121) ? Und sich überlegen, ob die Brüder Kouachi abgedrückt hätten, wenn sie das Frankreich Voltaires nicht nur aus Schulbüchern gekannt hätten. Oder ob sie nicht eigentlich auf die vielen Le Pens geschossen haben, auf die pieds-noirs mit den Zielfernrohren, die ihre Eltern peinigten, und auf ein offizielles Frankreich, dem dies alles bisher so herzlich egal war.
Titelangaben
Tahar Ben Jelloun: Der Islam, der uns Angst macht
Deutsch von Christiane Kayser.
Berlin: Berlin Verlag, 2015.
128 Seiten, 10,00 Euro