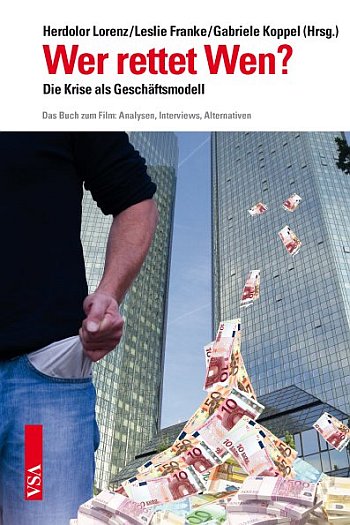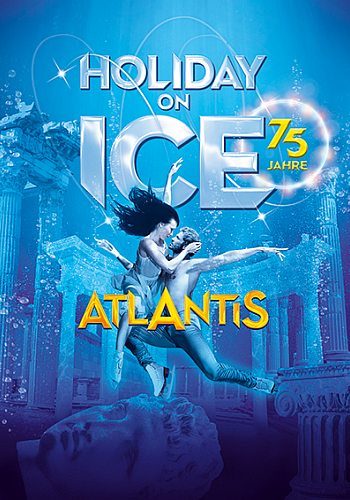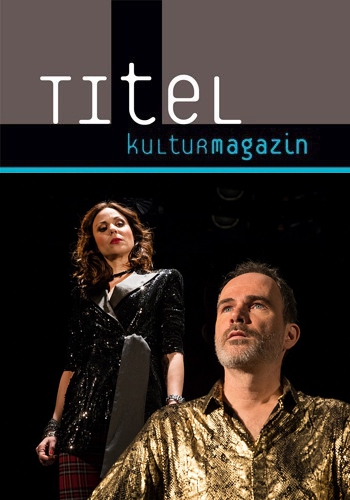Kulturbuch | Rafael Ugarte Chacón: Theater und Taubheit
Das Theater ist nicht nur ein Ort der Kritik, sondern auch ein Ort der Herrschaftsproduktion! Das Theater ist nicht nur ein Ort der Reflexion, sondern auch ein Ort der Hierarchierepräsentation! Ergo werden kontinuierlich diverse soziokulturelle Gruppen durch die Darstellungsformen exkludiert. Der Theaterwissenschaftler Rafael Ugarte Chacón versucht deswegen in seiner Dissertation für die Gruppe der Gehörlosen auszuloten, inwiefern sie vom Theaterbetrieb ausgeschlossen werden und mit welchen theatralen Formen und Methoden man ihnen Zugang gewähren kann. Sein normatives Konzept heißt ›Aesthetics of Access‹. PHILIP J. DINGELDEY hat Ugarte Chacóns Monographie ›Theater und Taubheit. Ästhetiken des Zugangs in der Inszenierungskunst‹ zu einem Randphänomen der Theaterwissenschaft, das doch einen universellen Integrationsanspruch vertritt, gelesen.
 Als Randphänomen erscheint es zunächst. da nur etwa 0,1 Prozent der Bevölkerung in Deutschland von der Gehörlosigkeit betroffen sind. Zwar nennt – zwecks Alliteration – der Titel des Buches den Terminus »Taubheit«, doch dies ist eine Vokabel, die Ugarte Chacón negiert, so wie viele davon Betroffene auch. Er präferiert daher den Begriff »Gehörlosigkeit«, da Taubheit ein diskriminatorisches Wort sei und eine degradierende Behinderung impliziert, obwohl sich viele Gehörlose selbst nicht als behindert auffassen, sondern als Teil einer speziellen soziokulturellen Minorität mit spezifischen Kommunikationsmitteln und Riten. Denn generell zeichnet sich die Doktorarbeit durch einen starken Fokus auf sprachlich-politische Korrektheit aus, jedoch ohne so zu tun, als ob dadurch alle Formen der Diskriminierung beseitigt wären.
Als Randphänomen erscheint es zunächst. da nur etwa 0,1 Prozent der Bevölkerung in Deutschland von der Gehörlosigkeit betroffen sind. Zwar nennt – zwecks Alliteration – der Titel des Buches den Terminus »Taubheit«, doch dies ist eine Vokabel, die Ugarte Chacón negiert, so wie viele davon Betroffene auch. Er präferiert daher den Begriff »Gehörlosigkeit«, da Taubheit ein diskriminatorisches Wort sei und eine degradierende Behinderung impliziert, obwohl sich viele Gehörlose selbst nicht als behindert auffassen, sondern als Teil einer speziellen soziokulturellen Minorität mit spezifischen Kommunikationsmitteln und Riten. Denn generell zeichnet sich die Doktorarbeit durch einen starken Fokus auf sprachlich-politische Korrektheit aus, jedoch ohne so zu tun, als ob dadurch alle Formen der Diskriminierung beseitigt wären.
Aethetics of Access
Das Werk ist in fünf Hauptkapitel und mehrere Unterkapitel unterteilt. Nach einer Einleitung zu definitorischen und methodischen Belangen konzipiert er seine ›Aesthetics of Access‹, indem er, anhand der Faktoren Körper, Macht und Kultur und mit Rekurs auf die poststrukturalistischen Philosophen Michel Foucault und Judith Butler, elaboriert, wie Gehörlose, durch ihre eingeschränkte Sinneswahrnehmung der Zugang zu Theater und Gesellschaft verwehrt bleibt, beziehungsweise wie sie per se zu einer isolierten Gruppe generiert werden, einerseits durch Exklusion, andererseits durch eine esoterische Gebärdensprache und Gehörlosenkultur. Ugarte Chacón hat dabei den Anspruch gleichermaßen Ästhetik und inklusive Akzeptanz untersuchen zu wollen, um das ästhetische Niveau in der Inklusion aufrechtzuerhalten.
Im Folgenden untersucht er gedolmetschte und zweisprachige Aufführungen. Dazu hat sich der Autor in den Jahren 2010 bis 2012 europäische und nationale Theaterfestivals, zu denen Gehörlose explizit Zugang bekommen sollten und die auch von und mit Gehörlosen inszeniert wurden, angesehen, etwa das Deutsche Gebärdensprachtheater-Festival in München oder das internationale Gehörlosentheaterfestival in Wien. Das Problem dieser Methode ist, dass er, wie ein Kulturjournalist, auf subjektive Notizen und Erinnerungen angewiesen ist, und ergo die Wissenschaftlichkeit und Intersubjektivität der Arbeit partiell verloren geht. Vereinzelte Aufführungen werden von ihm zusammengefasst und dann unter den Aspekten Integration und Ästhetik untersucht.
Integrative Kunstimpulse
Hierbei stellt er fest, dass für Hörende oder Gehörlose gedolmetschte Aufführungen primär drei Probleme aufwiesen: Erstens stigmatisiere das jeweils die Gruppe, die auf die Übersetzung, in Form von Leinwandschriften oder menschlichen Übersetzern angewiesen sind. Zweitens erschwere der häufige Blickwechsel zwischen Inszenierung und Übersetzung das reibungslose Folgen und Reflektieren des Geschehens. Und drittens würden hier keine eigenen dramatisch-inklusive Inszenierungsformen kreiert werden, sondern nur die normalen Aufführungen um eine Übersetzung ergänzt werden. Auch zweisprachigen Aufführungen sei meist schwer zu folgen, zuweilen ähnelten sie eher Performance-Lesungen oder das ästhetische Niveau sei gering.
Eine potenzielle Lösung sieht er im fünften Part der Arbeit, der sich visuellen Theaterformen widmet, nämlich dem ›Physical Theatre‹, multimedialen Performances und dem Gehörlosentheater. Hierbei sollen nicht nur verschiedene Medien zum Einsatz kommen, sondern auch durch textlose Darstellungs- und Ausdrucksformen der inszenierten Körper Handlungsabläufe für Hörende und Gehörlose gleichermaßen verständlich sein. Fraglich bleibt hier jedoch, ob mit dieser Methodik, bis auf, zugegeben, viele Ausnahmen sich das ästhetische Niveau dauerhaft halten lässt.
In Relation zu dieser differenzierten Sicht auf das Theater von und/oder für Gehörlose, erscheint sein Fazit fast emphatisch, denn jede Produktion, die nicht als rein gedolmetschte Aufführung klassifizierbar sei, habe »in Form ihrer je eigenen Ausgestaltung einer ›Aethetics of Access‹ neue Impulse für die Kunst […] [geliefert], die von herkömmlichen Integrationsmaßnahmen und ›cultural performances‹, die lediglich auf einer nachträglichen Verdolmetschung bereits bestehender Inszenierungen aufbauen, nicht zu erwarten sind« . Dies wirkt ein bisschen naiv, legt doch die Dissertation an vielen Stellen eine eher ernüchterte Perspektive wahr, die die momentanen Grenzen der Integration von Gehörlosen im Theater aufzeigen.
Dennoch ist Ugarte Chacón insofern Recht zu geben, als dass es notwendig ist, auch für Gehörlose und andere Betroffene von sogenannten Behinderungen, adäquate Theaterformen zu entwickeln, die diese und sogenannte nicht Behinderte integriert und damit Kunst, Kultur und Wissenschaft kleinräumig aufsprengen.
Titelangaben
Rafael Ugarte Chacón: Theater und Taubheit. Ästhetiken des Zugangs in der Inszenierungskunst
Bielefeld: Transcript Verlag 2015
344 Seiten, 39,99 Euro
Erwerben Sie dieses Werk als eBook bei Osiander
Reinschauen
| Leseprobe