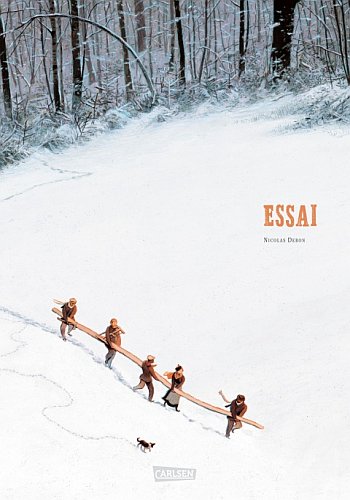Bühne | Mozarts ›Die Hochzeit des Figaro‹. Stadttheater Pforzheim
Eines der großen Themen unserer Zeit, mit dem sich unzählige Theaterstücke, Opern, Filme, Serien und auch einige Veranstaltungsformate, regional und überregional − sowie das Leben selbst – auseinandersetzen, ist die Liebe. Diese ist, sowohl in der gesellschaftlichen Realität als auch in der künstlerisch dargebotenen Inszenierung, immer wieder von Hindernissen, Verwirrungen und auch Intrigen durchwoben. Von JENNIFER WARZECHA
 Gerade die Inszenierung von Wolfgang Amadeus Mozarts‘ (1756-1791) weltberühmter und beliebter Opera buffa, im Geiste der Commedia dell‘ Arte, ›Die Hochzeit des Figaro‹ mit dem Libretto von Lorenzo da Ponte, wirkt immer wieder und stets aufs Neue magisch, erotisch und faszinierend.
Gerade die Inszenierung von Wolfgang Amadeus Mozarts‘ (1756-1791) weltberühmter und beliebter Opera buffa, im Geiste der Commedia dell‘ Arte, ›Die Hochzeit des Figaro‹ mit dem Libretto von Lorenzo da Ponte, wirkt immer wieder und stets aufs Neue magisch, erotisch und faszinierend.
Zeugen doch Libretto und Musik bei dieser Opern-Inszenierung geradezu von »unerschöpflicher Vielschichtigkeit«, wie schon das Programmheft zu der Pforzheimer Premiere – unter der Regie von Caroline Stolz, der Choreografie von Edoardo Novelli, unter der musikalischen Leitung von Mino Marani und der Choreinstudierung von Carl Philipp Fromherz, mit Mónica Presno am Cembalo – verrät.
Und vielschichtig ist das Werk schon allein aufgrund dessen Koketterie und Komik, wie sie traditionell für die Commedia dell‘ Arte typisch ist. Gerade Cherubino (stimmlich ausdrucksstark, fest und gewaltig, vom Eindruck her aber fast schon süß: Danielle Rohr) schaut immer wieder verzweifelt bzw. geradezu ängstlich, wenn er von den Damen wie der Contessa d‘ Almaviva, also der Gräfin und damit der weiblichen Hauptrolle, (überzeugt sowohl durch ihre geradezu feministische Haltung und damit verbundene Würde, Grazie und Ausstrahlung, genauso wie durch ihre souveräne Stimmlage: Silvia Micu) oder Susanna (einfach stark in selbstbewusstem Mienenspiel und souveräner Haltung und Gestik: Franziska Tiedtke) umschwärmt wird.
 Geradezu komisch wirkt es, wenn er jeweils einer der Damen mit unbeholfenem Gesichtsausdruck unter den Rock schaut – denn Cherubino wird von einer Dame (Danielle Rohr), nicht von einem Mann, verkörpert. Gerade das steht für die Typenhaftigkeit der Figuren, die damit nicht individuelle Charaktere und deren Eigenschaften, sondern generelle Verhaltensweisen aller Menschen markieren.
Geradezu komisch wirkt es, wenn er jeweils einer der Damen mit unbeholfenem Gesichtsausdruck unter den Rock schaut – denn Cherubino wird von einer Dame (Danielle Rohr), nicht von einem Mann, verkörpert. Gerade das steht für die Typenhaftigkeit der Figuren, die damit nicht individuelle Charaktere und deren Eigenschaften, sondern generelle Verhaltensweisen aller Menschen markieren.
Gewissermaßen läuft jeder Mensch je nach Kontext Wollust oder Gefahr, sich der Erotik und Leidenschaft fast schon zu sehr hinzugeben und in einem privaten Beziehungskonflikt aus mehreren Beteiligten, bei dem immer mindestens einer leer ausgeht bzw. von Eifersucht geplagt wird, zu enden.
Reinheit und Verführung wechseln sich ab
So ist die Fabel eines der Meisterwerke Mozarts, die die einzelnen Handlungsstränge des Vierakters bilden, auch rasch erzählt: Figaro und Susanne wollen heiraten, doch der Graf möchte im Sinne des damals üblichen Herrenrechts, die erste Nacht mit Bediensteten zu verbringen, zuerst mit Susanna schlafen. Eine damals übliche Sitte, die Mozart zusammen mit dem Feudalrecht mit der Aufführung der Oper kritisierte. Die Gräfin ist natürlich gegen dieses vermeintliche Vorrecht. Sie und Susanna schmieden ein Komplott und am Ende hat man als Zuschauer den Eindruck, dass irgendwie jeder etwas mit jedem hat.
 Dies ist zwar üblich für eine Verwechslungskomödie, für den Zuschauer im fast bis auf den letzten Platz gefüllten Großen Haus des Stadttheaters mitunter aber etwas verwirrend. Einziger Wermutstropfen für eine ansonsten grandiose und farbenprächtige Inszenierung mit dem Bühnenbild von Jan Hendrik Neidert und den Kostümen von Lorena Díaz Stephens. Sie überzeugt gerade durch die weißen Fächer, die von vermeintlicher Reinheit sprechen und die spanische Umgebung Andalusiens ausdrücken. Die Fächer selbst stehen für Weiblichkeit, Verführungskraft und Koketterie sowie für Schließung und Entfaltung – Themen, die auch nach Premiere und Aufführung vielfach die Menschen bewegen, sie mitunter entzweien oder verbinden werden.
Dies ist zwar üblich für eine Verwechslungskomödie, für den Zuschauer im fast bis auf den letzten Platz gefüllten Großen Haus des Stadttheaters mitunter aber etwas verwirrend. Einziger Wermutstropfen für eine ansonsten grandiose und farbenprächtige Inszenierung mit dem Bühnenbild von Jan Hendrik Neidert und den Kostümen von Lorena Díaz Stephens. Sie überzeugt gerade durch die weißen Fächer, die von vermeintlicher Reinheit sprechen und die spanische Umgebung Andalusiens ausdrücken. Die Fächer selbst stehen für Weiblichkeit, Verführungskraft und Koketterie sowie für Schließung und Entfaltung – Themen, die auch nach Premiere und Aufführung vielfach die Menschen bewegen, sie mitunter entzweien oder verbinden werden.
Nicht zuletzt stehen die Figuren selbst für „menschliche Wesen mit Herz und Seele, mit Leidenschaften und Begierden“, wie es ebenfalls das Programmheft schildert. Und eben das Leben selbst. Die Kostüme sind edel und bunt, wie das Leben, dargestellt in der Komödie, auch ist. Auch das Weiß der Frauenkleider steht wie das Weiß der Fächer für Reinheit, so rein, wie das Leben scheinbar von seinen Verführungen her nicht ist. Insgesamt einfach grandios und vielschichtig, fürwahr.
| JENNIFER WARZECHA
| FOTOS: SABINE HAYMANN
Titelangaben
Die Hochzeit des Figaro
Oper von Wolfgang Amadeus Mozart
Theater Pforzheim
Regie — Caroline Stolz
Musikalische Leitung — Mino Marani
Inszenierung — Caroline Stolz
Bühnenbild — Jan Hendrik Neidert
Kostümbild — Lorena Diaz Stephens
Dramaturgie — Thorsten Klein
Termine
Dienstag, 01.11.2016: Beginn: 20:00
Donnerstag, 10.11.2016: Beginn: 20:00
Sonntag, 20.11.2016: Beginn: 15:00
Samstag, 26.11.2016: Beginn: 19:30
Sonntag, 04.12.2016: Beginn: 15:00
Dienstag, 20.12.2016: Beginn: 20:00
Freitag, 23.12.2016: Beginn: 19:30
Donnerstag, 12.01.2017: Beginn: 20:00
Mittwoch, 25.01.2017: Beginn: 20:00
Sonntag, 12.02.2017: Beginn: 15:00
Mittwoch, 01.03.2017: Beginn: 20:00
Sonntag, 26.03.2017: Beginn: 19:00