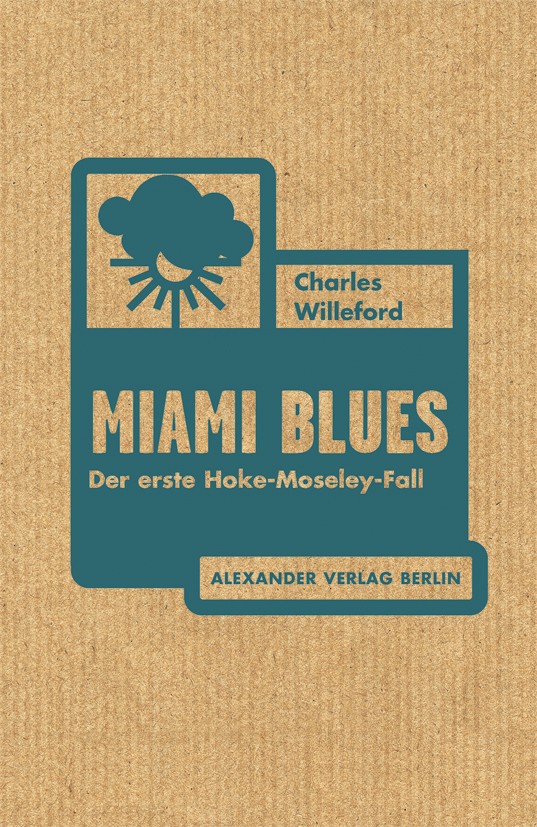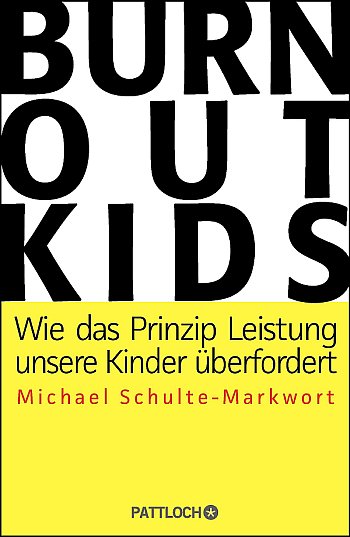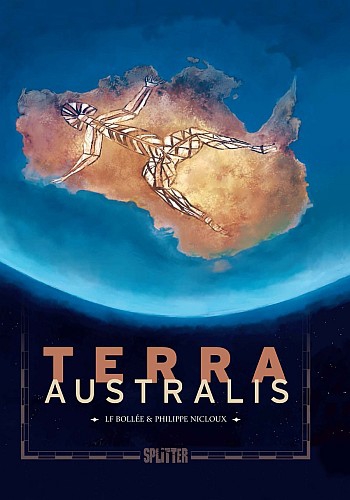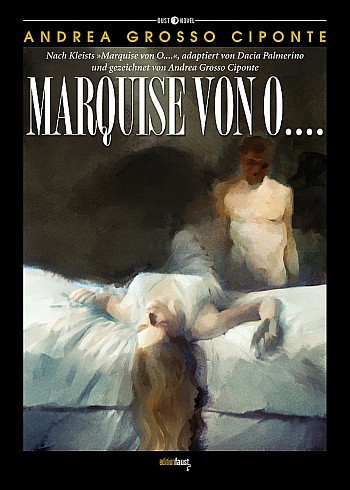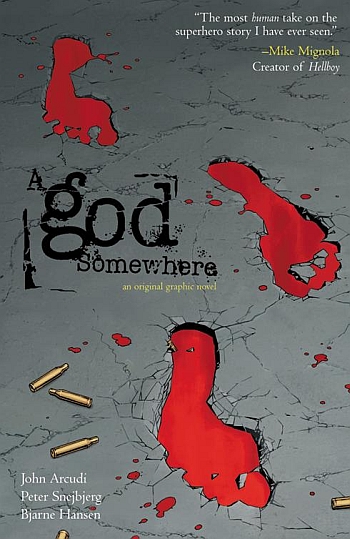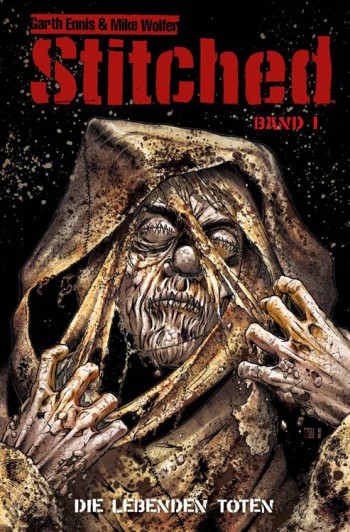Comic | Andy Diggle (Texte), Jock (Zeichnungen): Green Arrow. Das erste Jahr
Eigentlich inspiriert die Geschichte von Robin Hood, der von den Reichen nimmt und den Armen gibt, nur noch Kinder. 1941 schufen jedoch Mort Weisinger und George Papp den Comic-Superhelden »Green Arrow«, der, nach dem Exempel von Robin Hood, mit Pfeil und Bogen bewaffnet, das Böse in Form von Kriminellen mit Schusswaffen, spielend leicht besiegt. Dies führte auch zur prominenten Adaption des Helden in der neueren US-amerikanischen TV-Serie ›Arrow‹. Von PHILIP J. DINGELDEY
 So verfassten Autor Andy Diggle und Zeichner Jock im Jahr 2007 die Ursprungsgeschichte dieses Protagonisten: ›Green Arrow. Das erste Jahr‹. Dieser Band zur Herkunft eines Superhelden aus dem DC-Multiversum ist einer der berühmtesten und beliebtesten. Jetzt liegt der Comic auch in deutscher Übersetzung vor.
So verfassten Autor Andy Diggle und Zeichner Jock im Jahr 2007 die Ursprungsgeschichte dieses Protagonisten: ›Green Arrow. Das erste Jahr‹. Dieser Band zur Herkunft eines Superhelden aus dem DC-Multiversum ist einer der berühmtesten und beliebtesten. Jetzt liegt der Comic auch in deutscher Übersetzung vor.
Green Arrow ist das Alias von Oliver Queen, einem alkoholkranken Playboy und dekadenten Milliardärssohn, der mit seinem Geld und Leben nichts anzufangen weiß und daher nur den ultimativen Adrenalinkick sucht, ohne Empathie für ärmere Menschen. Schließlich wird er jedoch von seinem Mitarbeiter und Freund, dem ehemaligen Militär Hackett, um 14 Millionen US-Dollar betrogen, verwundet und von Bord seiner Luxusjacht geworfen. Doch Queen überlebt und wacht auf einer scheinbar einsamen Insel auf.
Zunächst weist dieser Topos Elemente einer Robinsonade, eines pseudorousseau´schen Schritts zurück zur unbelasteten Natur auf: Denn nur auf sich gestellt und von anderen Menschen isoliert, muss dieser Bourgeois nun ums Überleben kämpfen. Aus einem verlassenen Dorf kann er sich Trinken besorgen und bastelt sich – aus einer naiven Vorliebe für Robin Hood, der sich bislang diametral zum egomanischen Lebensstil Queens verhält – einen Bogen und mehrere Pfeile, um Nahrung zu jagen. Auch näht er aus einem grünen Segeltuch eine Kapuze zum Sonnenschutz in diesem äquatorialen Territorium, und siehe da: In der natürlichen Isoliertheit fühlt sich dieses Individuum plötzlich glücklich und erfüllt, zurückgeworfen auf die primitiven Überlebenstriebe, auf die pure asoziale Existenz.
Ein Held auf Drogen
Wäre da nur nicht – um es mit Jean-Jacques Rousseau zu formulieren – die Ungleichheiten und Ungerechtigkeit verursachende und zementierende Zivilisation! Denn schon bald entdeckt Queen, dass diese kartographisch unerschlossene Insel von einem riesigen Drogenkonzern beherrscht wird, der die Ureinwohner versklavt hat und dort Heroin anbaut, unter der Leitung von Chien Na-Wie, einer sadistischen Asiatin, die nur in hautengen weißen Kostümen auftritt (weshalb sie von vielen »China White« genannt wird). Für sie arbeitet auch Hackett.
Queen, aufgrund seiner neuen Lebensumstände in seinem Weltbild radikal verändert, hilft natürlich den Sklaven, sich zu befreien, innerhalb der Zentrale des Drogenimperiums die Polizei zu alarmieren und, nach einigen Rückschlägen und schweren Verletzungen, Chien Na-Wei und ihr Kartell zu besiegen – mit einem sauber platzierten Schuss, der die Schurkin und ihre Helfer unter einer Drogenladung begräbt. Daraufhin nennen ihn die Ureinwohner bald Grüner Pfeil, was ihm als Vorlage dienen wird, als Green Arrow in der urbanen Moderne künftig Gangster zu bekämpfen.
Der Comic hat anderen Superheldenstorys einiges voraus: So ist Diggles Green Arrow kein Protagonist mit Superkräften, sondern muss sich erst selbst seine akrobatischen Fähigkeiten und den Umgang mit Pfeil und Bogen aneignen. Dadurch wirkt diese Figur menschlicher als andere Helden. Etwas realistischer wird die Geschichte auch, da Arrow mehrmals schwer verletzt wird und erst von einer Ureinwohnerin verarztet und mit Opium betäubt werden muss.
Actiongeladen, aber banal
Dem entsprechen auch die Zeichnungen von Jock, der nicht nur blutige Actionszenen bunt zu inszenieren versteht, sondern auch bei Protagonisten realistische menschliche Gesichtszüge voller Freude, Schmerz und Verzweiflung darstellen kann. Lediglich Chien Na-Weis Gesicht ist meist ausdruckslos und nur selten aggressiv, was ihre Kaltherzigkeit symbolisieren soll.
Leider machen Diggle und Jock dies partiell wieder kaputt. Ihr Werk ist zwar eine verdichtete Melange aus bombastischer Aktion und romantisierter Identitätskrise, jedoch wird alles nur sehr knapp abgehandelt. Die Kreierung des alter Egos Arrow aus dem dekadenten Oliver Queen, die Rückschläge, die Vulnerabilität und der Kampf gegen das Kartell werden in nur knapp 150 Seiten abgehandelt und verlieren dabei auch an Authentizität. Platz für psychoanalytische oder philosophische Reflexionen bleibt dabei nicht; alle Fragestellungen bewegen sich auf einer banalen Ebene.
Ebenso lässt sich nicht erklären, wie Chien Na-Wei und ihre Mitarbeiter überleben konnten und am Ende festgenommen werden; Jock lässt hier eine Lücke. Auch bleibt es sehr fragwürdig, dass der Held ein reicher, weißer US-amerikanischer Bourgeois ist, der seinen Sinn für den Humanismus entdecken möchte, während die Antagonistin eine extravagante weibliche Asiatin ist, was partiell Frauen und Asiaten pejorativ darstellen könnte und somit das westlich-hegemoniale Weltbild reproduziert – unter dem Deckmantel eines sozialen Heroismus.
Ergo ist ›Green Arrow. Das erste Jahr‹ in multipler Hinsicht ein spezieller Comic, der sich einerseits als authentischer suggeriert als andere Superheldenstorys, aber andererseits viele Schwächen in der banalisierenden Verdichtung und der affirmativen Wirkung bestehender soziokultureller Hegemonien aufweist. Wer jedoch actionreiche Comics mag und vielleicht selbst ein Adrenalinjunkie ist, der wird Diggles und Jocks gut gefülltes Buch lieben.
Titelangaben
Andy Diggle (Texte), Jock (Zeichnungen): Green Arrow. Das erste Jahr
Aus dem Amerikanischen von Marc Schmitz
Stuttgart: Panini Comis 2015
148 Seiten, 14,99 Euro
Erwerben Sie dieses Buch bei Osiander
Reinschauen
| Leseprobe