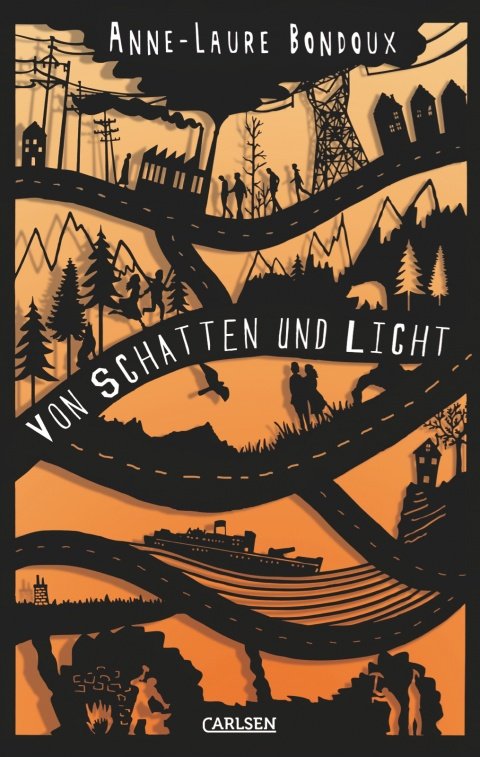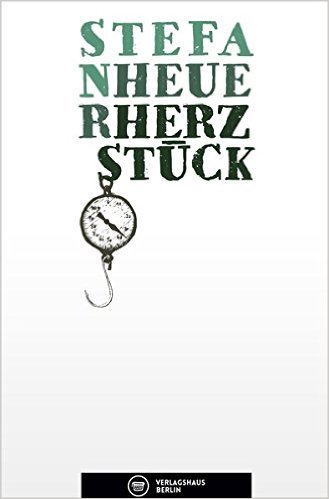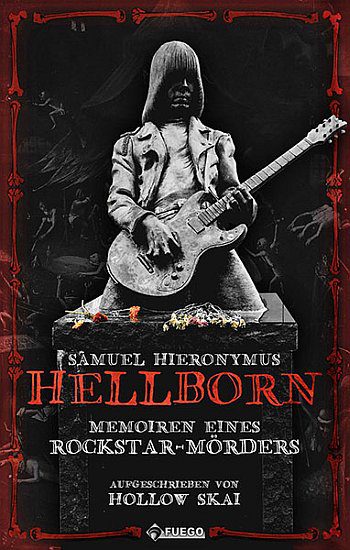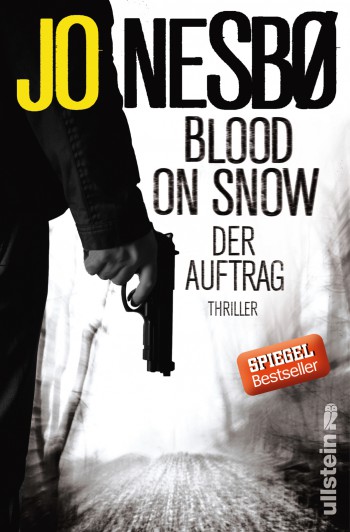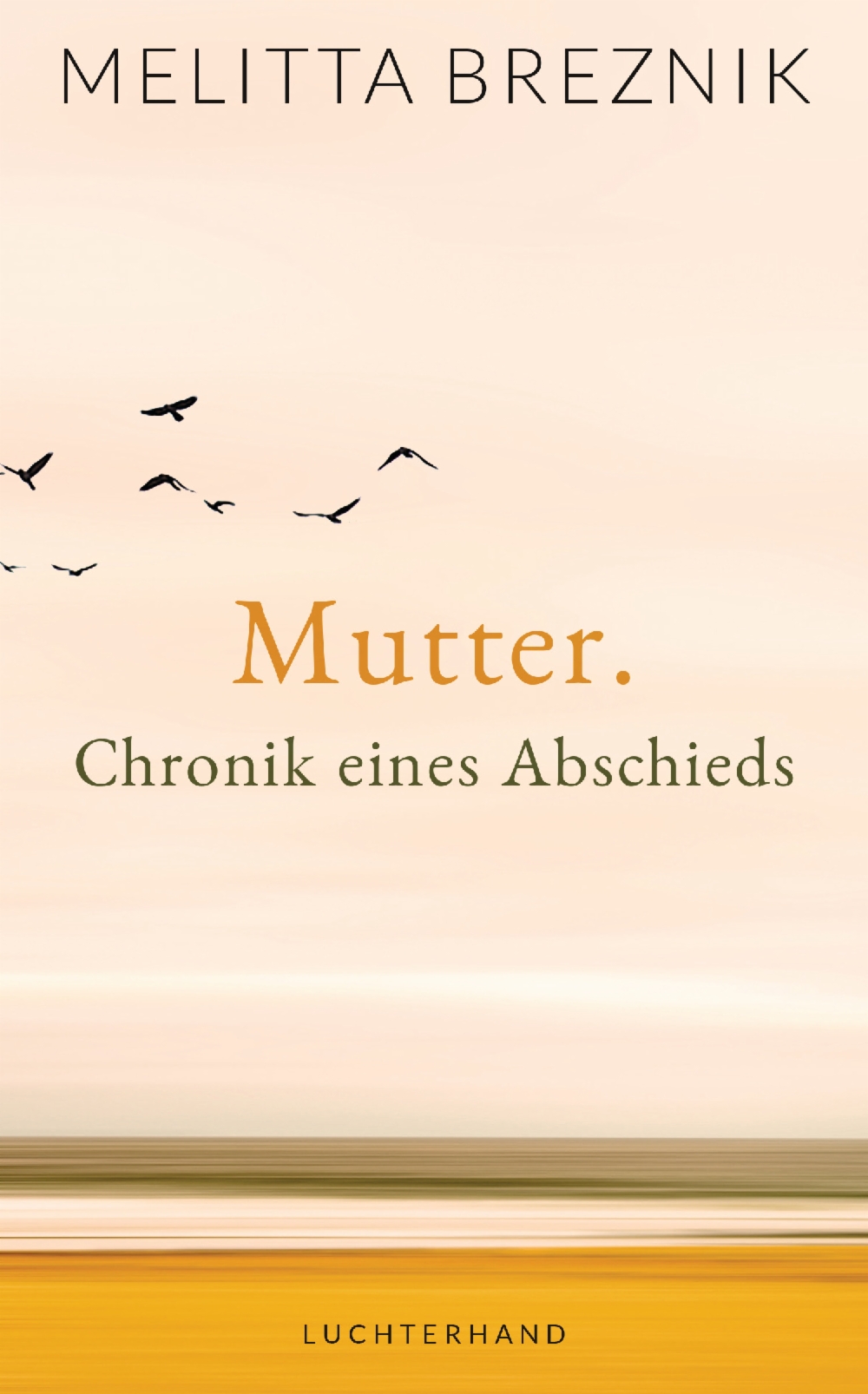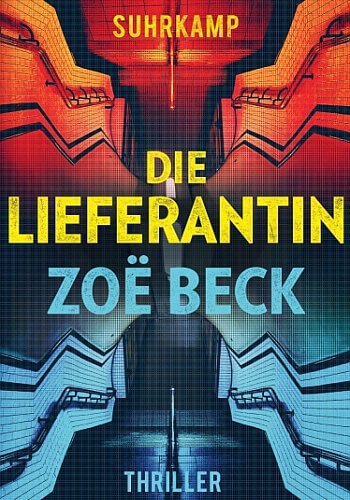Roman | Juli Zeh: Unterleuten
Sie hätte schon immer einen großen Gesellschaftsroman schreiben wollen, hat Juli Zeh jüngst verlauten lassen. Mit ›Unterleuten‹ hat sie sich diesen Wunsch jetzt erfüllt. Obwohl das Buch in der brandenburgischen Provinz spielt, da, wo sich Fuchs und Hase »Gute Nacht« sagen. Seine Helden sind deshalb auch nicht die Entscheider unser aller Zukunft, sondern die kleinen Leute, die mit dem andernorts Entschiedenen zu leben haben. Von denen aber fährt Zehs Roman eine ganze Palette an unterschiedlichen Charakteren auf – nicht immer vollständig klischeefrei, aber durchaus tauglich, die Widersprüche unserer Zeit und Gesellschaft sichtbar zu machen. Von DIETMAR JACOBSEN

Brandenburg im Jahre 2010. Irgendwo zwischen Seelenheil, Wassersuppe, Regenmantel und anderen kleinen Dörfern mit idyllischen Namen liegt der 250-Seelen-Ort Unterleuten. Alteingesessene und Neuzugezogene leben hier zusammen fernab der Hektik Berlins. Es geht nicht immer friedlich zu, aber man arrangiert sich in der Regel miteinander. Bis ein Investor auf den Plan tritt, der am Rande der Gemeinde einen Windpark errichten will. Der klammen Gemeindekasse wäre damit geholfen. Doch damit das Projekt in die Tat umgesetzt werden kann, muss nicht nur der Widerstand von Naturschützern gebrochen werden. Vor allem braucht man eine Fläche, die so groß ist, wie es die staatlichen Vorgaben verlangen. Doch über die verfügt niemand allein.
»Exit Landschaft, enter Windpark«
Windparks sind eine lukrative Angelegenheit – einerseits. Und energiepolitisch im Moment wohl alternativlos. Andererseits verändern sie aber auch die Landschaft. Nicht jeder mag es, wenn die Riesenmühlen ihm den Horizont verstellen. Und jene, die sich im Prinzip dafür aussprechen, weil sie die Energiewende als notwendig erachten, geraten in einen inneren Zwiespalt, wenn ihnen die mehr zweckmäßigen denn schönen Anlagen direkt vor die Nase gesetzt werden. Wie Juli Zeh diesen Zwiespalt erzählerisch umsetzt, ist ausgesprochen raffiniert und nicht ohne bitteren Humor.
Fast 100 Seiten lang lässt die Autorin ihre Leser gleich zu Beginn ihres neuen Romans ›Unterleuten‹ an einer Versammlung teilnehmen, in der den im Saal der Dorfgaststätte vollständig versammelten Einwohnern des Fleckens Sinn, Notwendigkeit und Nutzen eines in unmittelbarer Nähe geplanten Windparks vermittelt werden sollen. Da sitzen sie dann Schulter an Schulter und doch ist der innere Abstand groß. Hier die Alten, deren Konflikte bis weit in die DDR-Zeit zurückreichen und die nur auf einen neuerlichen Anlass, jahrzehntealte Feindschaften wieder aufleben zu lassen, gewartet zu haben scheinen. Da die Neuen – junge, großstadtmüde Menschen voller Idealismus und unbeirrbar in dem Glauben, nun sei endlich ihre Zeit angebrochen. Und dazwischen einer, der mit Brandenburg und Unterleuten eigentlich gar nichts am Hut hat, der sich aber auf einer Bodenauktion just ein Stück jenes Areals als wohlfeiles Spekulationsobjekt gekauft hat, das für den Windpark nun benötigt wird.
Der vorprogrammierte Krieg
Bei solcher Lage der Dinge ist Krieg praktisch vorprogrammiert. Und Zehs Figuren lassen nichts aus, was zur Eskalation der Situation beitragen kann. Alte Feindschaften werden reanimiert. Mit brennenden Autoreifen, versperrten Zufahrten zu Jauchegruben, die dann nicht entleert werden können, alltäglich sich wiederholendem, stundenlangem Grasmähen und anderen mehr oder minder raffinierten Schikanen wird die Stimmung untereinander angeheizt. Ein Kind verschwindet, was den Dorfmob fast zum Amoklaufen bringt. Und als würde noch irgendwer hier durchblicken, wo die Frontlinien in diesem bald auch blutig werdenden Streit verlaufen, glauben die, welche in Unterleuten nichts weniger sehen als ein zukünftiges Paradies auf Erden, die Stunde nutzen zu können, um ihr eigenes egoistisches Süppchen zu kochen.
Am Ende ist von der ländlichen Idylle, die der vom Aussterben bedrohten Schnepfenart der Kampfläufer einen letzten Schutz bietet, wenig übrig. Fast ein wenig zu drastisch lässt Juli Zeh enden, was in ihrem Verständnis und aufgeladen sicher auch mit den eigenen Erfahrungen der seit Jahren mit ihrer Familie auf dem brandenburgischen Land lebenden Autorin eine Art Bestandsaufnahme der Befindlichkeit unserer Epoche sein soll. Sie hat zehn Jahre gebraucht, daraus einen Roman zu machen, in dem auf kleinstem Raum, in einer erzählten Zeit von knapp zwei Monaten und unter Einsatz eines überschaubaren Personals transparent wird, mit welchen Widersprüchen und Problemen wir heute leben müssen.
Der Kunstgriff, aus den wechselnden Perspektiven ihrer Figuren zu erzählen, macht die Geschichte nicht nur abwechslungsreich und amüsant, sondern hilft Zeh auch, die im Gesellschaftsroman klassischer Prägung allwissende Erzählerposition zu vermeiden. Dass die vor dem Leserauge entstehenden Figuren dabei gelegentlich ein wenig schablonenhaft wirken, nimmt sie in Kauf. Die großen Fragen, um die es der Autorin geht, werden trotzdem deutlich. Die Antworten, die das Romanpersonal mit seinem Denken und Handeln gibt, fallen allerdings so aus, dass es einem Angst werden kann um die Zukunft einer Gemeinschaft, in der sich die meisten nur noch um ihr Eigenwohl sorgen, Entsolidarisierungsprozesse nicht zu übersehen sind und Gewalt oft die einfachste Lösung zu sein scheint, weil sie nicht mehr benötigt als zwei stumme Fäuste.
Titelangaben
Juli Zeh: Unterleuten
München: Luchterhand Literaturverlag 2016
640 Seiten. 24,99 Euro
Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander
Reinschauen
| Leseprobe
| mehr von Juli Zeh in Titel kulturmagazin
| mehr von Juli Zeh in Titel kulturmagazin