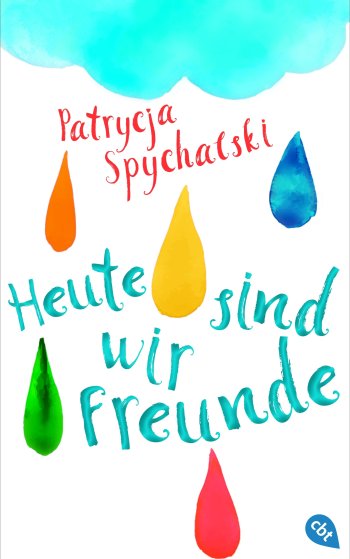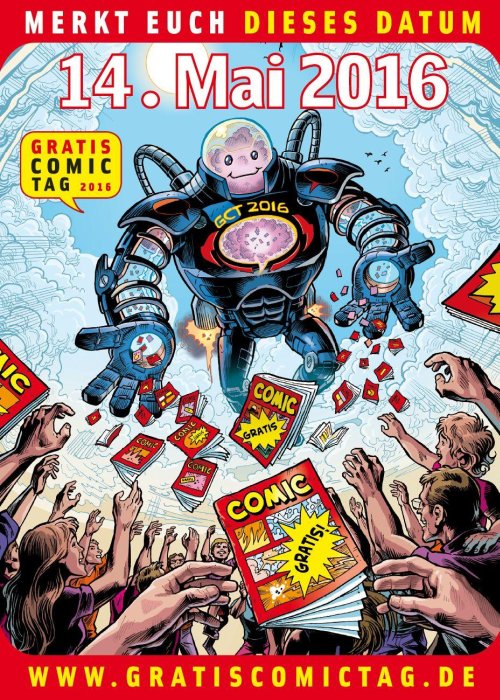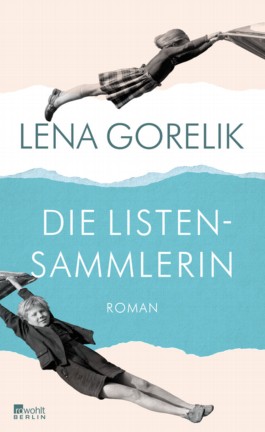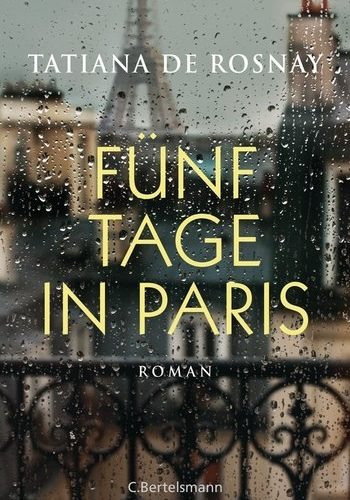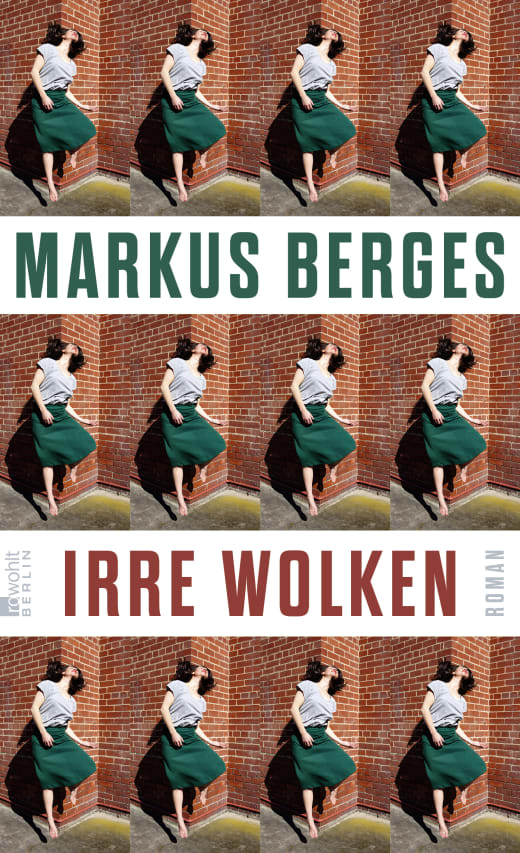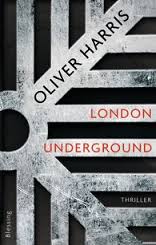Roman | Jean Mattern: September
Die olympischen Spiele 1972 in München – ein Kräftemessen der besten Athleten, ein Schaulaufen der Presse. Doch kein besonders glorreicher oder überraschender Sieg sorgt in diesem Wettkampf für Aufregung. Dieses Mal ist alles anders, denn eine Tragödie wirft einen schweren Schatten über das Ereignis. In seinem Roman September verarbeitet Jean Mattern das Unglück der olympischen Spiele 1972, bei denen die israelische Delegation als Geiseln genommen wird und spickt diese mit privaten Emotionen seines Erzählers. Von ANNA NISCH
 Es ist der 25. August 1972. Der Londoner Journalist Sebastian will für die BBC eine Top-Story bei den olympischen Spielen in München liefern. Dabei ist es nicht das Sportereignis als solches, das er zum Hauptthema seiner Reportage machen will. Ihn interessiert die Attitüde des Gastgeberlandes vor dem Hintergrund der bitteren Vergangenheit Deutschlands – die olympischen Spiele als »Beweis dafür, dass Deutschland ein Land wie jedes andere sei«. Doch ahnt er zu dem Zeitpunkt nicht, dass seine Arbeit aufgrund von anderen Gegebenheiten eine besonders bezeichnende werden wird
Es ist der 25. August 1972. Der Londoner Journalist Sebastian will für die BBC eine Top-Story bei den olympischen Spielen in München liefern. Dabei ist es nicht das Sportereignis als solches, das er zum Hauptthema seiner Reportage machen will. Ihn interessiert die Attitüde des Gastgeberlandes vor dem Hintergrund der bitteren Vergangenheit Deutschlands – die olympischen Spiele als »Beweis dafür, dass Deutschland ein Land wie jedes andere sei«. Doch ahnt er zu dem Zeitpunkt nicht, dass seine Arbeit aufgrund von anderen Gegebenheiten eine besonders bezeichnende werden wird
Noch weniger ahnt er die Begegnung mit einem besonderen Menschen: Sam – ein amerikanischer Journalist – doch für Sebastian von Anfang an mehr. Und schon beim ersten Erblicken scheint es so, als sei sein Job bei den Spielen nur zweitrangig und viel wichtiger war es, so oft es nur geht in der Nähe des schönen Unbekannten zu sein.
Nur eine kitschige Liebesgeschichte?
Dem Leser präsentiert sich zu Anfang eine seltsame »Beziehungskiste«. Ein Engländer, der nach Deutschland kommt, um eine Reportage zu recherchieren, begegnet einem mysteriösen Kollegen, der zunächst mehr unheimlich als liebenswert wirkt. Doch nach diesem ersten »zu tiefen Blickwechsel« geschieht eines ganz schnell: Sebastian verknallt sich in den jungen Amerikaner. Aus Sebastians Perspektive, die der Leser den gesamten Roman über teilt, ist die Faszination für Sam jedoch total nachvollziehbar, wenn auch abstrus.
Eine tiefe Gefühlseinsicht ist dasjenige, was man somit zu lesen bekommt und fast mag man schon an einen Punkt kommen, an dem es genug der überdrüssigen Liebelei des Protagonisten ist, der fast schon wie ein Gustav von Aschenbach aus Manns Der Tod in Venedig einem Ideal in Form einer anderen Person nachjagt: getrieben von Faszination und Ehrfurcht. »Und doch war diese Epiphanie nichts neben der Gewalt meines Glücksgefühls, und als ich Sams Hand ein letztes Mal vor einem Bild von Kandinsky mit dem Titel Improvisation streifte, wusste ich , dass ich es nie bereuen würde, durch und in diesem Mann einen Teil meiner selbst gefunden zu haben.«
Von der Euphorie zum großen Schock
Doch dann macht alles Sinn. Die Begegnung mit Sam bleibt nicht einfach nur auf Ebene der Leidenschaft – gemeinsam bilden sie auch ein journalistisches Gespann und schaffen es sogar, das Ausnahmeschwimmtalent Mark Spitz zu interviewen. Mehr und mehr werden Sam und Sebastian ein Team und mehr und mehr erfährt Sebastian etwas über den Mann an seiner Seite, der in New York für die »Jewish Week« arbeitet.
Dann die Katastrophe: Es ist der 5. September – tagelang hat Sam Sebastian gemieden und letzterer »hatte einfach jeden Halt verloren«. Dann steht Sam plötzlich wieder vor der Tür mit der Nachricht, dass es eine Geiselnahme im olympischen Dorf gegeben hat. Der sogenannte »Schwarze September«, ein Palästinenserkommando, überfiel mitten in der Nacht das israelische Mannschaftslager. Der Schauplatz des euphorischen Wettkampfes wird zu einem Lager des Terrors. Und Gefühle von Beklemmung, Mitgefühl, Angst und Schauder mischen sich in die Erzählung des Protagonisten. Gemeinsam mit Sam ist Sebastian auf der Spur des Verbrechens, das sogar Tote forderte und holt Material ein, welches die Grausamkeit des Terrors veranschaulicht.
Die Kluft zwischen Gefühl und Realität
An dieser Stelle bricht nicht nur die Handlung. Über die weiterhin emotionale Wiedergabe des Erzählers, der rückblickend seine Geschichte bei Olympia 1972 erzählt, entsteht ein diffuses Gefühlschaos, das den Schrecken verdeutlicht. Denn ein Verliebter erzählt hier. Jemand, der unerwarteter weise ein besonderes Glück gefunden hat und auf einmal mit einer furchtbaren Situation konfrontiert wird. »Vor Anspannung zog sich mir der Magen zusammen, doch ich fühlte noch etwas anderes: das unglaubliche Glück, wieder mit Sam zusammen zu sein nach all den Tagen, in denen er Katz und Maus mit mir gespielt hatte.«
Die widersprüchlichen Gefühle stören nicht, im Gegenteil, sie besitzen Authentizität. Diese wird verstärkt durch einen stets reflektierenden Erzähler, der sich bewusst ist, dass er in solch einer Situation kein Recht haben dürfe, egoistische Liebesgefühle zu entwickeln. Beziehungsweise wird diese Frage aufgeworfen: Ist es pietätlos seine eigene Gefühlswelt in einem Szenario des Grauens aufrechtzuerhalten?
Trotzdem die individuelle Geschichte des verliebten Journalisten im Vordergrund steht und bis zum Ende hin den Spannungsbogen bestimmt, sind die detaillierten Erzählungen aus dem »Mittendrin« des Olympia-Terrors fesselnd und berührend. Ein Protagonistenduo stürzt sich nahezu wie ein Ermittlerteam in die nicht ungefährliche Situation, deckt tatsächlich einige Geheimnisse auf und einer überlasst dem anderen die große Geschichte.
Titelangaben
Jean Mattern: September
Aus dem Französischen übersetzt von Holger Fock und Sabine Müller
Berlin: Berlin Verlag 2016
154 Seiten, 18 Euro
Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander
Reinschauen
| Leseprobe