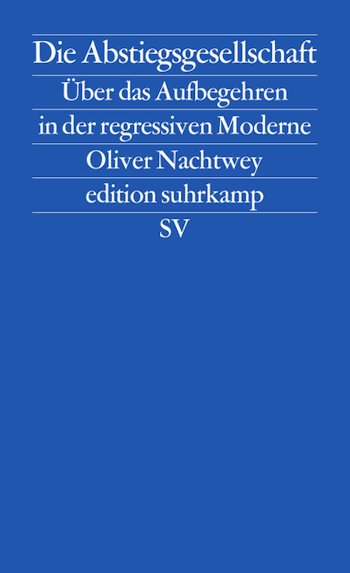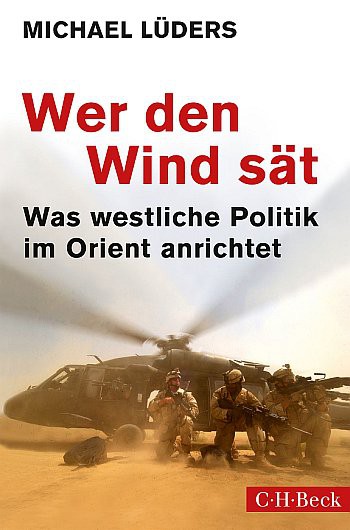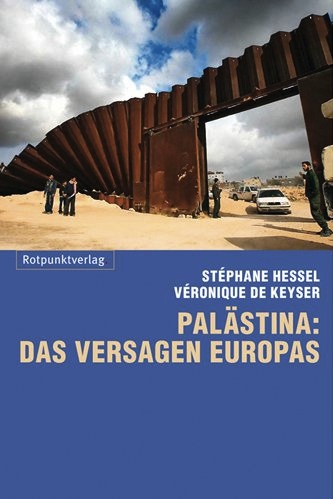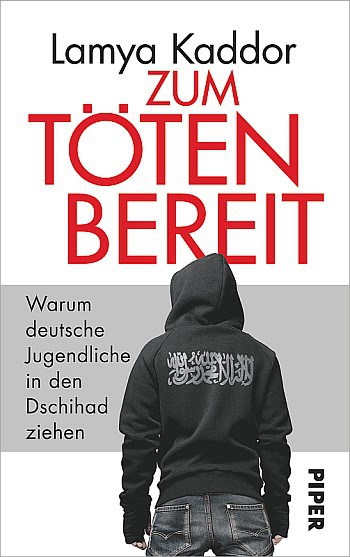Gesellschaft | Bernard Lown: Heilkunst. Mut zur Menschlichkeit
Da scheiden sich die Geister – es immer wieder eine denkwürdige Erfahrung, dass öffentliche Aussprache über Medizin hierzulande üblicherweise nach den Vorgaben und Regeln einer übermächtigen Gesundheitsindustrie erfolgt. Was jenseits dieses regulierten Territoriums stattfindet, dringt nicht durch. So erscheint auch der hier rezensierte Band in einem medizinischen Fachverlag, einer Nische, und gewinnt nicht die Öffentlichkeit, die er von vornherein verdient hätte. Von WOLF SENFF
 Bernard Lown erhielt 1985 gemeinsam mit dem Russen Charow den Friedensnobelpreis für seinen Einsatz gegen die weltweite atomare Aufrüstung. »Heilkunst« ist ein Folgeband seines vor zehn Jahren erschienenen »Die verlorene Kunst des Heilens, Anstiftung zum Umdenken« – beides keineswegs abgehoben formulierte Fachbücher, sie wären zweifellos eine Zierde unserer bedeutenden Publikumsverlage.
Bernard Lown erhielt 1985 gemeinsam mit dem Russen Charow den Friedensnobelpreis für seinen Einsatz gegen die weltweite atomare Aufrüstung. »Heilkunst« ist ein Folgeband seines vor zehn Jahren erschienenen »Die verlorene Kunst des Heilens, Anstiftung zum Umdenken« – beides keineswegs abgehoben formulierte Fachbücher, sie wären zweifellos eine Zierde unserer bedeutenden Publikumsverlage.
Vom etablierten Medizin-Betrieb
Wie eine mächtige deutsche Automobilindustrie sich dagegen sperrt, Dieselkraftstoffe wegen deren besonders gefährdender Abgase aus dem Verkehr zu ziehen – was in anderen Ländern längst geschah –, genau so sperrt sich die deutsche pharmazeutische Industrie dagegen, dass über nichtindustrielle Methoden des Heilens in den ›Leitmedien‹ öffentlich und unvoreingenommen nachgedacht wird. Man hat den Eindruck, hier herrscht eine Atmosphäre eines ›Kalten Krieges‹, in dem jede nicht mit der ›Apparatemedizin‹ verknüpfte Therapie ausgegrenzt wird.
»Heilkunst« ist eine Sammlung von Beiträgen Bernard Lowns zu verschiedenen Themen der Medizin, und bereits der erste Beitrag lässt das gespannte Verhältnis Lowns zum etablierten Medizin-Betrieb deutlich werden. Es geht um die Neigung von Kardiologen, Bypässe zu legen.
Wie therapiert man seelischen Schmerz?
Lown bestreitet nicht die Notwendigkeit, diese Operationen durchzuführen, aber er zeigt an konkreten Beispielen, wie kontraproduktiv sich diese Operation auswirken kann, und klagt die Leichtfertigkeit an, mit der sie eingesetzt wird, denn sie füllt die Kassen. Diese privatwirtschaftliche Automatik des rollenden Rubels wurde hierzulande endgültig etabliert, als die Krankenhäuser in privaten Besitz übergingen, sie betrifft längst nicht allein die Kardiologie.
Seine Sprache ist kein Fachchinesisch, sondern sie ist stets dicht am Menschen, etwa als er die Problematik seelischen Schmerzes darstellt. Wir haben uns daran gewöhnt, dass diesbezüglich von einem ›Trauma‹ geredet wird, für das es eine Zuständigkeit gibt und das behandelbar, lösbar ist. An einem eindringlichen Beispiel verdeutlicht er, dass seelischer Schmerz einen Menschen verändert und ihm gleichsam den Boden unter den Füßen wegziehen kann.
USA: der lange Schatten der Sklaverei
Die Medizin bzw. unsere geläufige Vorstellung von Medizin ist offenbar ein Wolkenkuckucksheim, ein Konstrukt, das uns in trügerischer Sicherheit wiegt. Was sagt man dazu? Generell scheint es unsere Lieblingsbeschäftigung, dass wir uns in trügerischer Sicherheit wiegen und nicht einmal die Politiker die realen Gefährdungen zur Kenntnis nehmen, geschweige denn dass sie sie eindämmen, mildern, auflösen.
Bernard Lown wirft seinen Blick weit in die Gesellschaft, er fällt auf den Schatten, den die längst überwunden geglaubte Sklaverei noch heute wirft – Lown beschreibt den Rassismus in den Gewohnheiten und Praktiken amerikanischer Krankenhäuser, der weitreichende Konsequenzen für das alltägliche Leben hat.
Die hohe Kunst des Zuhörens
Er ist einfach anders positioniert. Er mahnt vor den Gefahren eines medizinischen Dogmatismus und ruft jenen »heiligen« Moralkodex in Erinnerung, demzufolge, primum nihil nocere, zuallererst kein Schaden zugefügt werden dürfe. Er fordert intensive Gespräche zwischen Arzt und Patient und zieht deutliche Grenzen zu den standardisierten Diagnosen und Therapien des medizinischen Alltags.
Thematisch bietet Bernard Lown dem Leser eine tour d`horizon. Zielsicher beschreibt er Aspekte einer Kunst des Zuhörens, die gar nicht hoch genug einzuschätzen sei – und im übrigen auch für den Nichtmediziner hilfreich. Die Erfahrungen, die er beschreibt, sind ergreifend, und immer wieder klingt durch, dass für eine nachwachsende Ärztegeneration ein irreführendes Vertrauen in eine Wissenschaftlichkeit des Berufs und in die verfügbaren Technologien den beruflichen Alltag bestimmt.
Eine ›Kultur der Medikalisierung‹
Krankenhäuser seien hoch technologisierte, exakt durchorganisierte Institute, in denen für den menschlichen Kontakt, die ärztliche Kunst des Heilens keine Zeit vorhanden sei. Bernard Lown ist ja nicht der erste, der diese kritische Haltung einnimmt, und das einzige, worüber man sich vielleicht noch wundert, ist die Kaltschnäuzigkeit, mit der die angesprochenen Entwicklungen, aller überzeugenden Kritik hohnlachend, fortgesetzt werden.
Die menschenverachtenden Züge des Mammons bieten sich hier ungeschminkt dar. Und vor diesem Hintergrund dürfte die Forderung nach einer »Humanisierung der Gesundheitsfürsorge« wenig mehr sein als ein gut gemeinter moralischer Appell. Bernard Lown konstatiert selbst, dass wir in einer Kultur der Medikalisierung leben, die unsere Ängste fördere und vergrößere. Krankenhäuser seien Fabriken der Biotechnologie.
Vom Auftritt der Marktschreier
Er führt eine Untersuchung an, derzufolge die für eine Diagnose erforderlichen Informationen zu fünfundsiebzig Prozent aus der sorgfältig erhobenen Krankengeschichte gewonnen werden, zu zehn Prozent aus der körperlichen Untersuchung und lediglich zu fünf Prozent mithilfe der umfangreichen und kostspieligen Technologien und zu weiteren fünf Prozent aufgrund simpler Tests wie einer Urin- oder Blutprobe (zu weiteren fünf Prozent ließen sich die Erkrankungen nicht diagnostizieren).
Das sagt eigentlich alles über den marktschreierischen Anspruch und über die Wirklichkeit von Technologie im Gesundheitswesen.
WOLF SENFF
Titelangaben
Bernard Lown, Heilkunst. Mut zur Menschlichkeit
Stuttgart: Schattauer Verlag 2015
308 Seiten, 24,99 Euro