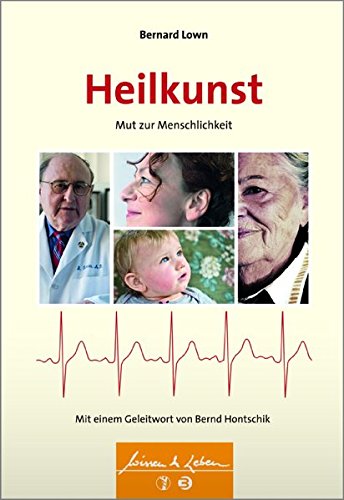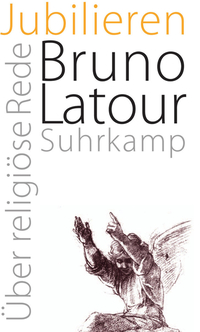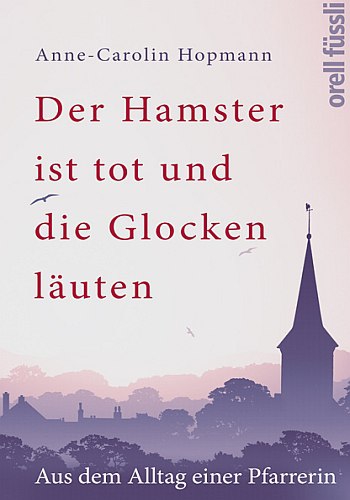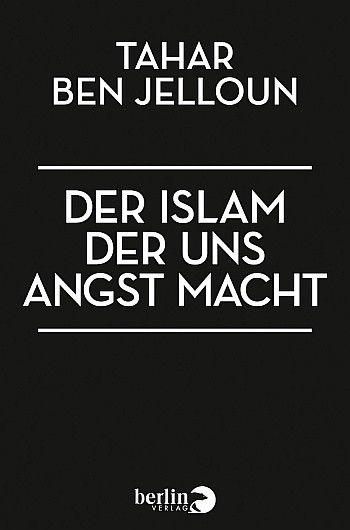Gesellschaft | Oliver Nachtwey: Die Abstiegsgesellschaft – Über das Aufbegehren in der regressiven Moderne
Man sagt, Deutschland sei im Vergleich zu anderen europäischen Ländern glimpflich aus der Finanz- und Wirtschaftskrise herausgekommen. Beim Blick auf populistische Proteste und Bewegungen wie ›Pegida‹ und ›Occupy‹ und der Gründung von Rechtsparteien wie der ›AfD‹ jedoch zeichnet sich ein demokratisch-sozialer Konflikt in der Bundesrepublik ab, der das demokratische System selbst ins Schaukeln bringen und »autoritäre Strömungen, die sich der liberalen Grundlagen unserer Gesellschaft entledigen«, erzeugen könnte. Wie konnte es soweit kommen? Von MONA KAMPE
 Wirtschaftswunder, Wohlstand und demokratische Werte sind die Schlagworte, die im Nachkriegsdeutschland ganz groß geschrieben wurden. Märkte boomten, technische Innovationen wie etwa die Waschmaschine und der Fernseher bereicherten die Haushalte, Menschen demonstrierten gemeinsam für Bürgerrechte wie Mitbestimmung, Autonomie und Emanzipation. Die Bildung galt als Garant für einen festen Arbeitsplatz, ein gutes Gehalt und eine sichere Zukunft. Das Studium wurde als Statussymbol angestrebt.
Wirtschaftswunder, Wohlstand und demokratische Werte sind die Schlagworte, die im Nachkriegsdeutschland ganz groß geschrieben wurden. Märkte boomten, technische Innovationen wie etwa die Waschmaschine und der Fernseher bereicherten die Haushalte, Menschen demonstrierten gemeinsam für Bürgerrechte wie Mitbestimmung, Autonomie und Emanzipation. Die Bildung galt als Garant für einen festen Arbeitsplatz, ein gutes Gehalt und eine sichere Zukunft. Das Studium wurde als Statussymbol angestrebt.
Durch die berufliche und soziale Mobilität sowie Öffnung war es erstmals auch Mitgliedern der Arbeiterklasse möglich, weiterführende Schulen zu besuchen und aufzusteigen. In dieser »sozialen Moderne« beobachteten wir eine Gesellschaft des Aufstiegs und Wachstums mit optimistischen Partizipanten.
Fahrstuhl aufwärts
Ulrich Beck beschrieb dieses Phänomen der Achtziger Jahre als ›Fahrstuhleffekt‹ – alle Schichten und sozialen Klassen begaben sich gemeinsam nach oben. Durch ein «kollektives Mehr an Einkommen, Mobilität, Recht, Wissenschaft, Massenkonsum«(Beck, 1986) spielten Ungleichheiten nur noch eine marginale Rolle, da es allen besser ging. Differenzen waren nach wie vor präsent, jedoch nun primär zwischen Individuen und Gruppen, nicht mehr traditionellen Klassen und Schichten.
»Wachstum bildete in der Vergangenheit die zentrale Ressource für eine Moderation struktureller Ungleichheiten, indem bei steigender Produktivität Beschäftigung und soziale Integration durch sozialen Aufstieg ermöglicht wurden.« Bleibt dieses aus, kommt es kontrastiv zu gesellschaftlichen Spannungen und sozialen Abstiegen.
Leitern ohne Sprossen
Sozialer Aufstieg gilt heute als grundlegende gesellschaftliche Norm. Dieses diametrale Bild von Aufstiegserwartung und Aufstiegsmöglichkeit zeichnet das Deutschland des aktuellen Postwachstumskapitalismus: Junge Akademiker treffen auf prekäre Perspektiven und einen diffizilen Ein- sowie Aufstieg im Berufsleben – denn auf wenige gute Stellen sammelt sich eine ganze Reihe qualifizierter Bewerber. Ältere Berufstätige kämpfen gegen Renten-, Sozial- oder Lohnkürzungen. Der Fahrstuhl ist stecken geblieben – der Leiter nach oben fehlen ihre essentiellen Sprossen. Aufstiegsorientierung, Leistungsprinzip und stabilisierende Normen kehren sich um und führen zu Desintegration. Trotz vorübergehender Stabilisierung durch die Einführung des Mindestlohns haben sich massive Verlustängste und Unsicherheiten verbreitet. Primär widersprüchliche Interessen unterschiedlicher Arbeitnehmer bergen Konfliktpotenzial: Leiharbeiter werden als Sicherheitspuffer angesehen und sozial abgewertet. Stammkräfte grenzen sich durch Exklusivität ab und ruhen sich auf ihren Privilegien aus.
Prekarität und Unzufriedenheit werden als kollektive Erfahrungen interpretiert, die zukünftig zu erneuten Klassenbewegungen führen könnten – ein neues Klassenbewusstsein wird jedoch eher durch »die diffuse Kontrastierung einer Elite und der Bevölkerungsmehrheit« angeregt. Bürgerproteste und -bewegungen wie ›Occupy‹ rücken demokratische Werte zurück in den Fokus: Gleichheit soll wieder in die politische Praxis einkehren. Postdemokratische Alternativen, transparente Diskursverfahren und innovative Ansätze werden zu Postulaten des demokratisch-sozialen Konflikts der Gegenwart. Bürger bestehen auf ihre sozialen und politischen Anrechte, formen ein Aufbegehren, welches bisher »häufig widersprüchlich, individuell, emotional und affektiv« sowie periodisch in Erscheinung tritt. Der einst optimistische Blick in die Zukunft ist sowohl Parteien, welchen es bis dato nicht gelingt, diese Unzufriedenheitsenergie für ein demokratisches Wiederbeleben zu mobilisieren, als auch Gesellschaftsmitgliedern verloren gegangen.
Früher war alles besser …
In diesem Szenario ist man schnell dazu verleitet, sich nach den Erfolgen der »sozialen Moderne« zurückzusehnen und diese als Lösung des Konfliktes anzuführen. Doch für Oliver Nachtwey ist das ein Schritt zurück: Errungenschaften wie sozialer Sicherheit und Teilemanzipation für die Arbeiterklasse standen einst schon Strukturbestandteile wie Bürokratie, Diskriminierungen und Hierarchien im Weg. In der heutigen »regressiven Moderne« sind »Fortschritt und Rückschritt auf widersprüchliche Weise miteinander verzahnt. Klasse, Geschlecht und Ethnie sind zu Klassendisparitäten verwoben, die man nicht einfach zugunsten eines Faktors auflösen kann.« Zudem besteht die Gefahr einer autoritären Strömung, die statt liberaler antidemokratische sowie religiös-identitäre Formierungen unterstützt. Dies veranschaulicht sich in den jüngsten Wahlerfolgen der ›AfD‹ sowie der »rechten Wutbüger«-Protestbewegung ›Pegida‹.
Oliver Nachtwey, Fellow am Frankfurter Institut für Sozialforschung, gewährt Lesern in seinem Buch eine eindrucksvolle Analyse historischer und gesellschaftlicher Entwicklungen, die essentiell und kausal für die aktuelle Lage in der Bundesrepublik und in ganz Europa sind. Dabei regt er Denkanstöße an, die über den Tellerrand und Datenerhebungen hinweg zur Reflexion der »regressiven Modernisierung« und ihren Folgen für das demokratische Individuum beitragen. Auswege werden nicht thematisiert, denn die Meinungsfreiheit ist ein demokratischer Grundwert, der Rezipienten dieses Sachbuches nicht vorenthalten werden soll.
| MONA KAMPE
Titelangaben
Oliver Nachtwey: Die Abstiegsgesellschaft – Über das Aufbegehren in der regressiven Moderne
Berlin: Suhrkamp Verlag 2016
264 Seiten, 18 Euro
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander
Reinschauen
| Leseprobe