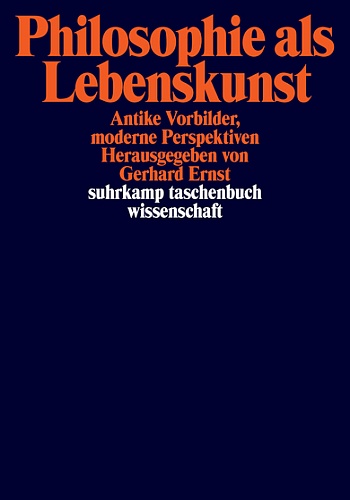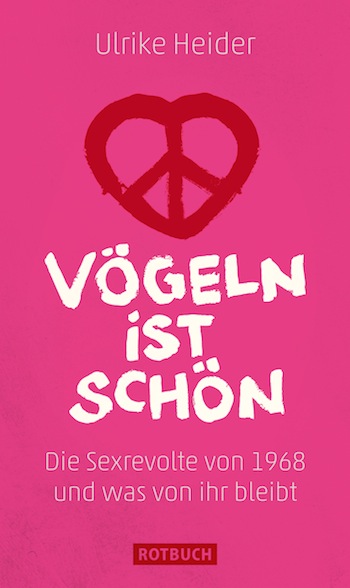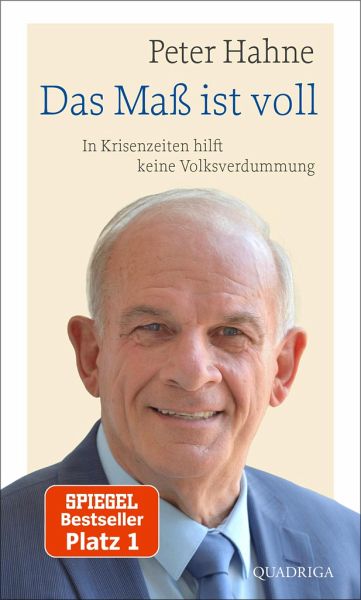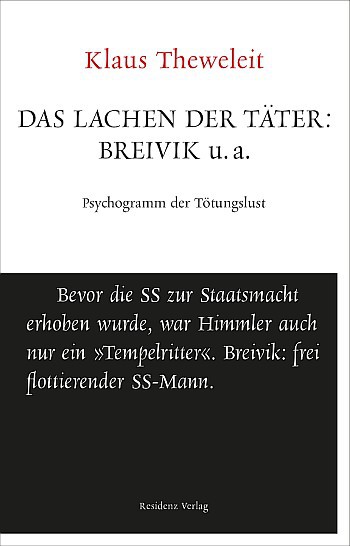Gesellschaft | Richard David Precht: Tiere denken
Es gibt zu viele Bescheidwisser, und Weisheit wird wieder mit Löffeln gefressen. Da erfrischt ein Satz wie dieser: »Gesichert in der Evolutionstheorie ist, dass keine ihrer Annahmen gesichert ist«. Im Übrigen existiert der Mensch bislang bloß hunderttausend Jahre, während unförmige Saurier den Planeten hundertfünfzig Millionen Jahre lang bevölkerten – kann gut sein dass sie klüger waren. Von WOLF SENFF
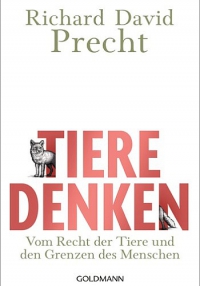 Precht zweifelt an den Versuchen, die Lebewesen zu klassifizieren. Bereits die Abgrenzung zu den Tieren sei problematisch, weil sie nach menschlichen Maßstäben erfolge. Im vergangenen Jahrhundert hätten sich nacheinander Behavioristen, Ethologen, Verhaltensökologen vergeblich bemüht, das Tier in Abgrenzung zum Menschen zu klassifizieren.
Precht zweifelt an den Versuchen, die Lebewesen zu klassifizieren. Bereits die Abgrenzung zu den Tieren sei problematisch, weil sie nach menschlichen Maßstäben erfolge. Im vergangenen Jahrhundert hätten sich nacheinander Behavioristen, Ethologen, Verhaltensökologen vergeblich bemüht, das Tier in Abgrenzung zum Menschen zu klassifizieren.
Eindeutig ist nichts
Der Mensch komme nicht aus den Grenzen der eigenen Wahrnehmung heraus. Woher nähmen wir beispielsweise die Gewissheit, fragt Precht, dass Tiere zielorientiert handeln? Was sie den gesamten Tag über tun, habe jedesmal eine Funktion? Das dürfte schon für den Menschen eine waghalsige Aussage sein.
Der Mensch überhebe sich, indem er eine Tier-Mensch-Grenze zu definieren suche. Prechts Angriff auf das etablierte Menschenbild ist grundsätzlich. Weder das soziale Leben noch die Fähigkeit, zu kommunizieren, sei eine Eigentümlichkeit des Menschen, weder ›Tier‹ noch ›Mensch‹ lasse sich eindeutig definieren.
Querulantentum
Precht knüpft an eine Debatte an, die in England in den Fünfziger und Sechziger Jahren leidenschaftlich und auf hohem Niveau geführt wurde, die Antipoden waren die Philosophin Mary Midgley, die den Naturwissenschaften einen fundamentalistischen Geltungsanspruch vorwarf, und der Evolutionsbiologe Richard Dawkins. Das Echo in Deutschland? Die Position von Dawkins, und zwar allein diese, landete in den späten Achtzigern mehrtägig, ganzseitig, bunt illustriert im Hamburger Abendblatt.
In einem Abriss der großen Religionen und Kulturen schildert Precht, wie jeweils verschieden das Tier eingestuft wurde und wie heuchlerisch mit ihm seitens der Christlichen Kirche verfahren wurde. Franz von Assisi, der auch die Tiere in die Schöpfung einbezog, galt als Querulant.
Kein Kuddelmuddel
Tiere waren belanglos, in Diskussion um moralisches Handeln waren sie kein Thema. Besonders radikal war die Position der Calvinisten, deren Ethos den Kapitalismus beförderte, wir nähern uns der Moderne, und es ist mittlerweile überdeutlich, dass Precht eine radikal andere Position vertritt.
Er schließt sich einer Tradition an, die nicht nur traditionellen Tierschutz, sondern Rechte für Tiere einfordert, und erinnert an den deutschen Philosophen Leonard Nelson (1882-1927) oder den Finnen Edvard Westermarck (1862-1939). Letztlich grenzt er sich von einer juristischen Betrachtungsweise ab, und es ist spannend zu lesen, wie er sich argumentativ abgrenzt – man hat den Eindruck, er wehre sich gegen ein Fliegenbeinchenzählen, das stets erst mitten hinein ins Kuddelmuddel führe.
Massentierhaltung
Und er beschreibt sehr überzeugend, wie komplett desorientiert der Mensch sein Verhältnis zu den anderen Lebewesen gestaltet, sei es, dass er seine Phantasien auf sie projiziere; sei es, dass er sich ekle, sei es, dass er sie als Nahrungslieferanten nutze. Damit korrespondiere ein »Tierschutzgesetz«, das das Papier nicht wert sei, auf dem es gedruckt stehe – jährlich würden fünf Millionen Tiere durch Jagd getötet und zweihundert Millionen fielen der »Intensivhaltung« zum Opfer.
Erschütternd ist seine Beschreibung der Realität von Massentierhaltungsfarmen, in denen Hilfsarbeiter aus Bulgarien und Rumänien im Dienst von Leiharbeitsfirmen für einen Hungerlohn arbeiten.
Ethik des Nichtwissens
Die Agrarlandschaft sei geprägt durch pestizidverseuchte Futtermais-Monokulturen, die Bauernverbände seien in eine profitable Kumpanei mit der Nahrungsmittelindustrie verstrickt. Man zweifelt, dass die Politiker überhaupt begreifen, was sie da angerichtet haben. Sie machen große Augen wie Unschuldslämmer und staunen, dass die Leute sich von den herkömmlichen Parteien abwenden.
Precht knüpft an Albert Schweitzers grundlegende Forderung an, dass allem Lebendigen mit Ehrfurcht zu begegnen sei, und erinnert an seine eigene Forderung nach einer Ethik des Nichtwissens, der zufolge der Mensch nicht über Affekte und Bewusstsein der Tiere urteilen könne.
Hackfleisch / »Cultured meat«
Nur folgerichtig also, dass Precht sich auch für einen Verzicht auf fleischhaltige Ernährung ausspricht. Egal, was wir davon halten – die Aufforderung ist plausibel begründet. Ein zwingender medizinischer Grund, Fleisch zu essen, bestehe nicht, und der Respekt vor dem Leben rechtfertige den Verzicht.
Und es deutet sich an, dass es tatsächlich anders geht. Precht knüpft viel Hoffnung an ein Hackfleisch, das aus der Stammzelle einer Kuh gezüchtet wurde, ›cultured meat‹, das zum ersten Mal im August 2013 präsentiert wurde und tendenziell zum Ende der Massentierhaltung führen könne.
Doch wer weiß, was daraus wird, wir trösten uns besser nicht damit, dass eine neue Technologie uns schon die Probleme abnehmen wird, und kümmern uns doch besser selbst – David Precht ist optimistisch und erkennt bereits einen Stimmungsumschwung.
Titelangaben
Richard David Precht: Tiere denken
Vom Recht der Tiere und den Grenzen des Menschen
München: Goldmann 2016
510 Seiten, 22,99 Euro
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander