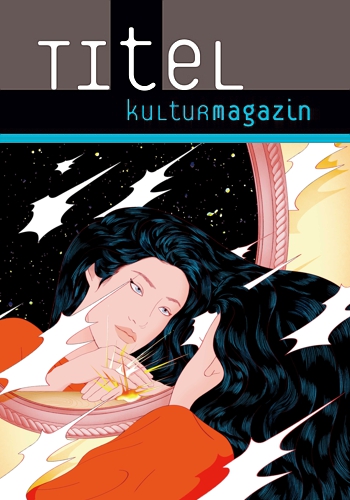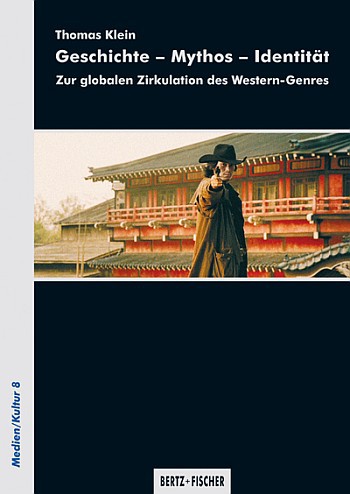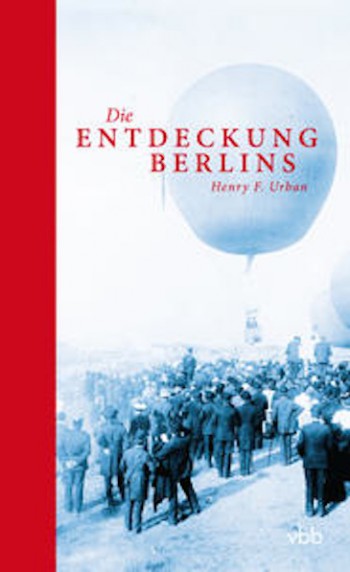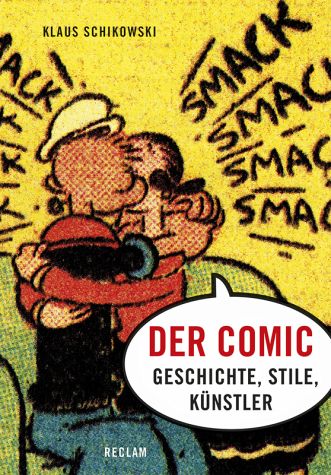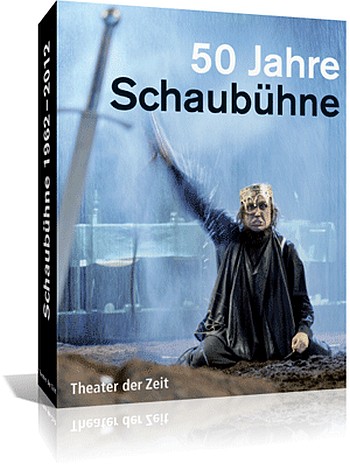Kulturbuch | Jan Niklas Meier, Monster. Essays
Was sich mit Schwarz schmückt, ist Subkultur, darin ist man sich einig. Der »Knotenpunkt« der sogenannten ›Schwarzen Szene‹, das wären die Grufties, Kultur des Gothic, Gothicka, und sobald einer die schwarze Szene bemüht, Achtung!, da wird’s bedenklich, doch wir beschäftigen uns mit den Essays von Jan Niklas Meier. Von WOLF SENFF
Er konzentriert sich auf einen Ausschnitt: King Kong, Hannibal Lecter, Frankenstein, Werwölfe, Zombies – Gestalten des Anderen, die eine Ästhetik des Ekels transportieren und der menschlichen Zivilisation einen Spiegel vorhalten, damit ein Blick auf die Kehrseite möglich wird. Jan Niklas Meier arbeitet sich sorgfältig durch Historie und Erscheinungsformen der literarischen ›Monster‹ des Edgar Allen Poe bis zu Howard Phillips Lovecraft.
Monströse Untote
 Über unsere Kinoleinwände hingegen flimmern Zombies, die monströsen Untoten, die sich von Menschenfleisch ernähren. Jan Niklas Meier sieht diese Tradition beginnen mit Viktor Halperins ›White Zombie‹ (1932) und zurzeit vertreten durch George A. Romero mit ›Night of the Living Dead‹ (1968), ›Dawn of the Dead‹ (1978) und ›Resort‹ (2015), jeweils inszeniert als eine Abrechnung mit der modernen Gesellschaft, sei es die drohende atomare Katastrophe, das Konsumdenken oder der Umgang mit gesellschaftlichen Minderheiten.
Über unsere Kinoleinwände hingegen flimmern Zombies, die monströsen Untoten, die sich von Menschenfleisch ernähren. Jan Niklas Meier sieht diese Tradition beginnen mit Viktor Halperins ›White Zombie‹ (1932) und zurzeit vertreten durch George A. Romero mit ›Night of the Living Dead‹ (1968), ›Dawn of the Dead‹ (1978) und ›Resort‹ (2015), jeweils inszeniert als eine Abrechnung mit der modernen Gesellschaft, sei es die drohende atomare Katastrophe, das Konsumdenken oder der Umgang mit gesellschaftlichen Minderheiten.
Meier verweist auf Komödien ebenso wie auf Zombie-Trash. Die Eigenständigkeit der Zombie-Figur zeige sich auch darin, dass sie längst auch in Videospielen, Gesellschaftsspielen, Comics auftrete. Darüber hinaus hätten sich ›Zombie Walks‹ etabliert, Großveranstaltungen, deren Teilnehmer als Untote verkleidet durch die Straßen ziehen, in 2010 im australischen Brisbane mit zehntausend Teilnehmern.
Er öffnet ein Fass
Der Bezug zum Fremden oder Monströsen sei kein zeitlich begrenztes Thema, das Ausgrenzen sei als ›Othering‹ etwa im Mittelalter ein Thema für erbitterte Konflikte gewesen, und Jan Niklas Meier erinnert an den prominenten Kirchenvater Augustinus, der seinerseits keinen Zweifel an der Menschlichkeit monströser Figuren – geradezu berühmt wurde der ›Elefantenmensch‹ – habe aufkommen lassen, da sie Teil von Gottes Werk seien. Auch das Anderssein sei Teil menschlicher Zivilisation.
Jan Niklas Meier tut mit dem Hinweis auf das Mittelalter ein Fass auf, denn die Verbindung zu den Grufties, der Gothic-Kultur ist unübersehbar, und die Gothic Novel ist ja nichts anderes als der Schauerroman, der uns mit Ungeheuern und Monstern versorgt.
›Schwarze Romantik‹
Es gibt wenig Verlässliches, was Auskunft über Tragweite und gesellschaftliches Gewicht der schwarzen Szene Auskunft gibt. Wir wissen von Leipzig als dem jeweils zu Pfingsten bedeutenden internationalen Wallfahrtsort der ›Grufties‹ oder ›Goths‹, wir kennen die hochgerühmte ›Heavy Metal Town‹ Wacken, deren Plätze mittlerweile ein Jahr vor dem Termin der ›Wacken Open Air‹ – wo 2013 ›Rammstein‹ auftraten und 2016 ›Iron Maiden‹ – komplett ausverkauft sind.
Kultur- wie Literaturwissenschaftler sind bemüht, die ›Schwarze Romantik‹ neu zu gewichten und Traditionslinien zu knüpfen, die vielleicht Anknüpfungspunkte erschließen, die die Verbreitung der schwarzen Szene in der Jugendkultur erklären. Darüber hinaus ist Schwarz politisch symbolträchtig als die Farbe der Anarchie bekannt, und selbstverständlich wären auch hier Zusammenhänge zu untersuchen und zu beschreiben. Die Texte von Jan Niklas Meier sind vernünftigerweise auf einen
Ausschnitt begrenzt.
Titelangaben
Jan Niklas Meier: Monster. Essays
Norderstedt: scius verlag, 2017
141 Seiten, 9,99 Euro
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander
Reinschauen
| Leseprobe