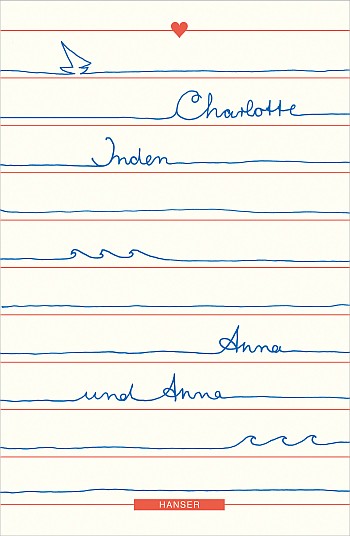Jugendbuch | Robin Stevenson: Die Unmöglichkeit des Lebens
Das Thema Tod ist im Jugendbuch kein Tabu mehr, ebensowenig Selbsttötung. Grenzen werden eher im Sprechen darüber gesetzt. Ganz wichtig ist es, Trost zu vermittelten und offene Fragen geschickt in den Hintergrund zu schieben. Robin Stevenson hält davon nichts. Ihre Geschichte von Melody und Jeremy ist vor allem eine offen Frage. Herausforderung pur, also. Von MAGALI HEIẞLER
 Melody und Jeremy sind befreundet. Sie sind sogar ein Paar, wenn auch nicht durch Liebe verbunden. Was sie füreinander attraktiv macht, ist das Thema Tod. Beide haben ihre Erfahrung damit. Und mit dem Alleinsein.
Melody und Jeremy sind befreundet. Sie sind sogar ein Paar, wenn auch nicht durch Liebe verbunden. Was sie füreinander attraktiv macht, ist das Thema Tod. Beide haben ihre Erfahrung damit. Und mit dem Alleinsein.
Jeremy muss mit dem Tod eines Familienmitglieds fertig werden. Melody hat in einem pubertätsbedingten Aussetzer um des schieren Dramas willen bei einer Party Alkohol und ein paar Tabletten geschluckt. Seither gilt sie in der Schule als ein bisschen unheimlich, vielleicht sogar gefährlich. Ein dummer Spitzname trägt dazu bei, dass die Distanz zwischen ihr und ihren früheren Freundinnen unüberwindbar scheint.
Jeremy überwindet diese Distanz, ohne mit der Wimper zu zucken. Melody ist beeindruckt. Als er anfängt, umgehend vom Tod zu reden, stört sie das wenig. Bei ihr zu Hause wird häufig davon gesprochen. Ihre Mutter ist eine engagierte Gegnerin der Todesstrafe. Für Melody sind Hinrichtungstage so wichtige Daten wie in anderen Familien Geburtstags- oder Hochzeitstage.
Dann kommt die Liebe ins Spiel und Jeremys Todessehnsucht. Melody findet sich in einem klebrigen Netz wieder, dessen Fäden Scham, Schuld, Verdrängung, Trotz, Unreife und Selbstsucht heißen.
Verkennung der Lage
Selbsttötung und die Frage, ob es eine Bedeutung hat, das Leben zu leben, werden von Stevenson breit behandelt. Das an der Auseinandersetzung über die Todesstrafe zu spiegeln – der Roman spielt im Bundesstaat Florida – gibt dem Thema eine neue Perspektive. Wer darf töten, unter welchen Umständen ist der Tod eine Strafe und wer entscheidet, ob sie verdient ist? Hier entfaltet sich ein ganzes Spektrum. Stevenson berührt das meiste nur eben. Das liegt an der Größe des Themas, aber auch daran, dass sie ihre Leserinnen unablässig herausfordert. Man kann sich an jeder Stelle auf eine Diskussion einlassen.
Natürlich lesen Melody und Jeremy Camus. Jeremy beruft sich auf den Ausspruch des Fremden, nach dem es unwesentlich ist, wann und wie man stirbt, da Menschen ohnehin sterben. Der Satz fällt unvermittelt, ein Felsstein sehr früh im Text, an dem man sich beim Lesen gleich erste blaue Flecke holt. Dass sich Melody gleich darauf an ein Gespräch mit ihrem Onkel, einem Befürworter der Todesstrafe erinnert, betont nur die Schwere der Frage.
Vergangenes und Gegenwart werden immer wieder geschnitten, wenn auch nicht klar getrennt. Melody erzählt im Rückblick, wechselt von vorher auf jetzt und wieder zurück. Das ist bestens ausgearbeitet und nicht verwirrend, auch wenn man beim Lesen gut beraten ist, zu beachten, wann die Vergangenheitsform und wann das Präsens auftaucht. Es ist überdies wichtig, weil Stevenson tatsächlich eine Diskussion führt, Für und Wider vorstellt, einmal, zweimal, fünfmal. Die Argumente und Gegenargumente purzeln nur so herbei.
Tatsächlich ist all das, so wichtig es ist und so wichtig für die Konstruktion des Romans, nicht das eigentliche Thema. Worum es Stevenson geht, ist die unangenehme Eigenart von Menschen, die reale Lage zu verkennen und Gefühle und Wünsche für die Realität zu halten. Je unklarer die Gefühle sind, desto eher. Teenager sind sehr gut geeignet für eine solche Prämisse, aber so manches, was Stevenson darstellt, gilt auch für Erwachsene und nicht nur die in ihrem Buch.
Zu sich finden oder Existenzialismus 2018
Die Geschichte beginnt herb, mit der Enthüllung eines Pakts zur Selbsttötung. Die Situation ist dramatisch und emotional, dabei unsentimental und bis ins Kleinste analysiert. Melody muss sich binnen Sekunden entscheiden, ob sie mit Jeremy sterben will oder nicht. Ihre Entscheidung macht sie für andere zur Heldin, für sich selbst nicht. Sie weiß, dass sie zu spät entschieden hat. Der Grund dafür war ihre Sehnsucht, ihre Verliebtheit zu leben und nicht zu akzeptieren, dass diese einseitig war. Dahinter steckt wiederum der Umstand, dass Melody sehr auf sich gestellt ist. Obwohl ihr Elternhaus ein sicheres Fundament ist, ist sie ein einsames Individuum.
Einsam ist auch Jeremy. Bei ihm scheint die Lage eindeutig, seine Eltern sind kein sicherer Hintergrund. Jeremy ist ein Jugendlicher auf ewiger Suche, nach Sicherheit, Selbstvergewisserung, nach Eindeutigkeit. Nur der Tod scheint das zu bieten. Keine Frage, dass er sich auf einen Flirt mit ihm einlässt. Im Lauf der Geschichte wird auch deutlich, was ihn an Melody wirklich faszinierte. Die Übersetzung des Spitznamens aus dem Original in ›Todesengel‹ ist ein echter Wurf und bringt eine besondere Note in die Seltsamkeit der Beziehung.
Für Leserinnen ist Jeremys Charakter schwer zu fassen. Man muss sich mit jemandem abfinden, der nur um sich kreist. Stevenson bietet damit aber eine höchst interessante Hauptfigur, weil sie strikt dabeibleibt, dass Menschen Individuen sind. Das heißt aber auch einsam. Das ist eine reizvolle Koppelung der Vorstellung des einsamen Menschen der Moderne mit der Behauptung der uneingeschränkten Entscheidungsfreiheit des Menschen im etwas grob gefassten Existenzialismus. Ihr Bild dafür sind Theorien aus der Astrophysik – es kann gar nicht weit genug sein für die Autorin.
So stellt sie Melody eine Achtjährige an die Seite, die hochbegabte Suzy, die es übernehmen darf, ihre mäßig interessierte Babysitterin über die Entstehung Schwarzer Löcher, den Ereignishorizont und den Tod von Riesensternen aufzuklären. Das ist so faszinierend gestaltet, so unaufdringlich eingeflochten, dass man es beim Lesen hinnimmt, als sei es das Natürlichste der Welt. Beeindruckend.
Suzy selbst hat ihre Probleme, Mobbing. Mal wieder, will man augenverdrehend sagen, aber dann fällt einer auf, dass Mobbing eine Art sozialer Tod ist und so ist man eben auch beim Thema. Stevenson wählt ihre Facetten definitiv nicht aus dem Baukasten der herkömmlichen Jugendromane.
Vermittelt das Buch Trost? Hoffnung? Nicht unbedingt, denn darum geht es nicht. Die Geschichte der unguten Verstrickung von Jeremy und Melody stärkt eher das Selbstbewusstsein jugendlicher Leserinnen und Leser. Sie verweist darauf, dass man zwar einsam ist, aber es in der Entscheidung einer jeden und eines jeden liegt, die Lage zu ändern. Dafür muss aber genau hinsehen und hinhören. Sich nicht abfinden mit dem, was ist.
Melodys Mutter muss es wieder und wieder erleben, dass Gnadengesuche abgelehnt werden, sie kämpft weiter. Melody schluckt ihren Trotz gegenüber ihren Freundinnen. Jeremy läuft der Selbstvergewisserung und Eindeutigkeit hinterher. Seine Entscheidung. Ob sie gut ist oder schlecht? Richtig oder falsch? Stevenson gibt keine Antwort. Eine starke Art, eine Hauptfigur zu verabschieden, passend zu einem starken Buch.
Titelangaben
Robin Stevenson: Die Unmöglichkeit des Lebens
(2015 The World without Us) Aus dem amerikanischen Englisch von Inge Werhrmann.
Weinheim: Beltz & Gelberg 2019
233 Seiten, 13,95 Euro
Jugendbuch ab 15 Jahren
Reinschauen
| Leseprobe