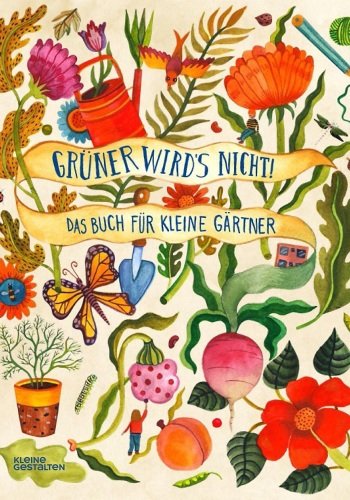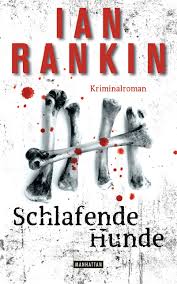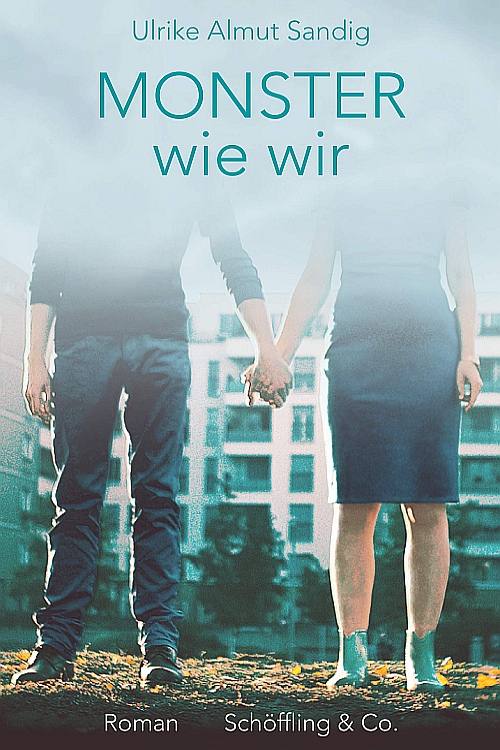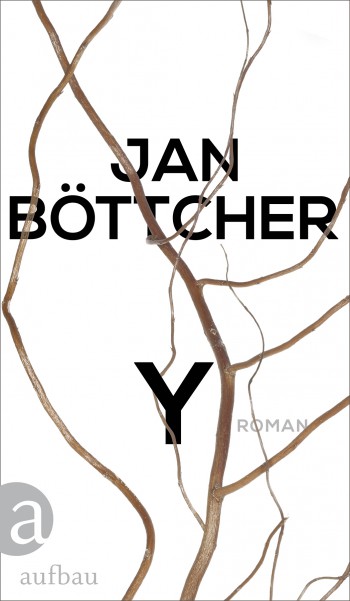Roman | Kenzaburo Oe: Der nasse Tod
Eigentlich wollte er mit 60 Jahren aufhören zu schreiben, doch kurz vor Erreichen dieser selbst gesetzten Altersgrenze kam ihm der Nobelpreis »dazwischen«. »Kenzaburo Oe hat mit poetischer Kraft eine imaginäre Welt geschaffen, in der Leben und Mythos zu einem erschütternden Bild der Lage des Menschen in der Gegenwart verdichtet werden«, lobte das Nobelkomitee den Preisträger des Jahres 1994. Oe selbst wertete seine Ehrung stets als Auszeichnung für die gesamte japanische Literatur. Von PETER MOHR
 Sein 2009 im Original erschienener und nun in deutscher Übersetzung vorliegende Roman ›Der nasse Tod‹ kommt wie eine Essenz aus dem bisherigen Werk daher, durchweht von Altersmelancholie und getragen von einem stark autoreferentiellen Habitus. Der inzwischen 83-jährige japanische Autor spielt mit seiner eigenen Autobiografie und mit seiner Existenz als Schriftsteller – getarnt hinter der Fassade seines literarischen Ego Kogito Choko, das ihn schon seit vielen Jahren begleitet.
Sein 2009 im Original erschienener und nun in deutscher Übersetzung vorliegende Roman ›Der nasse Tod‹ kommt wie eine Essenz aus dem bisherigen Werk daher, durchweht von Altersmelancholie und getragen von einem stark autoreferentiellen Habitus. Der inzwischen 83-jährige japanische Autor spielt mit seiner eigenen Autobiografie und mit seiner Existenz als Schriftsteller – getarnt hinter der Fassade seines literarischen Ego Kogito Choko, das ihn schon seit vielen Jahren begleitet.
Er lässt Choko einen bilanzierenden Vater-Sohn-Roman schreiben und erzählt von dessen literarischem Scheitern an den eigenen, hochgesteckten Zielen. Und genau diesen Roman über Kenzaburo Oe selbst und sein ambivalentes Verhältnis zu seinem Vater lesen wir auf einer zweiten Erzählebene, auf der sich Erinnerungen, Träume, Fantasien und Fiktion zu einer bunten Melange vermischen.
Da ist das handlungstragende Einstiegsbild (egal ob Erinnerung, Traum oder Fiktion), als der Vater kurz vor Kriegsende in einem Boot sitzt, in das der Ich-Erzähler als Kind selbst hineinspringen will. Doch der Versuch scheitert, das Boot wird von der Strömung des Hochwassers davon getragen.
Der Vater wird später tot an Land gespült, alles deutet auf Suizid als Ursache für den »nassen Tod«. Die Schmach der sich anbahnenden Kriegs-Niederlage konnte er offensichtlich nicht ertragen. Der Vater sympathisierte mit ultranationalistischen Offizieren, die einen Anschlag auf den zur Kapitulation bereiten Tenno planten.
Kenzaburo Oe blickt durch die Kogito-Figur auf sein eigenes literarisches Werk, das er von einer avantgardistischen Theatergruppe aufführen lässt. »Werden Ihre Romane noch als richtige Romane wahrgenommen?«, lässt er einen besorgten Leser fragen. Dieses Buch-im-Buch-Projekt ist durchkomponiert von A bis Z und liefert eine durchaus kritische Lebensbilanz aus der subtil arrangierten, fiktiven Außenperspektive. Trotz der unübersehbaren biografischen Parallelen zwischen dem Autor und der Kogito Choko-Figur ist durch die eingefügte Meta-Ebene nichts handfest verbürgt. Fakten und Fiktion sind bei der Lektüre nicht zu trennen.
Oe rechnet in seinem (leider) etwas ausufernden erzählerischen Vermächtnis mit dem japanischen Nationalismus und dem Tenno-Kult ab, gleichzeitig wirft er leicht wehmütig einen Blick zurück auf seine relativ unbeschwerte Kindheit auf der Insel Shikoku. Der Nobelpreisträger rekonstruiert mit großem Elan seinen eigenen Lebensweg, hält in der Rückschau an biografischen Weggabelungen inne, spielt Möglichkeiten durch und gefällt sich in der Rolle des Sich-Selbst-Neuerfinders auf der Schlussetappe des Lebens, dessen Gegenwart geprägt ist vom altersbedingten körperlichen Verfall, von nachlassender Konzentration, Kreislaufproblemen, Schwindelanfällen, von der Krebserkrankung seiner Frau und den Schwierigkeiten mit seinem behinderten Sohn.
Glücksmomente waren im Oeuvre von Kenzaburo Oe zwar stets dünn gesät, aber Der nasse Tod liest sich wie der finale Abgesang eines großen Autors, wie ein Konglomerat aus Schmerz und Selbstzweifel.
Titelangaben
Kenzaburo Oe: Der nasse Tod
Aus dem Japanischen von Nora Bierich
Frankfurt/M.: S. Fischer Verlag 2018
432 Seiten, 20.- Euro
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander
Reinschauen
| Leseprobe
| Peter Mohr zu Kenzaburo Oe in TITEL kulturmagazin