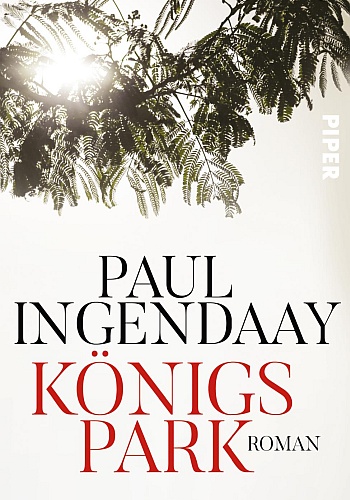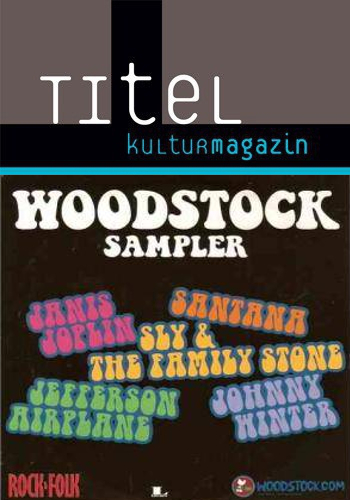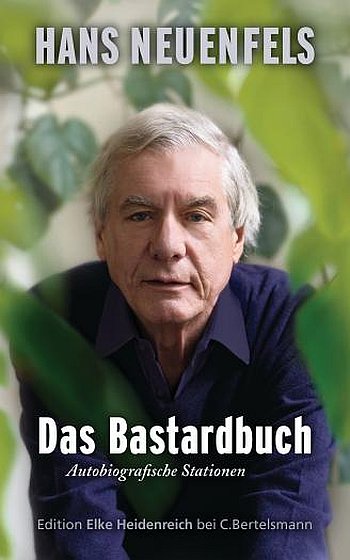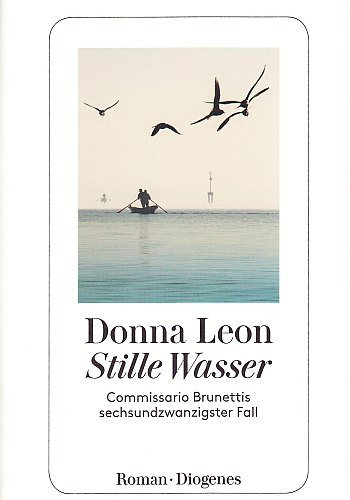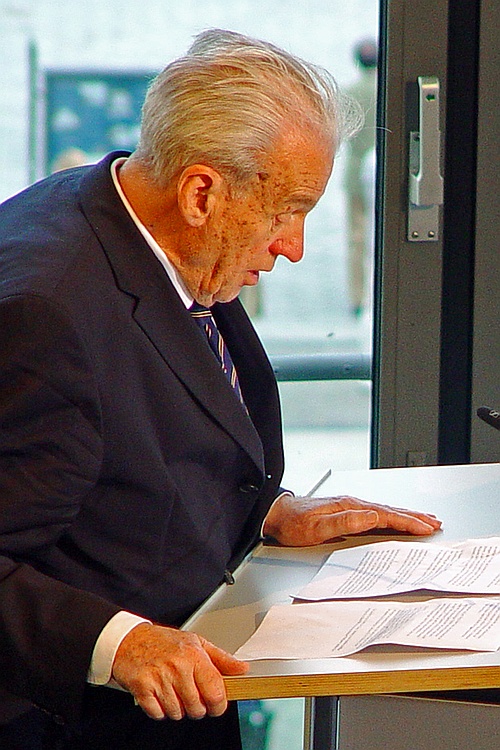Tagbücher | Edition der Beneke-Tagebücher
Wenn ein bedeutender Zeitzeuge über fünf Jahrzehnte hinweg tagtäglich Aufzeichnungen über seine Erlebnisse, Begegnungen und Überlegungen macht, so ist das schon ungewöhnlich genug und verdient allergrößte Beachtung. Ist dieser Tagebuchschreiber aber dazu noch ein einflussreicher Jurist und Politiker, so darf man von seinen Notaten gewichtige Aufschlüsse nicht nur über seine Person, sondern mehr noch über seine ganze Epoche erwarten. Das ist in der Tat der Fall bei Ferdinand Beneke (1774-1848), dem in Hamburg wirkenden Juristen und überzeugten Republikaner, dessen gewaltiges Tagebuchwerk bereits in zwei Buchkassetten vorliegt und jetzt vom Wallstein Verlag um eine weitere Sektion ergänzt worden ist. Von PETER ENGEL
 In den acht neuen Bänden geht es um den Zeitraum von 1802 bis 1810, der ganz im Zeichen von Napoleons Machtpolitik stand und für Hamburg die Besetzung durch französische Truppen mit entsprechenden Drangsalierungen bedeutete. Die politischen Ereignisse in jener Dekade brachten Beneke in engen Kontakt mit preußischen Patrioten und Reformern, mit denen er – aus französischer Sicht – teilweise sogar in konspirativer Verbindung stand. Aber nicht nur die große Politik beschäftigte ihn in jenen Jahren intensiv, auch sein privates Glück stand auf dem Spiel, denn er hatte nach den Höhen und Tiefen einer unerfüllten Liebe endlich heiraten und einen eigenen Hausstand gründen können.
In den acht neuen Bänden geht es um den Zeitraum von 1802 bis 1810, der ganz im Zeichen von Napoleons Machtpolitik stand und für Hamburg die Besetzung durch französische Truppen mit entsprechenden Drangsalierungen bedeutete. Die politischen Ereignisse in jener Dekade brachten Beneke in engen Kontakt mit preußischen Patrioten und Reformern, mit denen er – aus französischer Sicht – teilweise sogar in konspirativer Verbindung stand. Aber nicht nur die große Politik beschäftigte ihn in jenen Jahren intensiv, auch sein privates Glück stand auf dem Spiel, denn er hatte nach den Höhen und Tiefen einer unerfüllten Liebe endlich heiraten und einen eigenen Hausstand gründen können.
In den buchstäblich täglich geführten Notizen, die mitunter auch sehr ausführlich sind, erlebt man den Juristen und Familienvater bei seinen täglichen Verrichtungen, wobei das Private und das öffentliche Wirken eine bunte und sich gegenseitig bedingende Mischung eingehen. Die Aufzeichnungen sind damit nicht nur eine Quelle ersten Ranges für die Hamburger Stadtgeschichte, sondern nicht minder interessant für die deutsche Kulturgeschichte jener Zeit überhaupt und spiegeln in dieser Doppelfunktion das gehobene Bürgertum, das sich seiner gesellschaftlichen Bedeutung zunehmend bewusster wird.
Durch seine zahlreichen Beziehungen zu Menschen aus allen Schichten der Stadtbevölkerung und durch seine brieflichen Kontakte mit Intellektuellen im ganzen deutschen Sprachbereich war Beneke so »vernetzt« wie nur wenige Exponenten seiner Epoche. In diese vielfältigen Verflechtungen leuchten seine genauen und pointierten Aufzeichnungen hinein, sodass der Leser ein farbiges und detailfreudiges Bild jener Jahre gewinnt, in denen sich der Übergang von der Spätaufklärung zur Romantik vollzog. Beneke war beispielsweise am 22. März 1803 Zeuge des langen Trauerzugs für den damals hochverehrten Dichter Friedrich Gottlieb Klopstock und erlebte mit, wie zahlreiche Menschen dem Sarg durch die ganze Stadt folgten. Auch den Juristen ergriff angesichts der ganz ungewöhnlichen Anteilnahme der Bevölkerung die »innigste Rührung«, wie er noch am gleichen Tag notierte.
Eher am Rande erlebte Beneke mit, wie der Goethe-Maler Wilhelm Tischbein in der Hansestadt eine Zeichenschule zu gründen versuchte, nachdem er 1799 vor napoleonischenTruppen aus Neapel in deutsche Lande geflohen war und seit 1802 in Hamburg lebte. Auch der städtische Klatsch in den »besseren« Schichten Hamburgs kommt in den Aufzeichnungen des Juristen nicht zu kurz, und namentlich die örtliche Damenwelt findet sein besonderes Interesse. So registriert er etwa erfreut, dass ihn eine umschwärmte hanseatische Schönheit wie die Madame van Nuys, eine »immer Sieggewohnte«, mit einer Einladung ehrt, aber er ist durch ihr souveränes Auftreten eher etwas verunsichert und traut der Sache nicht recht, hält sich dann lieber an die »viel liebenswürdigere« Tochter. Solche Schlaglichter auf die Sittengeschichte der Stadt würzen die Aufzeichnungen zusätzlich.
Wie stark Beneke in die Hamburger Politik eingebunden war, zeigt etwa der Umstand, dass er 1802 in einem Ausschuss der 1765 gegründeten Patriotischen Gesellschaft an der Erarbeitung des Entwurfs für eine neue Staatsverfassung beteiligt war. Aber dieses Wirken wurde unterbrochen, als Truppen Napoleons am 12. November 1806 die Hansestadt besetzten. Nach anfänglicher Verkennung sah Beneke in dem Korsen mehr und mehr den Tyrannen, der republikanische Errungenschaften außer kraft setzte und gegen den der Jurist, zusammen mit anderen Patrioten aus den deutschen Ländern, den Widerstand zu mobilisieren versuchte. Am Ende der napoleonischen Epoche gehörte er denn auch zu den entscheidenden Handlungsträgern, die die Befreiung Hamburgs vom »französischen Joch« erreichten.
Nachdem jetzt durch die neu vorgelegte Sektion die Beneke-Tagebücher für den Zeitraum von 1792 bis 1816 geschlossen vorliegen, darf man auf die restlichen Bände gespannt sein und wird dann ein Editionsunternehmen abschließend würdigen können, das seinesgleichen in Deutschland nicht hat.
Titelangaben
Ferdinand Beneke: Die Tagebücher II (1802-1810)
Hg. von Frank Hatje und anderen
Göttingen: Wallstein Verlag 2019
3.904 S., 204 Abb., 128 Euro
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander
Reinschauen
| Leseprobe