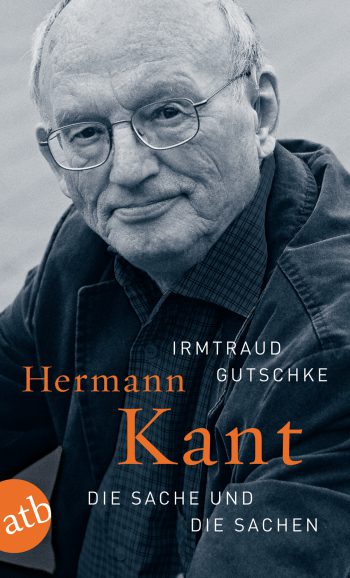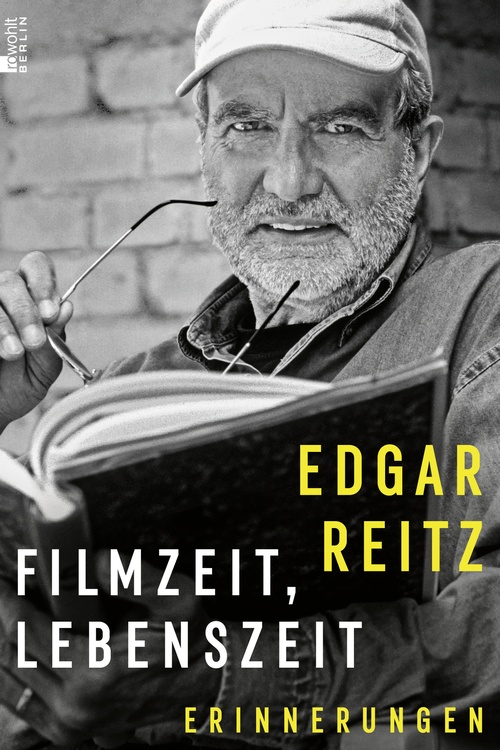Menschen | Zum Tod der Literatur-Nobelpreisträgerin Toni Morrison
»Die Sehnsucht nach einem Zuhause existiert zwar nach wie vor, aber es handelt sich dabei lediglich um eine Illusion. Und natürlich gibt es in Amerika nicht eben wenige, die ihr ganzes Leben auf diese trügerische Sehnsucht bauen, die niemals Realität werden kann«, hatte Toni Morrison, Nobelpreisträgerin des Jahres 1993, vor fünf Jahren in einem Interview mit der ›Welt‹ Auskunft über ihr disparates Verhältnis zu ihrem Heimatland gegeben. Sie war umstritten und streitbar, aber nach ihr wurde keinem US-Autor mehr die bedeutendste Auszeichnung der literarischen Welt zuteil. Von PETER MOHR
Ihr Meisterwerk habe sie noch nicht geschrieben. Es komme noch, hatte die Literaturnobelpreisträgerin Toni Morrison vor etwas mehr als zehn Jahren ziemlich kokett erklärt und damit große Erwartungen bezüglich der dann folgenden Romane ›Gnade‹ (2010) und ›Heimkehr‹ (2014) geweckt. Doch keiner der beiden Romane konnte dieser Erwartungshaltung gerecht werden.
Thematisch knüpfte ›Gnade‹ an den mehr als 25 Jahre alten Vorgängerroman ›Menschenkind‹ an und lieferte so etwas wie eine temporeiche, leicht überladene erzählerische Vorgeschichte, in deren Mittelpunkt vier Frauen am Ende des 17. Jahrhunderts stehen. Ihre höchst unterschiedlichen Lebenswege kreuzen sich in der gesetzlosen Welt von Sklavenhandel, aufkommendem Rassismus und ersten kapitalistischen Auswüchsen. ›Gnade‹ kam im amerikanischen Original eine Woche vor Barak Obamas Wahl auf den Markt und liest sich einfühlsam, bedrückend und abenteuerlich zugleich, doch die Qualität von ›Menschenkind‹ mit seinem ungleich längeren erzählerischen Atem blieb unerreicht.
Nicht wesentlich anders war es um Toni Morrisons zehnten Roman ›Heimkehr‹ bestellt, der auch Fragmente aus der eigenen Familiengeschichte aufgriff. Der Protagonist Frank Money nahm (wie Morrisons Bruder) mit einigen Freunden als Freiwilliger am Korea-Krieg teil und kehrte als Einziger aus diesem Kreis heim – schwer traumatisiert ob des Verlustes seiner Freunde und der erlebten Verbrechen im Namen seines Vaterlandes. Auch diese dramatische »Story« um den heimatlosen Koreakämpfer war nicht das avisierte, späte Meisterwerk.
»Sklavenhandel und Sklaverei sind Themen, an die sich niemand erinnern will. Weder die Schwarzen noch die Weißen. Ich meine, es herrscht eine nationale Amnesie«, erklärte Toni Morrison im Zusammenhang mit ihrem 1988 erschienenen Erfolgsroman ›Menschenkind‹, für den sie mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet worden war und der 1999 (Regie: Jonathan Demme, Hauptdarstellerin: Oprah Winfrey) auch in den deutschen Kinos zu sehen war.
Das Schicksal der Farbigen in den USA war eines der ständig wiederkehrenden Themen in Toni Morrisons Werk. Für ihr Frühwerk ›Salomons Lied‹ (1977) – die Erforschung der Familiengeschichte eines einfachen Milchmannes – erhielt sie bereits den Preis der amerikanischen Literaturkritiker, die dieses Werk auf eine Stufe stellten mit Alex Haileys ›Roots‹.
Toni Morrison, die am 18. Februar 1931 unter dem bürgerlichen Namen Chloe Anthony Wofford in Lorain/Ohio geboren wurde, schloss ihr Studium an der renommierten Cornell University mit einer Arbeit über den Selbstmord in den Werken von William Faulkner und Virginia Woolf ab. Danach arbeitete sie zunächst als Lektorin bei Random House und später als Professorin in Princeton.
Unter dem Einfluss von James Baldwin hatte Toni Morrison bereits 1960 zu schreiben begonnen, doch bis zur Veröffentlichung ihres ersten Romans dauerte es zehn Jahre. »Spracharbeit ist das Maß eines gelungenen Lebens«, erklärte sie in ihrer Stockholmer Dankesrede, als sie 1993 als erste farbige Autorin den Nobelpreis erhielt.
Sprachlich und kompositorisch hat sich Toni Morrison von ihren Anfängen bis in die Gegenwart gewaltig weiter entwickelt. Geblieben waren aber ihr ungebremster Aufklärungswille und ihr leidenschaftliches emanzipatorisches Grundmotiv. »Rassismus ist heute so virulent wie zur Zeit der Aufklärung«, erklärte Toni Morrison vor einigen Jahren.
 Sie ist nicht nur gegen die Unterdrückung der Farbigen schreibend zu Felde gezogen, sondern hat auch immer für die Rechte der Frauen gestritten – zuletzt im 1999 in deutscher Übersetzung erschienenen Roman ›Paradies‹. Ihr bis heute gelungenstes, weil formal anspruchsvollstes Werk ist die Ballade ›Jazz‹ (1992), die von amerikanischen Kritikern als »eine Mischung aus Duke Ellington, William Faulkner und Maria Callas« bezeichnet wurde. In diesem postmodernen Sprachspiel hat Toni Morrison, die 2011 zur Ritterin der französischen Ehrenlegion geschlagen wurde, aus jazzartigen Versatzstücken ein blutiges Beziehungsgeflecht zwischen drei Frauen und einem Mann komponiert.
Sie ist nicht nur gegen die Unterdrückung der Farbigen schreibend zu Felde gezogen, sondern hat auch immer für die Rechte der Frauen gestritten – zuletzt im 1999 in deutscher Übersetzung erschienenen Roman ›Paradies‹. Ihr bis heute gelungenstes, weil formal anspruchsvollstes Werk ist die Ballade ›Jazz‹ (1992), die von amerikanischen Kritikern als »eine Mischung aus Duke Ellington, William Faulkner und Maria Callas« bezeichnet wurde. In diesem postmodernen Sprachspiel hat Toni Morrison, die 2011 zur Ritterin der französischen Ehrenlegion geschlagen wurde, aus jazzartigen Versatzstücken ein blutiges Beziehungsgeflecht zwischen drei Frauen und einem Mann komponiert.
Toni Morrison, die international anerkannte Stimme der farbigen US-Bevölkerung und enge Vertraute von Ex-US-Präsident Barack Obama, ist nun im Alter von 88 Jahren in New York gestorben.
| PETER MOHR
| TITELFOTO: Angela Radulescu, Toni Morrison 2008-2, CC BY-SA 2.0