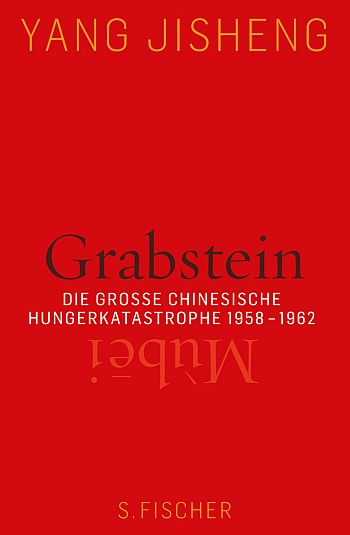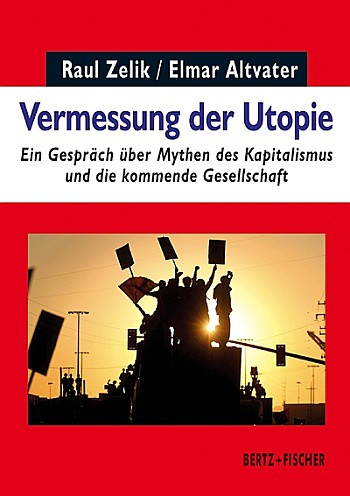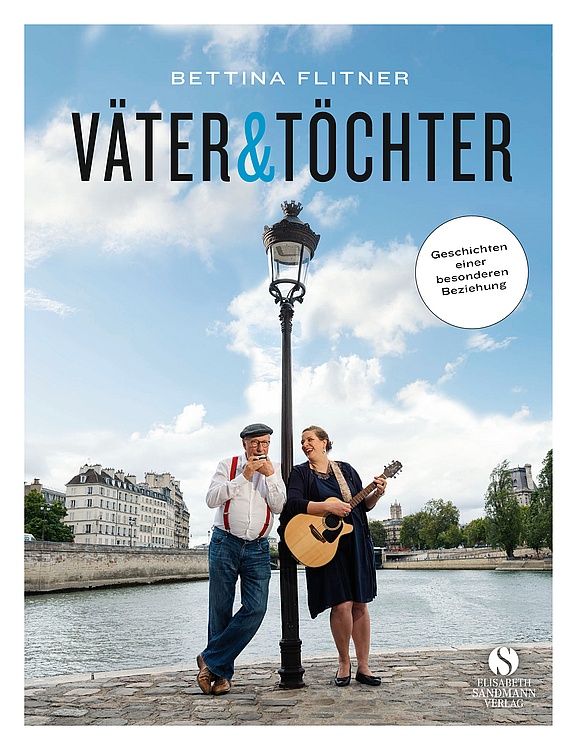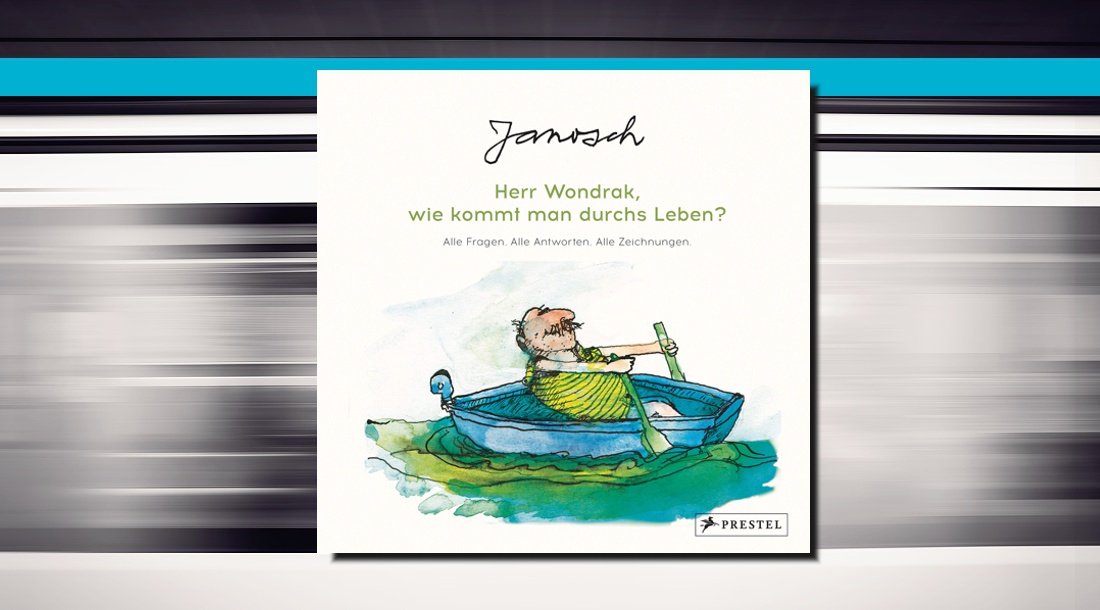Wenn einer etwas zur Melancholie zu sagen hat, dann ist es der ungarische Geisteswissenschaftler László F. Földényi. In seinem neuesten Essayband versammelt er Gedanken zu melancholisch-metaphysischen Abgründen in Architektur, bildender Kunst und Film. Und überrascht dabei mit seinem Gespür für die Körperlichkeit der Melancholie, die »mehr ist als nur ein Gefühl.« Von JALEH OJAN
 »I’m in love with my sadness«, singt Billy Corgan im Smashing-Pumpkins-Song ›Zero‹. Wenn sich der ungarische Autor László F. Földényi nun 35 Jahre nach Erscheinen seiner großen Monographie zum Thema nun erneut der Melancholie in ihren unzähligen Erscheinungsformen widmet, klingt auch das nach einer leichten Besessenheit von der »Schwarzgalligkeit« (gr. »melancholia«). Nun hat die Melancholie zwar nichts mit Missmut oder Traurigkeit zu tun, wie der Autor nicht müde wird zu betonen.
»I’m in love with my sadness«, singt Billy Corgan im Smashing-Pumpkins-Song ›Zero‹. Wenn sich der ungarische Autor László F. Földényi nun 35 Jahre nach Erscheinen seiner großen Monographie zum Thema nun erneut der Melancholie in ihren unzähligen Erscheinungsformen widmet, klingt auch das nach einer leichten Besessenheit von der »Schwarzgalligkeit« (gr. »melancholia«). Nun hat die Melancholie zwar nichts mit Missmut oder Traurigkeit zu tun, wie der Autor nicht müde wird zu betonen.
Doch es stimmt schon, dass der ungarische Kunsttheoretiker, Essayist und Literaturwissenschaftler die Melancholie im Laufe der Jahre nie wirklich aus dem Blick verloren hat. Einen Großteil seiner Arbeiten widmete er weltbekannten melancholischen Künstlern wie Caspar David Friedrich, Blake und Kafka. Auch der Titel seines Essays »Dostojewski liest Hegel in Sibirien und bricht in Tränen aus« spricht Bände.
In seinem neuesten kulturphilosophischen Essayband ›Lob der Melancholie‹ (Matthes & Seitz) spürt Földényi den oftmals ganz subtilen Spuren nach, die »Melancholia« in Architektur, bildender Kunst, Film und Literatur hinterlassen hat. Es ist ein Versuch, zum Wesen der Melancholie vorzudringen, wohl wissend, dass sie im Grunde nicht fassbar, ja noch nicht mal klar definierbar ist. Von der Melancholie könne man nichts wissen, man könne sie lediglich erahnen. Ihr wohne ein Mehrwert inne, und »gerade dieser Mehrwert bewirkt, dass sich die Melancholie überall bemerkbar machen kann« – in Kummer und Hochstimmung, Lethargie und Aufmerksamkeit.
Es sagt viel über Földényis Verständnis von der Melancholie aus, wenn er sie in seinen Essays oftmals so weit in den Hintergrund treten lässt, dass man mitten in der Lektüre gelegentlich innehalten muss und sich fragt, welchen Titel man da eigentlich in der Hand hält. Doch sie beherrscht zweifellos den Subtext, die Mittlerin der »rätselhaften Botschaften«. Und enigmatisch sind ihre Botschaften tatsächlich.
Zumindest wenn es nach Földényi geht, der in Francis Bacons Porträt-Triptychon Three Studies of Lucian Freud eine neue, »aus dem Mangel sich nährende« Metaphysik zu erkennen glaubt. Über Bacon, aber auch über die »archetypischen« melancholischen Kunstwerke wie Dürers Kupferstich »Melencolia I« oder Giorgiones Gemälde »Das Gewitter« schreibt Földényi in flüssig zu lesender Sprache, oft mit geradezu ansteckendem Enthusiasmus. Wirklich faszinierend werden seine Essays aber erst dort, wo er sich auf bislang unbeackertes Terrain vorwagt und Gedanken aufs Tapet bringt, die einen geradezu zwingen, alles infrage zu stellen, was man bisher über die Melancholie zu wissen geglaubt hat.
Zwischen all den kunsthistorischen Beobachtungen überrascht nämlich ein Exkurs zum Film ›2001: A Space Odyssey‹. Földényi erinnert der Monolith aus Stanley Kubricks Meisterwerk an den Polyeder auf Dürers Stich, über dessen Bedeutung sich die Forscher bis auf den heutigen Tag das Hirn zermartern. Weitere Verkörperungen dieses Rätsels findet er in Anselm Kiefers Skulptur ›Hypatia‹, aber auch in der Bruder-Klaus-Kapelle des Schweizer Architekten Peter Zumthor: Ein Steinblock von ungewöhnlicher geometrischer Struktur, der mit der ihn umgebenden Landschaft verschmilzt und für Földenyi zu einem »tiefe[n] Raumerlebnis« wird.
Zum Thema »Lichtspiele« spannt Földényi einen weiten Bogen von alten Filmpalästen über die frühe Fotografie bis hin zu Richters Glasfenster im Kölner Dom. Ebenso spannend – und schlüssiger als zunächst vermutet – sind auch die Zusammenhänge, die er zwischen Kafka, Tattookunst und der »berechnenden, emotionslosen« Logik der Pornografie herstellt. Und schließlich darf der Leser miterleben, wie Földényi in Gestalt seines weltentrückten Freundes Michael H. Parkinson eine Art personifizierte Melancholie trifft. Wenn der Ungar vom »Wiedersehen« mit seinem alten Bekannten auf den Seiten eines Buches erzählt, gehört dies fraglos zu den Glanzpunkten dieses Bandes, der insgesamt sehr persönlich gehalten ist.
Doch seine Exkurse zu Kubrick und Körperkult können nicht darüber hinwegtäuschen, dass der ungarische Autor die Trennung zwischen Hoch- und Popkultur gerade nicht aufhebt, sondern vielmehr betont. Im Zusammenhang mit dem Vorgängerwerk ›Melancholie‹ (München 1988) sagte Földényi einmal: »Das Leben heute ist ja so geplant, dass man eigentlich nicht Melancholiker sein darf.« Da klingt ein gewisser Trotz an; das Bedürfnis, sich mit seinem Gespür für die existenzielle Bodenlosigkeit in einer auf Oberflächlichkeit gründenden Gesellschaft rechtfertigen oder behaupten zu müssen.
Von dieser latenten Verbitterung scheint er sich in der Zwischenzeit nicht befreit zu haben. Eher im Gegenteil: Földényi klingt in seinen neuen Essays vor allem kulturpessimistisch.
Sicher hat er nicht ganz Unrecht, wenn er in Multiplexkinos und »Smombies« Symptome einer modernen Sklavengesellschaft sieht. Aber man muss kein Millennial sein, um sich daran zu stören, dass er sich mit seiner Kritik auf die Generation Y einschießt. Scheinbar entgeht dem Autor, dass es auch unter den nach 2000 Geborenen noch genügend echte Cineasten gibt, darunter auch jene für die Melancholie empfänglichen Menschen, die »gewillt sind, sich aus der Welt draußen […] herausreißen zu lassen«. Und letztlich tragen ja nicht sie die Schuld am Zerfall der Filmpaläste, an die sich der Essayist im Kapitel »Abgesang auf das Kino« wehmütig erinnert.
Zudem bleibt die Frage, weshalb in Földényis melancholischem Universum keine einzige Künstlerin auftaucht. Frauen treten in seinen Essays zwar als Motive in der Kunst in Erscheinung, nicht aber als Denkerinnen und Künstlerinnen. Doch dies kann nicht allein der Tatsache geschuldet sein, dass Frauen in der Welt der Gelehrten und Künstler jahrhundertelang allenfalls eine marginale Rolle spielten. Földényi hat mit »Lob der Melancholie« ein wundersames und wunderbar nachdenklich machendes Buch geschrieben. Nur sein andro- und eurozentrisches Weltbild stimmt mehr als melancholisch.
Titelangaben
László F. Földényi: Lob der Melancholie: Rätselhafte Botschaften
Berlin: Matthes & Seitz 2019
280 Seiten, 30 Euro
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander
Reinschauen
| Leseprobe