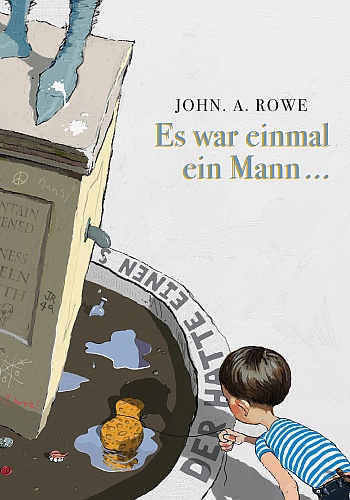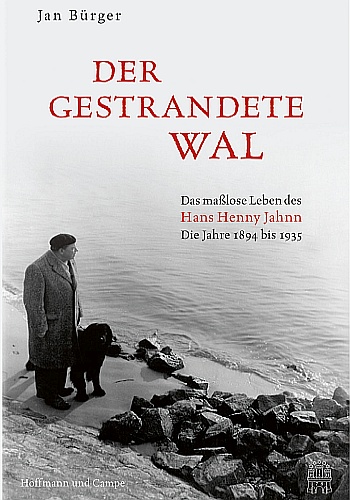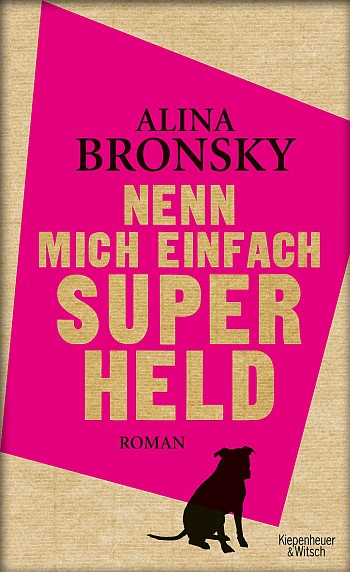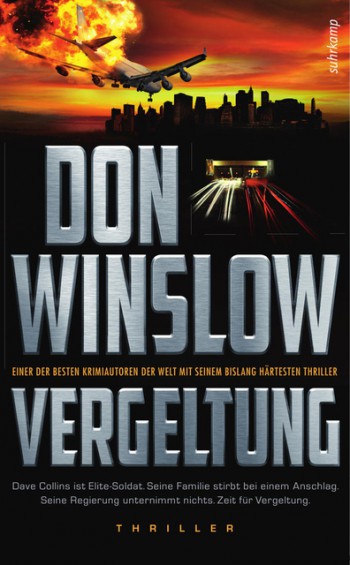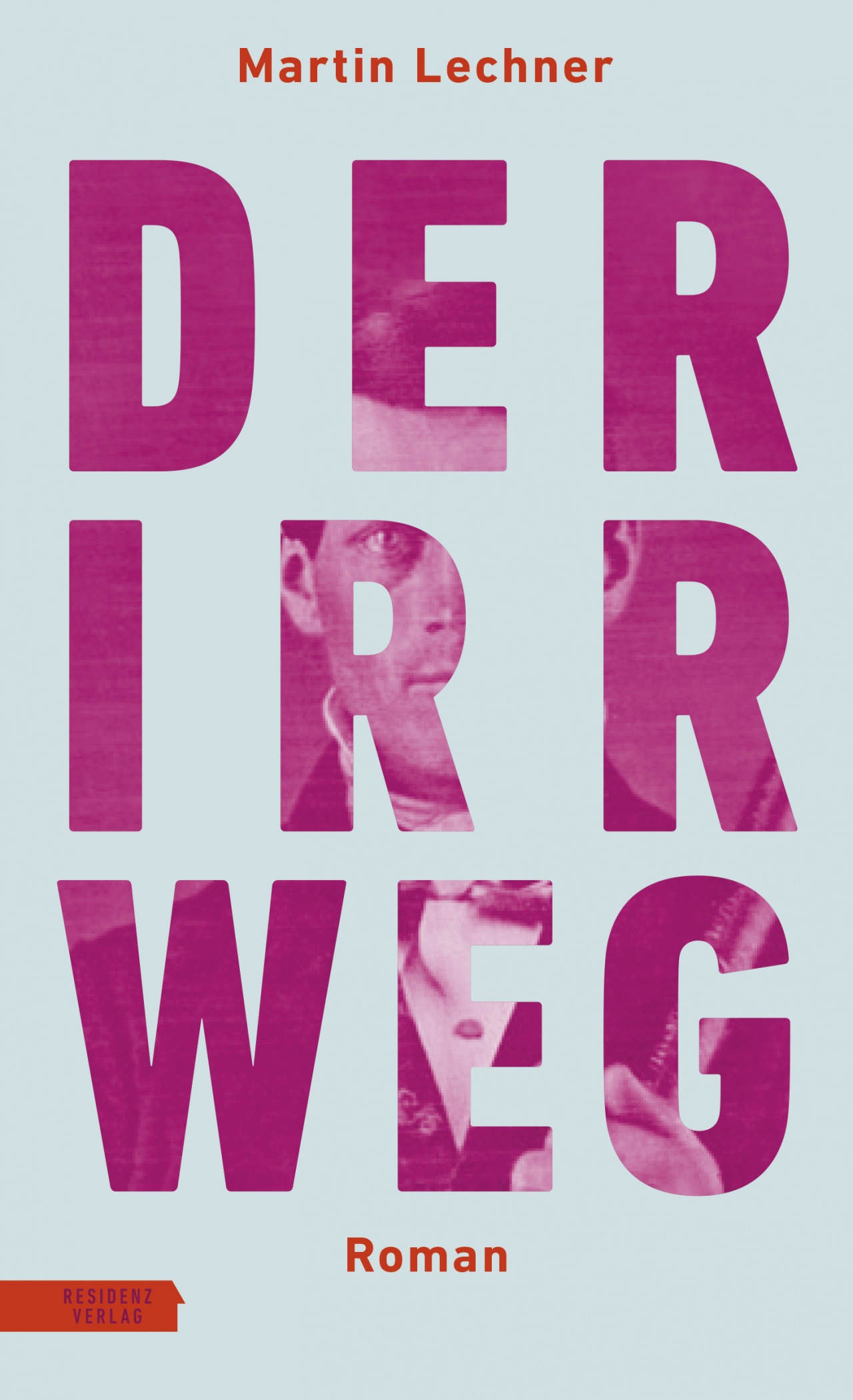Roman | Jan Brandt: Ein Haus auf dem Land / Eine Wohnung in der Stadt
Eine drängende soziale Frage unserer Zeit lautet: wo können wir, wie wollen wir leben? Angesichts der existenziellen Bedeutung des Wohnens hat der Schriftsteller Jan Brandt erneut seinen großen geplanten Auswandererroman vertagt und gleich zwei Bände in einem dazwischengeschoben. Ein Haus auf dem Land / Eine Wohnung in der Stadt birgt das ganze Ausmaß an Zerrissenheit zwischen einem entgleisten Immobilienmarkt und der eigenen Identitätssuche. Von INGEBORG JAISER
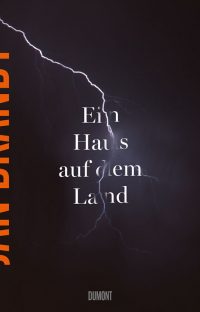 Was ist das? Ein Doppelband? Ein Wendebuch? Ein Heimatroman? Eine nordische Familiensaga? Eine wissenschaftliche Abhandlung? Der Stammbaum einer friesischen Händlerdynastie? Die Chronik der Gentrifizierung Berlins? Wer diesen gewichtigen Band in den Händen hält, wird ihn erst einmal irritiert drehen und wenden.
Was ist das? Ein Doppelband? Ein Wendebuch? Ein Heimatroman? Eine nordische Familiensaga? Eine wissenschaftliche Abhandlung? Der Stammbaum einer friesischen Händlerdynastie? Die Chronik der Gentrifizierung Berlins? Wer diesen gewichtigen Band in den Händen hält, wird ihn erst einmal irritiert drehen und wenden.
Ein Buch mit zweigeteiltem Umschlag in Schwarz und Weiß: auf der einen Seite geht ein dunkler Riss durch den brüchigen Putz, auf der anderen Seite zerteilt ein heller Blitz die Finsternis. Das orange Lesebändchen zwischen den Buchteilen mag kaum bei der Orientierung helfen.
Hohe Decken und ein Gefühl von Freiheit
Wo soll man anfangen? Optimisten werden wohl mit der hellen Hälfte beginnen: Eine Wohnung in der Stadt. Nach einem Auslandsjahr dank Erasmus-Programm kehrt der Autor 1998 nach Deutschland zurück. Nicht in seine friesische Heimat und nicht nach Köln, wo er zuvor studiert hat. Die einzige Großstadt, in der es sich als Schriftsteller leben lässt, ohne sich zu verbiegen oder mit Nebenjobs abzurackern, scheint Berlin zu sein. Ein berauschendes Bohème-Gefühl macht sich breit, auch angesichts der Legenden und Mythen über jene, die hier schon gelebt haben: Hans Fallada und Jörg Fauser, David Bowie und Iggy Pop.
Rasch taucht Brandt in einen hochproduktiven, künstlerischen Mikrokosmos ein, lernt andere Schriftsteller kennen, die bereits dem verheißungsvollen Lockruf gefolgt sind. »Wir wohnten in Wohnungen, die wir selbst renoviert hatten, mit Kohleofen oder Gasaußenwandheizern, die Dusche in der Küche, das Klo in der Kammer oder auf halber Treppe, aber mit hohen Decken und einem Gefühl von Freiheit, wie wir es so noch nie erlebt hatten.« Prekäre Wohnverhältnisse gehören zum Lebensstil.
Zuflucht und Wahlheimat
Doch auch Berlin – gleichermaßen Sehnsuchtsort und Wahlheimat für den ländlich sozialisierten Brandt, der schon mal als »alter Friesennerz, Deichgraf, Polderfürst« gehänselt wird – verändert sich. Es wird immer schwieriger, eine akzeptable Wohnung ohne Wasserschäden, Rattenplage oder lautstarke Rapper in der Nachbarschaft zu finden. Das romantisierte Dichterleben scheint vollends zu kippen, als eine Eigenbedarfskündigung in den Briefkasten flattert. Wohin so schnell?
Für Brandt beginnt eine absurd tragische Odyssee kafkaesken Ausmaßes, ein aufreibendes und zeitraubendes Bewerbungsverfahren mit Lebenslauf, Schufa-Auskünften, Bürgschaft der Eltern (zuweilen mogelt er auch ein Exemplar seines letzten Romans zu den Unterlagen). Bei Wohnungsbesichtigungsterminen fühlt er sich mit gefühlten Hundertschaften von Mitbewerbern wie in einem »Horizontalpaternoster« durch die Räume geschleust. Um schließlich nicht auf der Straße zu landen, rettet er sich mit Zwischenmieten und temporären Unterkünften, stets im Zweifel: »Mit 42 wieder in einer WG zu wohnen, kam mir komisch vor, wie ein Fehler im System.«
Fitzcarraldo von Ostfriesland
Welch herbe Ironie des Schicksals, dass zur gleichen Zeit das ehemalige Wohn- und Geschäftshaus der Urgroßeltern, ein ehrwürdiger Gulfhof im friesischen Ihrhove, zum Verkauf steht und abgerissen werden soll. Obwohl das Haus längst nicht mehr im Familienbesitz ist, Jan Brandt obendrein nie darin gewohnt hat, ist er augenblicklich angefixt von der Idee, das Anwesen zu retten und in ein Literaturcafé, Künstlerhaus, Kulturzentrum umzuwidmen. Doch wie ließe sich die Finanzierung stemmen?
Von nun kämpft Brandt als »Fitzcarraldo von Ostfriesland« an zwei Fronten – und der Leser mag das Buch nach Belieben drehen und wenden, mal hier (Ein Haus auf dem Land), mal dort weiterlesen. Obwohl der Autor keinerlei schriftliche Aufzeichnungen seines Urgroßvaters besitzt, betreibt er profunde Nachforschungen und unterfüttert das Recherchierte mit abenteuerlichen Auswanderungs- und Rückkehrgeschichten. Heimat und Herkunft stellen plötzlich neue Werte dar, auch für Brandt, der einst nicht ohne Groll der Provinz entflohen ist (»Mit achtzehn hätte ich das Dorf mitsamt seinen Bewohnern am liebsten abgefackelt«).
Die Wohnung ist unverletzlich
Brandts Wendebuch und Doppelroman stellt vieles buchstäblich auf den Kopf: Landflucht und städtische Gentrifizierung, Heimat und Fernweh, Eigentum und Verlust – und immer auch die Suche nach der eigenen Identität. Um angesichts der selbst erfahrenen Wohnungsnot und Betroffenheit nicht in falsche Sentimentalität abzudriften, fährt der Autor emsig recherchiertes Material auf: Kennzahlen, Statistiken, Wohnungsmarktberichte.
Und hängt, in bester wissenschaftlicher Manier, beiden Buchteilen erhellende Literaturverzeichnisse an. Darüber hinaus gerät Eine Wohnung in der Stadt selbst zu einer interessanten Chronik der literarischen Off-Szene Berlins während der Jahrtausendwende. Dass sich jedoch die Träume einer sicheren Schriftstellerheimat weder im provinziellen Ihrhove noch im großstädtischen Berlin bleibend verwirklichen lassen, davon zeugt dieses Buch. Warnend ist ihm Artikel 13, Absatz 1 des Grundgesetzes vorangestellt: Die Wohnung ist unverletzlich.
Titelangaben
Jan Brandt: Ein Haus auf dem Land / Eine Wohnung in der Stadt: Von einem, der zurückkam, um seine alte Heimat zu finden / Von einem, der auszog, um in seiner neuen Heimat anzukommen
Köln: DuMont 2019
424 Seiten. 24.- Euro
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander
Reinschauen
| Leseprobe