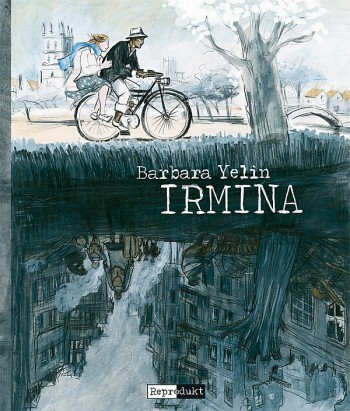Vor 125 Jahren wurde der Schriftsteller Hermann Kasack (am 24. Juli) geboren. Er war Romancier, Lyriker, Hörspielautor, Dramatiker, Lektor, Verlagsleiter und Rundfunkpionier in einer Person und hat die deutsche Nachkriegsliteratur maßgeblich geprägt. Trotzdem ist sein Name nahezu in Vergessenheit geraten. Die Rede ist von Hermann Kasack. Ein Porträt von PETER MOHR
»Die Verwandlung war das Gesetz. Freude in Schmerz und Schmerz in Freude. Tod verwandelte sich in Leben und Leben in Tod.« So lautet einer der zentralen Sätze in Hermann Kasacks 1947 erschienenen Roman »Die Stadt hinter dem Strom«. Das bereits während des Zweiten Weltkriegs begonnene Erzählwerk, für das der Autor 1949 mit dem Fontane-Preis und 1956 mit der Goethe-Plakette ausgezeichnet wurde, präsentiert ein ganz düsteres Bild einer Gesellschaft der Toten. In kafkaesker Manier schuf Kasack (unter dem Eindruck totaler Zerstörung) ein mythisches Höllengemälde um den Protagonisten Robert Lindhoff, der von der Sinnlosigkeit seiner eigenen Existenz überzeugt ist.
»Ich sah die Flächen einer gespenstischen Ruinenstadt, die sich ins Unendliche verlor und in der sich die Menschen wie Scharen von gefangenen Puppen bewegten.«, notierte Kasack über seinen eigenen Roman, eines der künstlerisch eindrucksvollsten Werke der sogenannten Trümmerliteratur.
Die Absurdität menschlichen Handelns stellt Kasack symbolisch durch eine große Fabrik dar. Dort existieren Anlagen, in denen minutiös Kunststeine produziert werden. In unmittelbarer Nachbarschaft werden die fertigen Steine zu Schutt zermahlen und später wieder als »Rohstoff« der Produktion zugeführt. Kasacks Werke sind ganz stark geprägt vom eigenen Erleben, von großem menschlichem Leid und barbarischer Zerstörung. In seinem Gedicht »Weg des Lebens« heißt es:
»Brenn ich auch niederer als eine Kerze,/ Vom Schicksal in die Einsamkeit gestellt:/ So hab ich doch das Reich der Schwärze / Flüchtig an seinem Rand erhellt. »In diesen Versen wohnt – mitten in der Zerstörung der Zeit – Leben und Glück«, attestierte der Lyriker Günter Eich.
Auch in seinen späteren Werken hat sich Kasack als scharfsinniger Analytiker erwiesen. Im »Webstuhl« (1949) zeichnet er den Aufstieg und Untergang eines totalitären Regimes nach, und drei Jahre später nahm er in »Das große Netz« auf satirische Weise den sich etablierenden bürokratischen Staatsapparat aufs Korn. Dieser kritisch-pessimistische Grundtenor passte nicht in die »Wohlstandsphilosophie« der Adenauer-Ära, sodass Kasack außerhalb des Literaturbetriebs mit seinen Werken kaum Freunde gewinnen konnte.
Der Literatur hatte sich der heute vor 125 Jahren in Potsdam als Sohn eines Arztes geborene Hermann Kasack schon früh gewidmet. Wegen eines Herzfehlers war er im Herbst 1914 aus der Armee entlassen worden und konnte sich seinem Studium widmen. 1917 lernte er Gottfried Benn kennen, ein Jahr später erschien sein erstes Buch »Der Mensch«. Als 24-Jähriger trat Kasack ins Lektorat des Kiepenheuer Verlags ein und gab dort später die gesammelten Werke von Hölderlin heraus. Er wechselte in gleicher Funktion zu Fischer und wurde während des Zweiten Weltkriegs als Nachfolger seines verstorbenen Freundes Oskar Loerkes Cheflektor bei Suhrkamp.
Kasack machte sich auch einen Namen als Rundfunkpionier bei der »Funk-Stunde« und war dort für mehr als 100 Radiosendungen verantwortlich. Während der NS-Zeit wählte Kasack den Weg in die »Innere Emigration«. 1933 war sein sozialkritisches Hörspiel »Der Ruf« von den Nazis verfälscht und mit Ausschnitten einer Hitlerrede ausgestrahlt worden. Er protestierte scharf dagegen und fortan wurde ihm jegliche Tätigkeit beim staatlichen Rundfunk untersagt. Es erschien aus seiner Feder lediglich 1944 in der ›Neuen Rundschau‹ die 1996 noch einmal neu aufgelegte, schmale Erzählung ›Das Birkenwäldchen‹, die er seinem inhaftierten Verlags-Chef Peter Suhrkamp gewidmet hatte.
1948 war Kasack einer der Mitbegründer des Deutschen PEN-Zentrums und stand später zehn Jahre lang als Präsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt vor. Auch in dieser Zeit erwarb er sich noch große Verdienste als Vermittler von Literatur. Zwei von ihm zusammengestellte Gedichteditionen bewahrten das Werk der jüdischen Lyrikerin Gertrud Kolmar vor der völligen Vergessenheit. Kasacks zweiter und letzter Roman ›Das große Netz‹ (1952), der von der Kritik zwiespältig aufgenommen wurde, bot eine gewagte Mischung aus Dystopie und Satire. »Dichten ist ein Brückenschlagen von dem, der schreibt, zu dem, der liest«, hatte Kasack sein künstlerisches Credo beschrieben.
1955 wurde sein bedeutender Roman »Die Stadt hinter dem Strom« auch als dreiaktige Oper in Wiesbaden uraufgeführt. Die Musik komponierte Hans Vogt, das Libretto schrieb Hermann Kasack selbst.
Der scharfsinnige Dichter und leidenschaftliche Förderer Hermann Kasack, der in seinen letzten Lebensjahren fast völlig erblindet war, starb am 10. Januar 1966 in Stuttgart als Einzelgänger, der im Nachkriegsliteraturbetrieb keine geistige Heimat gefunden hatte. Eine Passage aus seinem Meisterwerk ›Die Stadt hinter dem Strom‹ liest sich so, als habe Kasack sich selbst in der Figur des Protagonisten Robert porträtiert: »Als sich die Witwe erkundigte, ob es stimme, daß man auf der nächsten Station umsteigen müsse, sagte Robert, er habe den Eindruck, daß alle in falscher Richtung führen.«
Es ist an der Zeit, einen unterschätzten, fast vergessenen, aber bedeutenden Autor der frühen Nachkriegszeit (wieder) zu entdecken.