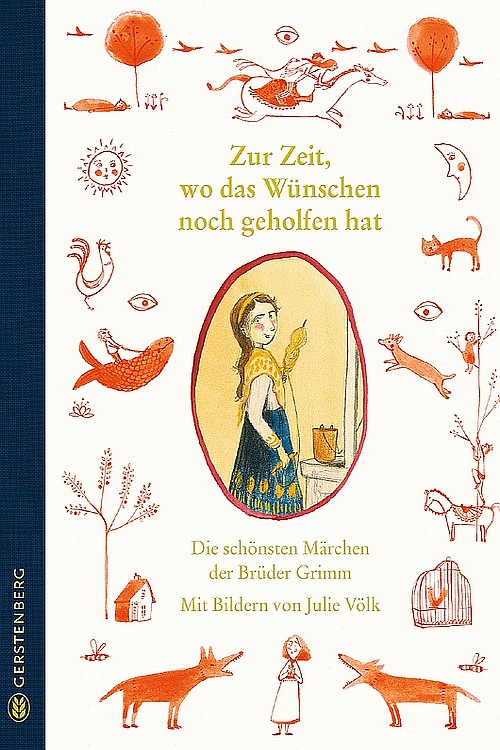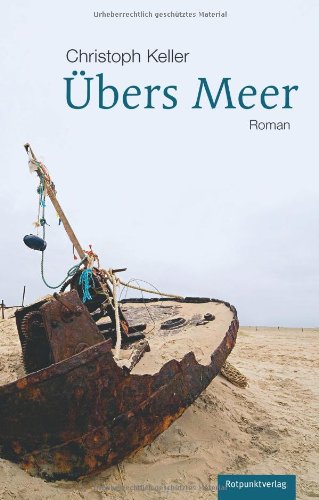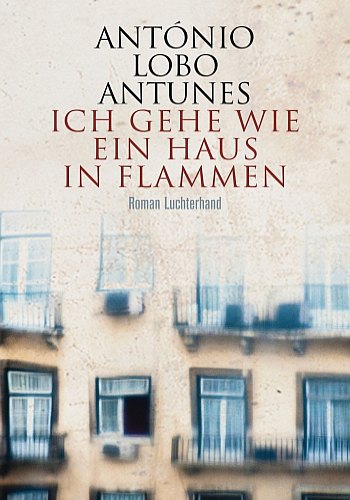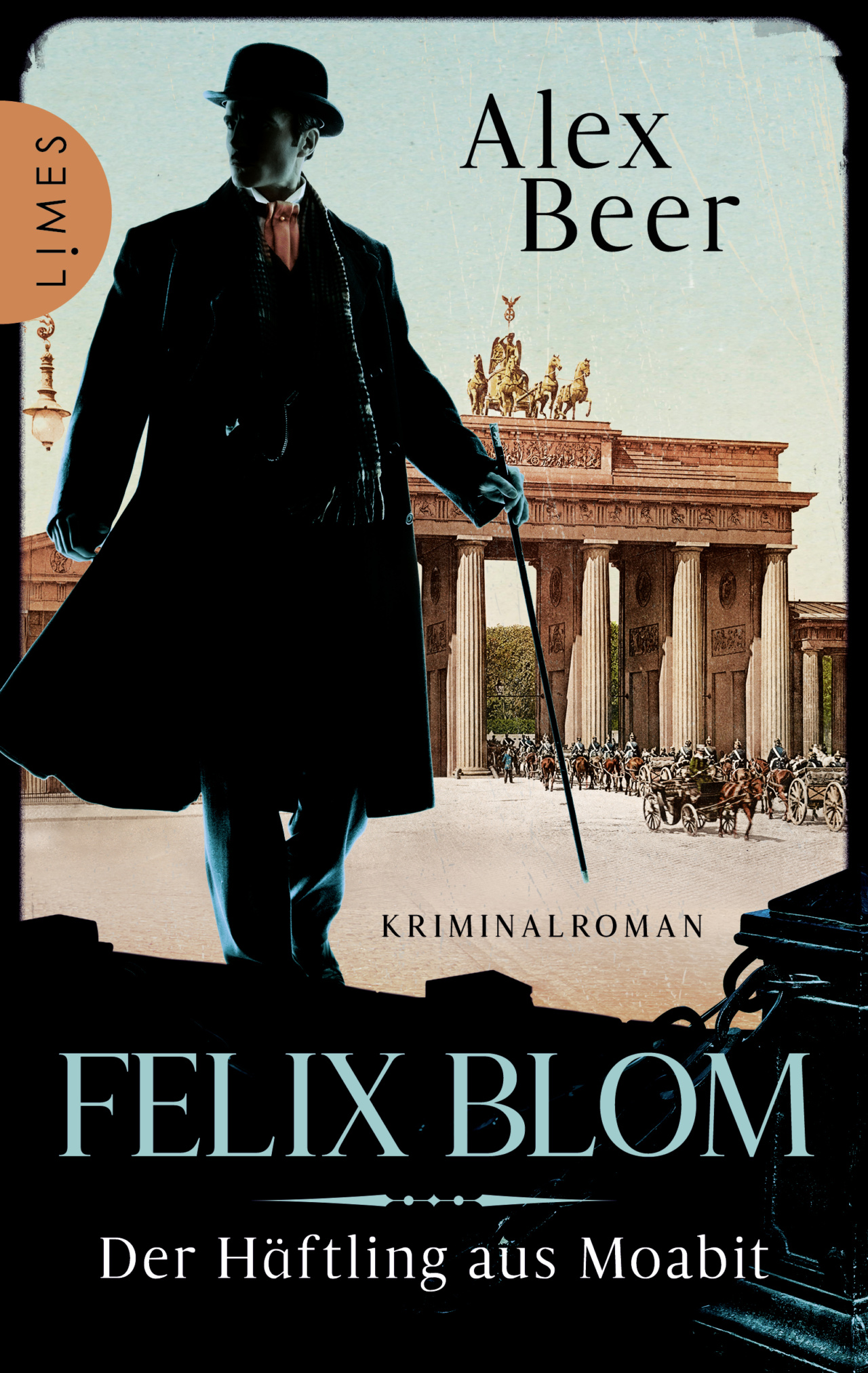»Die Treppe herauf kam eine sehr schmale, schüchtern wirkende Frau, die etwa fünfzig Jahre alt sein mochte, aber aussah wie ein Mädchen. Sie trug Jeans und einen Rucksack auf den Schultern.« So beschreibt die inzwischen 76-jährige Schriftstellerin Natascha Wodin die Protagonistin ihres neuen Romans Nastjas Tränen. Wodin, deren literarisches Werk durchgehend einen autobiografischen Background hat, war vor vier Jahren für ihren Roman Sie kam aus Mariupol mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet worden. Darin hatte sich die Schriftstellerin, die als Tochter russisch-ukrainischer Zwangsarbeiter 1945 in einem Lager in Franken geboren wurde, in leisen Tönen dem Leben ihrer Mutter angenähert. Von PETER MOHR
 Auch in ihrem neuen Roman reichen die Wurzeln wieder nach Osteuropa. Hauptfigur Nastja stammt aus der Ukraine, hat in Kiew studiert und einen Abschluss als Bauingenieurin in der Tasche, als sie 1992 nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion mit einem Touristenvisum nach Berlin kommt.
Auch in ihrem neuen Roman reichen die Wurzeln wieder nach Osteuropa. Hauptfigur Nastja stammt aus der Ukraine, hat in Kiew studiert und einen Abschluss als Bauingenieurin in der Tasche, als sie 1992 nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion mit einem Touristenvisum nach Berlin kommt.
Für die Hauptfigur geht es ums nackte Überleben. Sie heuert als Putzfrau bei einer neureichen Russin an, die in einer fürstlichen Altbauwohnung im Dunstkreis des Kurfürstendamms residiert und die sie schikaniert und gnadenlos ausbeutet. Viel gegensätzlicher hätte man das Bild von Gewinnern und Verlierern der Wende in Osteuropa nicht »malen« können.
Hier geht es um Entwurzelung, um ein erzwungenes Kappen der eigenen Biografie und um ein Leben in einem neuen, völlig fremden Kulturkreis. Demgegenüber steht ein ausgeprägtes Heimweh, hier in Wodins Schilderung weit mehr als nur eine kitschige Vokabel. Trotz des alles andere als glücklichen Lebens in der Ukraine: »Annähernd dreißig Jahre lebte Nastja so, eine Zeit, die ihr vorkam wie ein endloses, nie stillstehendes Rotationsband, ein nie abreißender Strom aus grauem, betäubendem Einerlei.«
Natascha Wodin evoziert ein beklemmendes Gefühl der Fremdheit, des Nichtdazugehörens, des gnadenlosen Außenseitertums. Nastjas schmerzliches Empfinden von Zweitklassigkeit (eine Akademikerin als Putzfrau oder Haushaltshilfe) trübt ihre Wahrnehmung und lässt sie kurzzeitig in einer Beziehung zum harleyfahrenden Kranführer Achim stranden.
Schlussendlich landet Nastja im Haushalt der Ich-Erzählerin, die (keineswegs zufällig) der Autorin Natascha Wodin nicht unähnlich ist. Aus dieser Konstruktion resultieren allerdings einige kleine Unebenheiten im ansonsten geschliffenen Romanprofil. Das Helfersyndrom des Erzähl-Ichs und die aufopferungsvolle Selbstlosigkeit wirken an einigen Stellen schlicht etwas zu dick aufgetragen. Jedenfalls gelingt es der Ich-Erzählerin, Nastjas Abschiebung in die Ukraine zu verhindern.
Im Zusammenleben der beiden Frauen entstehen Sequenzen von großer Emotionalität. Nastja bricht in Tränen aus, als sie eine Platte mit ukrainischen Volksliedern hört. Es ist vor allem diese so authentisch klingende innere Zerrissenheit der Nastja-Figur, die den Leser gefangen nimmt: »Sie behielt die russische Tonart bei und brachte das Kunststück fertig, auch dann Russisch zu sprechen, wenn sie Deutsch sprach. Sie spielte, sozusagen, Klavier auf einem Cello.«
Natascha Wodin hat Nastjas Schicksal eindrucksvoll und ohne aufgesetzte Mitleidsattitüde beschrieben. Fragmentarisch tauchen noch etliche ähnlich gelagerte Lebenswege von Nebenfiguren auf. Das Fremdsein, das Gefühl der Entwurzelung steht im Zentrum – so wie im Text von Schuberts Winterreise: »Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh‘ ich wieder aus.«
Titelangaben
Natascha Wodin: Nastjas Tränen
Hamburg: Rowohlt Verlag 2021
189 Seiten. 22.- Euro
| Erwerben Sie diesen Band portofrei bei Osiander
Reinschauen
| Leseprobe