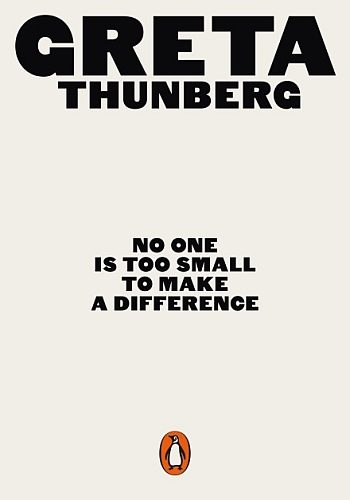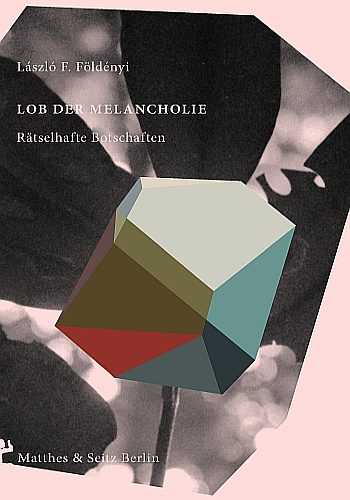»Jeder ist ein Einzelner. Aber nicht jeder ist damit einverstanden und bereit, etwas daraus zu machen.« Diese Sätze stehen am Anfang seiner philosophischen Überlegungen über den Menschen in Rüdiger Safranskis neuem Buch ›Einzeln sein – Eine philosophische Herausforderung‹. In den sich anschließenden sechzehn Kapiteln entwickelt der Autor keine elaborierte »Theorie des Ichs« und er verfasst auch kein Vademecum für Selbstoptimierer und Selbstverwirklicher, sondern er sucht, von der Renaissance bis zur Mitte des letzten Jahrhunderts, nach Bestimmungen dessen, was es heißen kann, ein Einzelner zu sein. Gezeichnet werden die Porträts von Menschen, die sich entschieden haben, autonome Individuen zu sein, in ihrem Leben und in ihrem Denken, in einer Gemeinschaft, aber oft genug auch gegen sie. Von DIETER KALTWASSER
 Für Safranski bedeutet der Individualismus der Renaissance, dass »der Einzelne ermuntert und auch gezwungen wird, sich seiner selbst bewusst zu werden, weil die traditionellen Bindungen, Gesetze und Glaubenswelten ihre Autorität verlieren.« Dies sei auch eine Wirkung der Geldwirtschaft gewesen, die sich in Italien deutlich früher als im übrigen Europa durchsetzte, zudem ergriff sie die religiöse Welt und erzeugte den Ablasshandel.
Für Safranski bedeutet der Individualismus der Renaissance, dass »der Einzelne ermuntert und auch gezwungen wird, sich seiner selbst bewusst zu werden, weil die traditionellen Bindungen, Gesetze und Glaubenswelten ihre Autorität verlieren.« Dies sei auch eine Wirkung der Geldwirtschaft gewesen, die sich in Italien deutlich früher als im übrigen Europa durchsetzte, zudem ergriff sie die religiöse Welt und erzeugte den Ablasshandel.
Das Selbstbewusstsein derer, die sich in dieser Gesellschaft als unverwechselbare Einzelne fühlten, war riesig. Safranski zitiert aus den ›Philosophischen Tagebüchern‹ des Universalgelehrten Leonardo da Vinci: »Es gibt Menschen, die man nicht anders als Durchgang von Speisen, Vermehrer von Kot und Füller von Abtritten nennen muss, weil durch sie nichts anderes auf der Welt erscheint, … als volle Latrinen.« Freilich füllte man auch selbst die Latrinen, kommentiert Safranski lakonisch ob des kalten Blicks dieses »großen Einzelnen« jener Zeit. »Die sogenannten Renaissance-Naturen waren Verkörperungen des Willens zur Macht«, im Sinne des Willens zur Selbststeigerung.
Erst in dieser Epoche, erfahren wir vom Autor, »wird es üblich, Bilder zu signieren. Leonardo da Vinci bewahrt sogar seine Entwürfe auf, manche davon ebenfalls signiert.« Möglichst wenig sollte verloren gehen, allein darauf kam es da Vinci an, »irgendeine Erinnerung im Geiste der Sterblichen zu hinterlassen. Auf dass dieser unser Lebenslauf nicht umsonst verfließe.« Jacob Burckhardt schildert in seinem legendären Werk »Kultur der Renaissance«, dass in Italien zuerst sich »mit voller Macht das Subjektive« erhoben habe; der Mensch wurde ein geistiges Individuum und erkannte sich als solches.
Von dieser schöpferischen Euphorie des Künstlertums, so Safranski, war auch Giovanni Pico della Mirandola ergriffen. In seiner philosophischen Abhandlung von 1486 »Über die Würde des Menschen« schreibt der italienische Philosoph, Gott habe am letzten Schöpfungstag zum Menschen gesprochen: »Wir haben dich in die Mitte der Welt gesetzt, damit du von dort bequem um dich schaust, was es alles in dieser Welt gibt.« Einige Sätze weiter heißt es: »Es steht dir frei, in die Unterwelt des Viehs zu entarten. Es steht Dir ebenso frei, in die höhere Welt des Göttlichen dich durch den Entschluss deines eigenen Geistes zu erheben.«
Einst waren die Künstler, schreibt Safranski, in ihren Werken verschwunden – im 15. Jahrhundert »wird Vasari die Lebensläufe der Künstler der Renaissance wie Heiligenlegenden erzählen.«
»Jacob Burckhardt spricht vom »Schleier … aus Glauben, Kinderbefangenheit und Wahn«, der in die Lüfte verwehte und den Blick freigab auf die deutlich erfasste Einzelheit und Individualität«, schreibt Safranski, den großen Schweizer Kulturhistoriker zitierend.
Während sich bei Martin Luther das »Einzeln-Sein in der religiösen Sphäre verwirklichte, forcierte die italienische Renaissance den künstlerischen Individualismus.« Luther wollte einen ganz eigenen Zugang zur Religion finden, den Glaubensakt individuell vollziehen; er erfährt dabei laut Safranski etwas, »was später Existenz genannt werden sollte«.
Die Reihe der großen Einzelnen, die der Autor aufzählt und deren Werke er betrachtet, ist lang: Michel de Montaigne, der zurückgezogen in seinem Turm lebend seine Essays schrieb, Jean-Jacques Rousseau, Denis Diderot, Stendhal, Sören Kierkegaard, Max Stirner und ein Henry David Thoreau, der sich in die Wälder zurückzog, um seine Gedanken zu klären, um dann später in Amerika gegen die Sklaverei zu kämpfen.
Safranski schreibt, dass es Kierkegaard war, der den Ausdruck »existentiell« zum ersten Male emphatisch gebrauchte – als Bezeichnung dessen, was den Einzelnen unbedingt angehe. »Der Einzelne«, heißt es in einem Tagebucheintrag Kierkegaards, »ist die Kategorie, durch welche, in religiöser Hinsicht, die Zeit, die Geschichte, das menschliche Geschlecht, hindurch muss.« Man muss einzeln sein, wenn man den »Sprung des Glaubens« wagt.
Es folgen u. a. Kapitel zu Stefan George, Georg Simmel, Ricarda Huch, Martin Heidegger, Karl Jaspers und Hannah Arendt; letztere betonte, dass Nachdenken allein in der Einsamkeit, im Gespräch mit sich selbst, geschehen kann. Auf Heideggers ›Vorlaufen in den Tod‹ antwortete sie mit »einer Philosophie der Geburtlichkeit«, auf »Heideggers Kritik der ›Verfallenheit‹ an die Welt des ›Man‹ antwortet sie mit einer philosophischen Verteidigung des Lebens in der Öffentlichkeit«, schreibt Safranski. Im letzten Kapitel finden sich luzide Betrachtungen des Autors über Ernst Jüngers Essay ›Der Waldgang‹ aus dem Jahr 1951, der sich von der soldatischen Massengesellschaft der NS-Zeit distanziert.
Auffallend ist, dass nur zwei Denkerinnen thematisiert werden. Der späte Foucault und dessen Begriff der »Sorge um sich selbst«, den dieser im Jahr 1982 in seinen legendären Vorlesungen am Collège de France präsentierte und die unter dem Titel »Hermeneutik des Subjekts« veröffentlicht wurden, finden keine Erwähnung.
Rüdiger Safranski hat ein unaufgeregtes und brillantes Buch geschrieben, dem viele Leser zu wünschen sind. Der Name Hölderlins fehlt. Der Autor hat die Biografie des großen einsamen Dichters vor zwei Jahren vorgelegt; vielleicht hat sie ihn dazu motiviert, den geschichtlichen Spuren des Individualismus noch einmal zu folgen. Schriftsteller und Philosophen sind zu allen Zeiten dem verborgenen Glanz und der Gefährdung des Einzelnen nachgegangen. Und so hat Sören Kierkegaards Maxime nichts an ihrer Aktualität verloren: »Das Große ist nicht, dies oder das zu sein, sondern man selbst zu sein.«
»Dreizehn alltägliche Phantasiestücke«
 Blaise Pascals Satz, der größte Irrtum der Menschen bestehe darin, es nicht allein in einem Zimmer sitzend auszuhalten, leuchtete ihm ein, lange bevor er die Absicht hatte, zumindest selbst diesen Irrtum nicht zu begehen, heißt es in ›Alleinsein im Zimmer‹, einem von 13 Kapiteln des Buches ›Was alles so vorkommt‹ von Karl-Heinz Bohrer. Aber was ist der Grund dafür, nicht allein sein zu können? Das Alleinsein scheint unerträglich in sich selbst. Dieses Gefühl bringt Pascal so auf den Punkt: »Unablässig wird aus der Tiefe seiner Seele die Langeweile aufsteigen, die Niedergeschlagenheit, die Trauer, der Kummer, der Verdruss, die Verzweiflung.«
Blaise Pascals Satz, der größte Irrtum der Menschen bestehe darin, es nicht allein in einem Zimmer sitzend auszuhalten, leuchtete ihm ein, lange bevor er die Absicht hatte, zumindest selbst diesen Irrtum nicht zu begehen, heißt es in ›Alleinsein im Zimmer‹, einem von 13 Kapiteln des Buches ›Was alles so vorkommt‹ von Karl-Heinz Bohrer. Aber was ist der Grund dafür, nicht allein sein zu können? Das Alleinsein scheint unerträglich in sich selbst. Dieses Gefühl bringt Pascal so auf den Punkt: »Unablässig wird aus der Tiefe seiner Seele die Langeweile aufsteigen, die Niedergeschlagenheit, die Trauer, der Kummer, der Verdruss, die Verzweiflung.«
Bohrer macht sich auf den Weg zu anderen Autoren, die das Alleinsein erkundet haben. So beantwortet Montaigne beispielsweise die Frage nach dem Wesen der Einsamkeit positiv. In seinen Essais von 1685 heißt es, sie sei das Erstrebenswerte, »um sich selbst gehören zu können«. Die große Intellektualität und der Sprachreichtum faszinieren auch in diesem Essayband des Anfang August 88-jährig verstorbenen Literaturwissenschaftlers, Essayisten und Journalisten.
Doch er befasst sich nicht bloß mit intellektuellen Themen. Auch seine Betrachtungen und Meditationen zu Alltagsphänomenen wie Fußball und Zugfahrten sind in ihrer sprachlichen Prägnanz beeindruckend. Wer kennt nicht die Formulierung: »Der aus der Tiefe des Raumes plötzlich vorstoßende Netzer«? Aber wer weiß sie Bohrer zuzuordnen? Seine Reflexionen über die Träume von Jugendlichen, den Tod und die Vergänglichkeit zeigen sein tiefes anthropologisches Grundverständnis.
Warum braucht man Freunde? »Es steckt in ihnen, in dieser Art intensiver Seelenverwandtschaft, eine umarmende Kameradschaft, eine Selbstverständlichkeit, Wichtiges gemeinsam zu erkennen. Darum fühlt man sich bei ihnen zu Hause.« Einer war vor Jahren ausgerechnet auf einem Bahnhof »auf die Zeitlichkeit, nicht die Zeit, der griechischen Tragödie zu sprechen gekommen. Das schlug als Freundschaftsgeste blitzartig ein. Damit war er als einer ausgemacht, mit dem zu sprechen, mit dem gemeinsam in das einschlägige Thema einzudringen wichtig wurde.« Solche Erkenntnisblitze weisen auf den Begriff der »Plötzlichkeit« hin, einen Leitbegriff Bohrers.
Im Phantasiestück ›Schöne, hässliche, interessante Städte‹ findet der Leser neben der Verortung großer Literaturen – sei es in Rom, Paris, London, Berlin – auch Betrachtungen über deren Stadtbilder: »Die neuen Hochhäuser an der Themse, aber auch in der City neben der Kathedrale St. Paul, sind der Triumph des Verschwindens des Alten, wie es schon Baudelaire für Paris so beklagt hat.« Die Form einer Stadt ändert sich schneller als das Herz eines Menschen. Bohrers ›Phantasiestücke‹ sind ein Lesegenuss!
Titelangaben
Rüdiger Safranski: Einzeln sein
Eine philosophische Herausforderung
München: Hanser Verlag 2021
288 Seiten, 26 Euro
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander
| Leseprobe
Karl Heinz Bohrer: Was alles so vorkommt
Dreizehn alltägliche Phantasiestücke.
Berlin: Suhrkamp Verlag 2021
185 Seiten, 18,00 Euro
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander
| Leseprobe