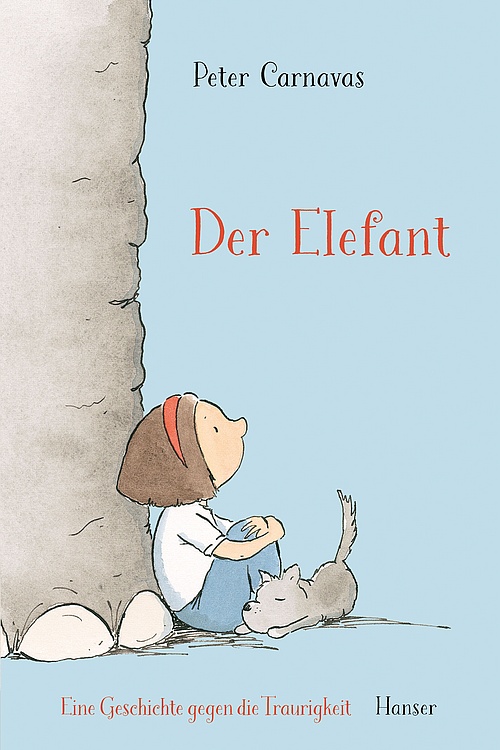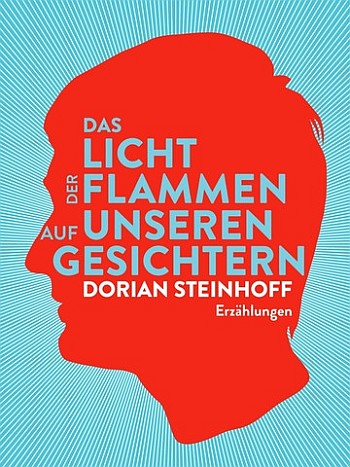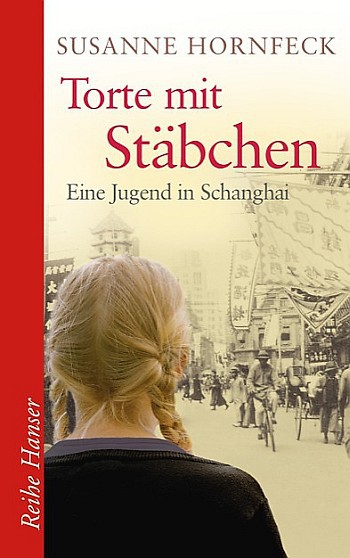Provinz und proletarische Herkunft, Familienbande und Fluchtreflexe, kleinbürgerliche Enge und klamme Kindheitserinnerungen sind immer wiederkehrende Themen in Martin Beckers Romanen. Gegen zwiespältige Gefühle ist auch sein Kleinstadtfarben-Antiheld Peter Pinscher nicht gefeit. Erscheinen manche Notwendigkeiten nicht wie purer Verrat? Denn: »Das Haus seiner Kindheit verkauft man nicht, das Haus seiner Kindheit verliert man.« Von INGEBORG JAISER
 Kleinstadtfarben, das sind vergilbte Schautafeln, aschgraue Flachbauten, furnierte Eiche rustikal. Noch bevor die Hauptfigur Peter Pinscher – ein kleingewachsener, übergewichtiger, den Schmerztabletten und Zigaretten verfallener Polizeikommissar – auf den Plan treten kann, kommt einem das atmosphärische Milieu seltsam bekannt vor.
Kleinstadtfarben, das sind vergilbte Schautafeln, aschgraue Flachbauten, furnierte Eiche rustikal. Noch bevor die Hauptfigur Peter Pinscher – ein kleingewachsener, übergewichtiger, den Schmerztabletten und Zigaretten verfallener Polizeikommissar – auf den Plan treten kann, kommt einem das atmosphärische Milieu seltsam bekannt vor.
Wie schon in Martin Beckers Marschmusik (2017) reisen wir auch mit diesem neuen Roman zurück in die Enge und Beklommenheit, wenngleich wehmütige Vertrautheit der westfälischen Provinz (die überall sein könnte), in die Kindheit und Jugend eines Protagonisten, der uns so erstaunlich nahesteht wie ein Schulfreund oder Cousin.
Leichen im Keller
Einst hat Peter Pinscher als Kriminalpolizist den Absprung in die Großstadt am Rhein geschafft, auch wenn sein beruflicher Alltag in der »Todesursachenermittlung« traumatisch auf den Ischiasnerv drückt und er sich regelmäßig den Schrecken mit frittierten Hühnerteilen von der Seele fressen muss. Adipös, alkoholabhängig und mit den Nerven am Ende, verliert er mitunter die Contenance – und landet schließlich strafversetzt und degradiert in der Provinz. Just in seinem Heimatort. So kommt es zu einem (nicht immer erfreulichen) Wiedersehen mit alten Bekannten, Gebäuden, Gespenstern der Vergangenheit. Dabei erschien alles schon erledigt.
Der Vater (»Starkraucher, Pegeltrinker, hartes Arbeitermilieu«) früh verstorben, die Mutter mit durchgeschmorten Synapsen seit Jahren im Pflegeheim untergebracht, wofür das Familienheim verscherbelt werden musste. Nicht ohne Skrupel, denn: »Schließlich hatte er keine Immobilie verkauft, sondern ein Reich verraten. Ein ganzes Königreich.« Der Zufall will es, dass die neue Eigentümerin unter ungeklärten Umständen verstirbt und Pinscher bei der Tatortbegehung sein ehemaliges Elternhaus noch vollkommen intakt und wie zum Museum stilisiert vorfindet. Ein gruseliges Szenario, das den stärksten Ermittler umhauen würde.
Familienalbum
Heimgesucht von somnambulen Tag-, Alp- und Wachträumen taumelt Pinscher durch diese abstruse »Mündendorfer Geisterbahn«, getrieben von vagem Berufsethos und einer schmerzlichen Zeitreise zurück. Fünf Kapitelblöcke, angelehnt an die klassischen Phasen der Trauer, gliedern diesen Roman: Leugnen, Zürnen, Verhandeln, Resignieren, Akzeptieren. Wie schon in Marschmusik zeigt Martin Becker ein beachtliches Gespür, aber auch Respekt für das kleinbürgerliche Milieu der ewigen Malocher und stets Zukurzgekommenen.
Geradezu Gänsehaut erzeugen die Passagen, die wie eine Rückkehr in die eigene Kindheit aufscheinen. Hier die furnierte Eichenholzschrankwand, »die holzgelackte Bestätigung des eigenen Angekommenseins, das handfeste Lebensarchiv der proletarischen Kleinstadtfamilie«. Dort der schaudernde Blick auf die verblichenen Urlaubsfotos im Familienalbum, als ob einem die stundenlange Autofahrt an die Nordsee in einem verqualmten Ford Escort noch immer in den Knochen stecken würde. Und an anderer Stelle fegt der Luftzug der Erinnerung über die abgewetzten Cordhosen des Vaters, die sorgsam verpackte Weihnachtskrippe, die unsägliche Furcht vor alten Aktenzeichen XY-Sendungen.
Abschied von den Eltern
Martin Becker, aufgewachsen im sauerländischen Plettenberg, musste das fiktive Mündendorf nicht erst erfinden – ist doch alles schon real vorhanden: das Mittelgebirge, die Talsperre, der Kleinstadtfilz. Sein unverstellter Blick auf »die Dynastie der kleinen Leute« mit ihren mühsam finanzierten Eigenheimen und hart erkämpften Freuden ist nie frei von leiser Melancholie und Wehmut, aber auch entwaffnendem Wortwitz. Letztendlich wirkt das langsame Zerbröckeln der Familie, der unumkehrbare Abschied von den Eltern unausweichlich. Doch wieviel Trauer in diesem verkappten Kriminal- und Heimatroman steckt, muss der Leser selbst erfahren. Nicht umsonst ertönt während Peter Pinschers seltenen Taxifahrten im Radio Schuberts Winterreise: »Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus.«
Titelangaben
Martin Becker: Kleinstadtfarben
München: Luchterhand 2021
283 Seiten. 20.- Euro
| Erwerben Sie diesen Band portofrei bei Osiander
Reinschauen
| Leseprobe
| Mehr zu Martin Becker von Ingeborg Jaiser in TITEL kulturmagazin