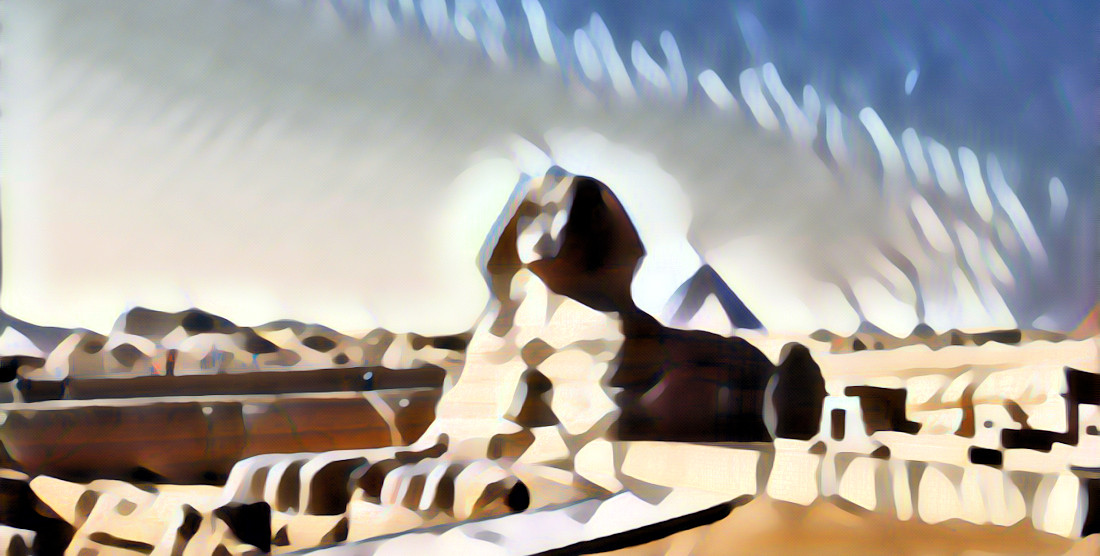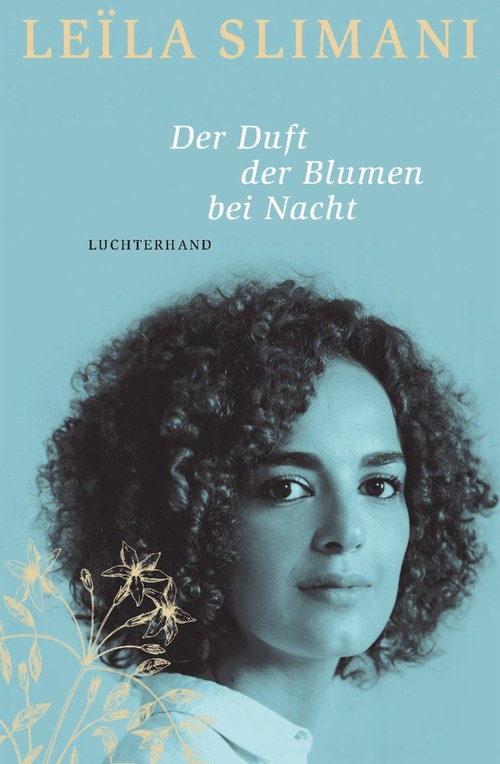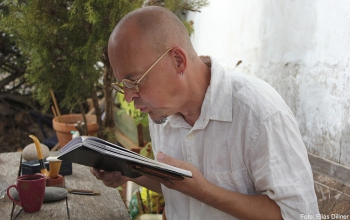Sein Lebensweg hätte reichlich Stoff für einen Roman hergegeben, für ein opulentes Erzählwerk, das zwischen Tragödie und Komödie changiert. Eine Vita, in der sich noch Spuren der Grausamkeiten des Zweiten Weltkriegs wiederfinden und die vom Grenzgang zwischen den beiden deutschen Staaten geprägt ist. Die Rede ist vom Schriftsteller und Drehbuchautor Jurek Becker. Ein Porträt von PETER MOHR
 Die Normalität hat ihn nicht interessiert, weil sein eigenes Leben über weite Strecken alles andere als »normal« verlief, von tragischen Momenten, Verlusten und Entbehrungen geprägt war. So hat Jurek Becker in seiner schriftstellerischen Arbeit auch stets existenzbedrohende Konfliktsituationen als Sujets favorisiert.
Die Normalität hat ihn nicht interessiert, weil sein eigenes Leben über weite Strecken alles andere als »normal« verlief, von tragischen Momenten, Verlusten und Entbehrungen geprägt war. So hat Jurek Becker in seiner schriftstellerischen Arbeit auch stets existenzbedrohende Konfliktsituationen als Sujets favorisiert.
Er war gerade 32 Jahre alt, als ihm 1969 mit dem Roman ›Jakob, der Lügner‹ ein gewaltiges literarisches Debüt gelang. Es erzählt den Leidensweg des Protagonisten Jakob Heym in einem jüdischen Ghetto des Zweiten Weltkrieges. Diese Figur und der Roman sind deswegen so beeindruckend, weil sich der von schwarzem Humor durchzogene Erzählton antagonistisch gegen die traurig-dramatische Handlung stellt.
Jurek Becker, der selbst im Ghetto von Lodz aufwuchs, lässt seine Hauptfigur bewusst Lügen verbreiten, um den Mitbewohnern des Ghettos neuen Lebensmut zu verleihen. Der Autor bagatellisiert nicht die schrecklichen Geschehnisse, sondern hält ihnen einen schwarz eingefärbten humoristischen Spiegel entgegen.
Jurek Becker, der am 30. September 1937 (inzwischen gibt es Zweifel an diesem offiziellen Datum) in Lodz geboren wurde, verbrachte seine Kindheit zunächst im dortigen Ghetto und später in den Konzentrationslagern Ravensbrück und Sachsenhausen. Erst Ende 1945 traf er in Ost-Berlin wieder auf seinen Vater (die Mutter hatte den Krieg nicht überlebt), wo er mühsam begann, die deutsche Sprache zu erlernen.
Dem Abitur folgte ein kurzes Gastspiel als Philosophiestudent an der Humboldt-Universität. 1960 wurde Jurek Becker aus politischen Gründen relegiert und schlug sich bis zum Erscheinen von ›Jakob, der Lügner‹ mehr schlecht als recht als Drehbuchautor bei der DEFA durch. Danach ging es allerdings schlagartig bergauf: Jurek Becker erhielt eine Festanstellung in Babelsberg, 1971 für sein Romandebüt den angesehenen Heinrich-Mann-Preis und vier Jahre später gar den Nationalpreis der DDR.
Doch dem angesehenen Autor stand der politische Querdenker Becker gegenüber, der nach seinem Protest gegen die Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann aus der SED und dem Schriftstellerverband der DDR ausgeschlossen wurde. 1977 übersiedelte er mit Billigung der SED von Ost- nach West-Berlin – ohne allerdings seine Staatsbürgerschaft zu wechseln.
Die selbst unter zwei totalitären Regimen erlittenen Drangsalierungen hat Jurek Becker immer wieder in seine Romane einfließen lassen. In ›Irreführung der Behörden‹ (1973) ist es der Lebensweg des gescheiterten, politisch nicht-linientreuen Jura-Studenten Gregor Bienek; in ›Der Boxer‹ (1976) lässt er den Juden Aaron Blank in den Kriegswirren seinen Sohn suchen; in ›Schlaflose Tage‹ (1978) zieht der Lehrer Simrock kurz vor seinem 40. Geburtstag eine ernüchternde Lebensbilanz; in ›Bronsteins Kinder‹ (1986) geht es um die heikle Frage, ob Kriegsopfer das moralische Recht zur Selbstjustiz für sich reklamieren dürfen; der Grat zwischen Opfern und Tätern wurde in diesem Roman hauchdünn.
Sein letzter Roman ›Amanda Herzlos‹ (1992) liest sich vordergründig wie eine Liebestragödie. Doch hinter der Handlung um Amanda Weniger und ihre drei Männer verbirgt sich die Frage, ob es sich nach dem Mauerfall im Osten oder im Westen besser leben lässt. Was an sämtlichen Werken Jurek Beckers besticht, ist seine unprätentiöse, aber dennoch spannende Erzählweise, sein beinahe einzigartiges Talent, Tragödie und Komödie in Romanform verschmelzen zu lassen.
In seinen letzten zehn Lebensjahren hat Jurek Becker auch die ihm gebührende öffentliche Anerkennung erfahren. Die Krux dabei: allerdings nicht als Romanschriftsteller, sondern als Drehbuchautor der TV-Serie ›Liebling Kreuzberg‹, in der er seinem Freund Manfred Krug eine Paraderolle auf den Leib schnitt. Dieser erfolgreiche Abstecher ins andere Genre hat Becker in Schriftsteller und Kritikerkreisen reichlich abwertende (zumeist ungerechtfertigte) Seitenhiebe eingetragen.
Der Anwalt Liebling, dieser unkonventionelle Jurist, der sich auch für die sozialen Underdogs engagierte, dieses mal liebenswerte, mal ekelhafte Geschöpf war eine ebenso typische Becker-Figur wie all seine Romanprotagonisten.
Jurek Becker, der 1992 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurde und dessen Werke alle im Suhrkamp Verlag erschienen sind, ist leider als Romancier etwas in Vergessenheit geraten. Dabei war er in der deutsch-deutschen Nachkriegsliteratur eine deutliche vernehmbare mahnende Stimme, ein Autor mit ausgeprägtem Geschichtsbewusstsein, aber ohne erhobenen moralisierenden Zeigefinger. Jurek Becker, Vater von drei Söhnen, ist am 14. März 1997 in seiner schleswig-holsteinischen Wahlheimat Sieseby an der Schlei im Alter von nur 59 Jahren an einem Krebsleiden verstorben.