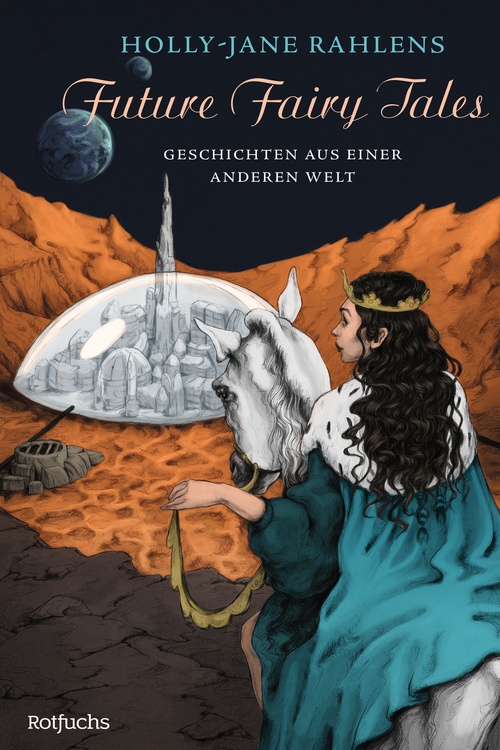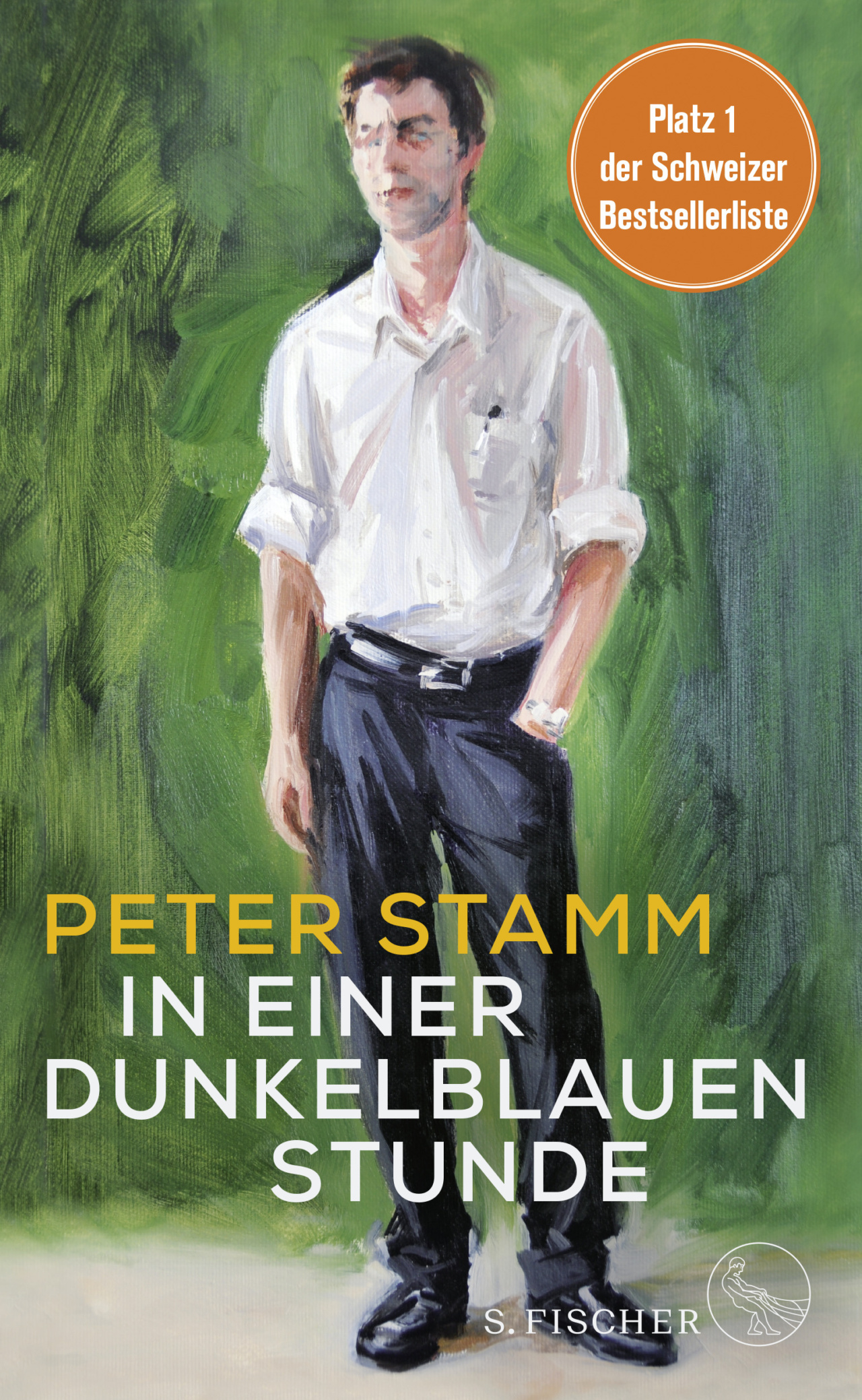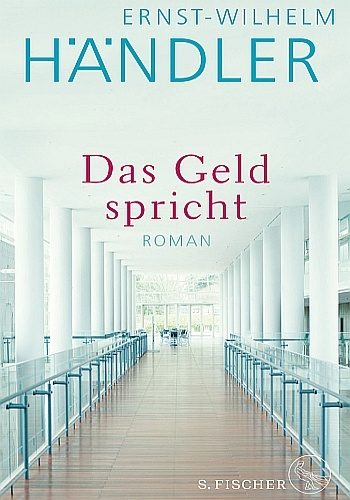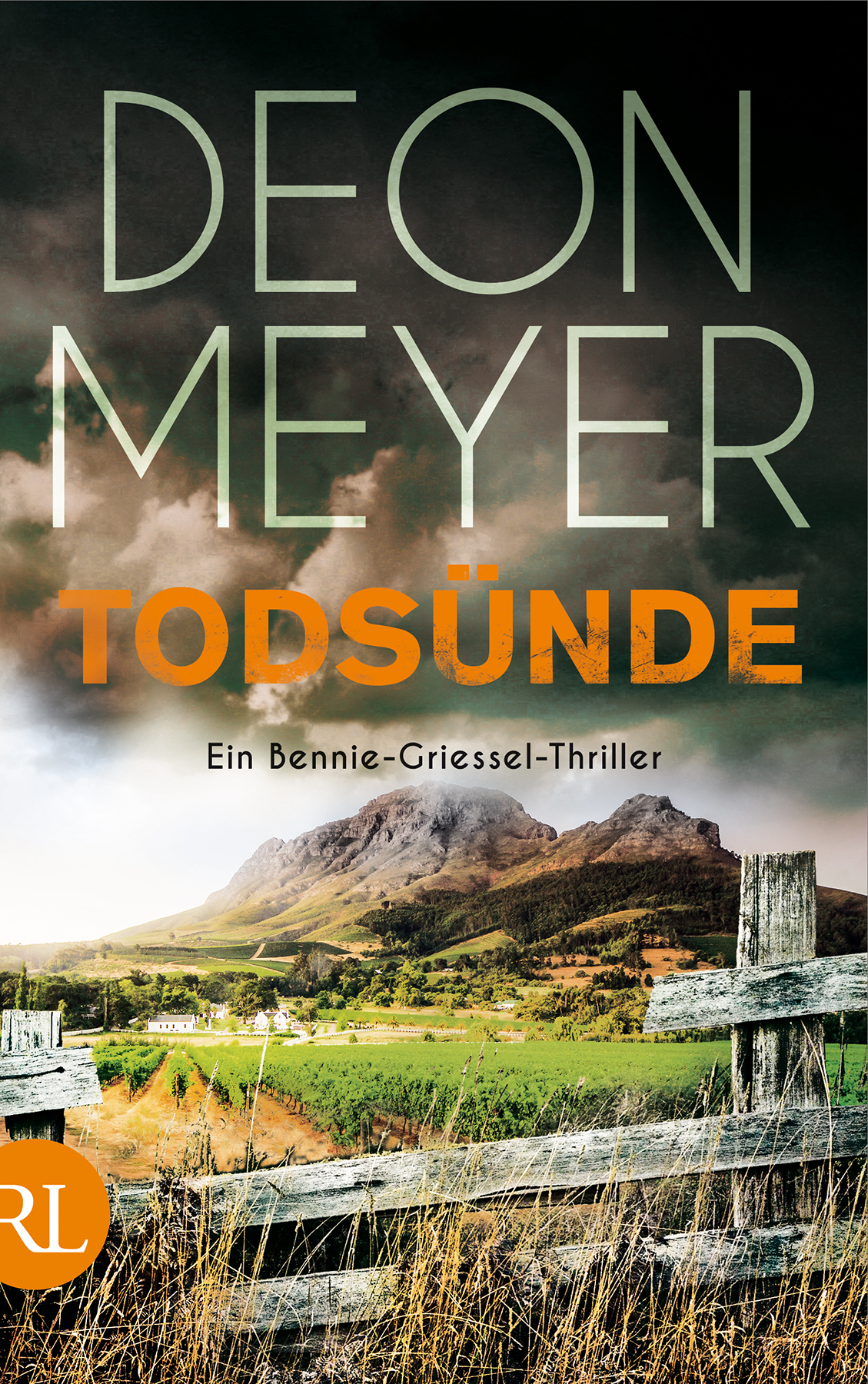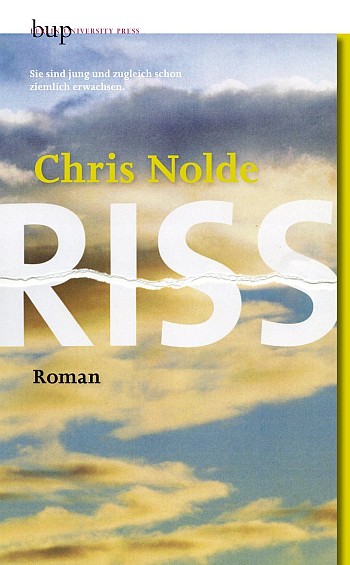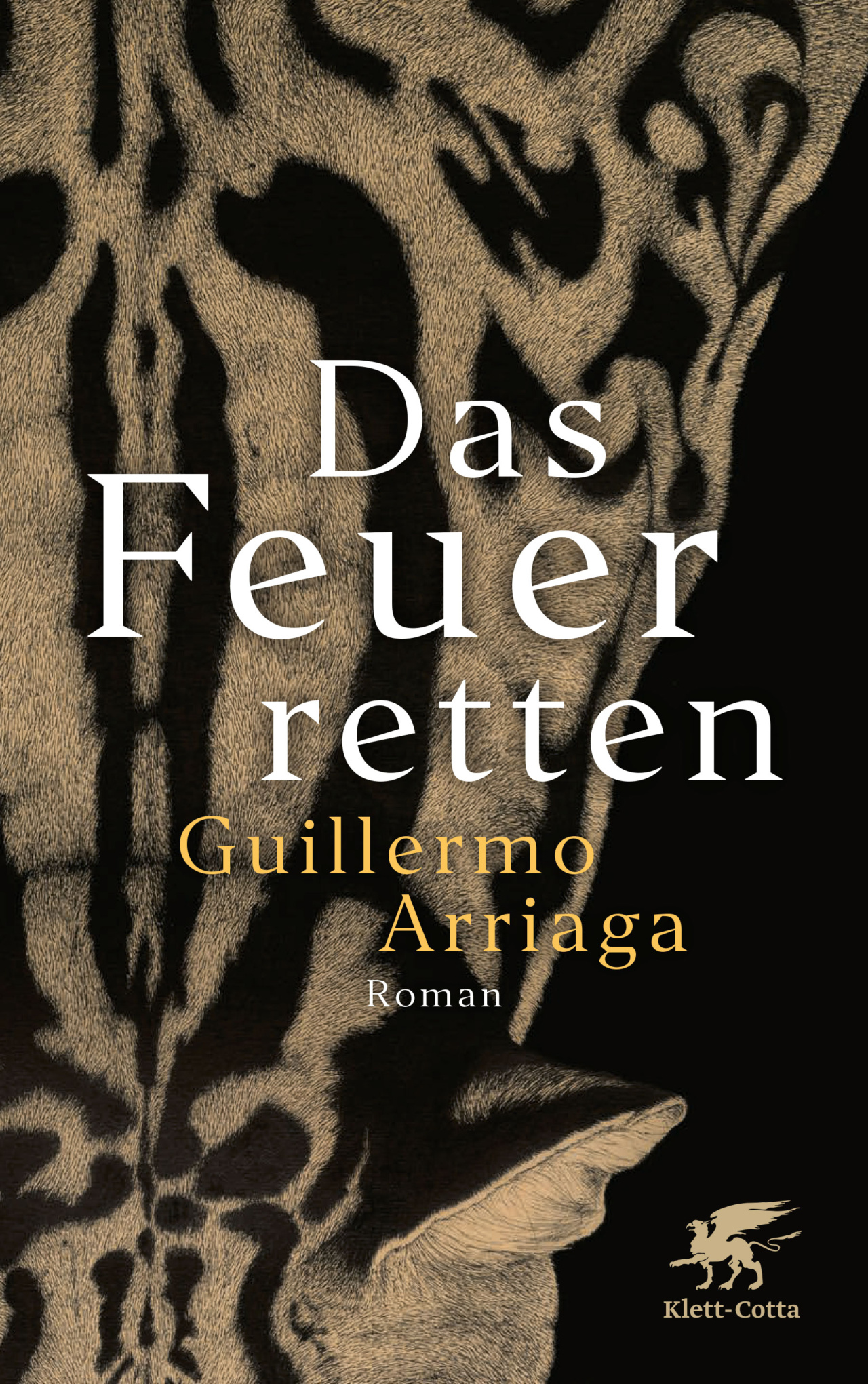Die Sehnsucht nach Stille und Rückzug, nach klösterlicher Klausur, gehört wohl zu allen Schriftstellerfantasien und begleitet Leila Slimani bis zum Kreuzungspunkt zwischen Orient und Okzident. Der Duft der Blumen bei Nacht beschwört die Kraft der Poesie und der Literatur, entführt in entschwundene Gefilde und doppelte Identitäten. Von INGEBORG JAISER
 Der rasante literarische Aufstieg Leïla Slimanis hat nicht nur in Frankreich für Furore gesorgt.
Der rasante literarische Aufstieg Leïla Slimanis hat nicht nur in Frankreich für Furore gesorgt.
Nach dem Erscheinen des ersten Teils einer als Romantrilogie geplanten Familiengeschichte (Das Land der anderen, 2021) erwarten die Leser bereits mit Spannung weitere Bände. Doch Leila Slimani zieht als Joker zunächst ein retardierendes Moment.
Der Duft der Blumen bei Nacht changiert zwischen Essay und Roman, Fakten und Fiktion, klarer Analyse und träumerischen Sequenzen. Und erinnert daran, welch mühsamer Akt dem künstlerischen Schaffensprozess zugrunde liegen kann.
Eine Nacht im Museum
»Oberste Regel, wenn man einen Roman schreiben möchte, ist, Nein zu sagen,« eröffnet Slimani ihr neuestes Buch. Und: »Schreiben ist Disziplin. Es ist Verzicht auf Glück, auf die alltäglichen Freuden.« Um schreiben zu können, muss man sich zurückziehen, von Freunden fernhalten, jede Ablenkung vermeiden. Kein Kinobesuch, kein Spaziergang und keine Einladung zum Abendessen. Oder, wie es Hemingway einmal treffend formuliert hat: »Die schlimmsten Feinde eines Schriftstellers sind das Telefon und Besucher.« Schreiben macht einsam.
Als Kehrseite von Rückzug und sozialer Abschottung vermag idealerweise ein Höhenflug eintreten, ein trancehafter Flow, der einen kreativen Schub entfachen kann. Doch dieser Zustand lässt sich nicht beliebig forcieren. Allzu oft bleiben die erhabenen Momente aus und – wie die Autorin klagt – »meine Figuren reden nicht mit mir«. Mitten in einer dieser Schreibblockaden erhält Leila Slimani von ihrer Lektorin das verlockende Angebot, im Rahmen einer neuen Projektreihe eine Nacht alleine in der Punta della Dogana in Venedig zuzubringen. Ein außergewöhnliches Stimulans? Ein überraschender Kick? Ein ungeahnter Katalysator zur Freisetzung kreativer Kräfte? Oder einfach nur eine willkommene Ablenkung von den üblichen Schreibroutinen?
Begegnung zweier Kulturen
Wer die Punta della Dogana kennt, weiß die Verzauberung des Ortes zu schätzen. Einst im 17. Jahrhundert als Zollstation errichtet und 2009 auf spektakuläre Weise vom Architekten Tadao Ando zum Kunstmuseum umgebaut, ragt der Gebäudekomplex auf einer spitzen Halbinsel in den Zusammenfluss zweier großer Kanäle hinein. Hier liegt der »Begegnungspunkt zweier Kulturen: der abendländischen und der arabisch-byzantinischen Welt.« Eine Verschmelzung von früherer amtlicher Kontrolle und heutiger künstlerischer Transzendenz, zugleich »Eingangs- und Ausgangstor, Grenze und Übergang.«
Welch herausfordernde Einladung für die 1981 in Marokko geborene, einer frankofonen Familie entstammenden Schriftstellerin, die als Jugendliche zum Studium nach Paris gegangen ist, aber stets das Gefühl der Fremdheit, der Andersartigkeit nicht ablegen konnte. Hier im Bauch des mächtigen Gebäudes, versunken in vollkommener nächtlicher Ruhe und Abgeschiedenheit, kann sich Slimani ihrem fließenden Erinnerungs- und Bewusstseinsstrom hingeben. Dem vergangenen Duft des Jasmins neben ihrem Elternhaus nachspüren. Momente der Kindheit heraufbeschwören. Dem schmerzlichen Verlust des Vaters ein Zeichen setzen. Ihre eigene Identität neu ausloten. Aus ihrem reichen Erkenntnisschatz an Film-, Literatur- und Kunsterlebnissen schöpfen und Querverweisen folgen.
Poetische Träume
Ganze Generationen von Schriftstellern sind dem Zauber Venedigs erlegen, ihrer Topografie und berauschenden Ausstrahlung. Doch Leila Slimani mag nicht den abgegriffenen Deutungen der »Serenissima« und »Lagunenstadt« folgen. Am Kreuzungspunkt zwischen Orient und Okzident gelegen, ohne eigenes Land und Boden, erscheint diese Stadt eher wie ein Ankerpunkt in der Zerrissenheit von Traditionen, Geschichten, Identitäten. Slimani nutzt die Magie des Ortes, um sich ihrer eigenen Herkunft und Zugehörigkeit zu versichern, um ein weit verstricktes Netz an kulturellen und künstlerischen Bezügen zu spannen.
Dieses schmale, luftig gesetzte, kaum 160 Seiten umfassende Büchlein mag zwar leicht in der Hand liegen und in einer einzigen Nacht verschlungen werden, doch die Stärke seiner intellektuellen Erkenntnisse und sinnlichen Träume schwingt weiter. Ein poetisches und zugleich sehr aufrichtiges, persönliches Buch, das nicht zuletzt die »Komplexität einer doppelten Identität« offenlegt.
Titelangaben
Leïla Slimani: Der Duft der Blumen bei Nacht
Aus dem Französischen von Amelie Thoma
München: Luchterhand 2022
159 Seiten, 20 Euro
| Erwerben Sie diesen Band portofrei bei Osiander
Reinschauen
| Leseprobe
| Mehr zu Leïla Slimani in TITEL kulturmagazin