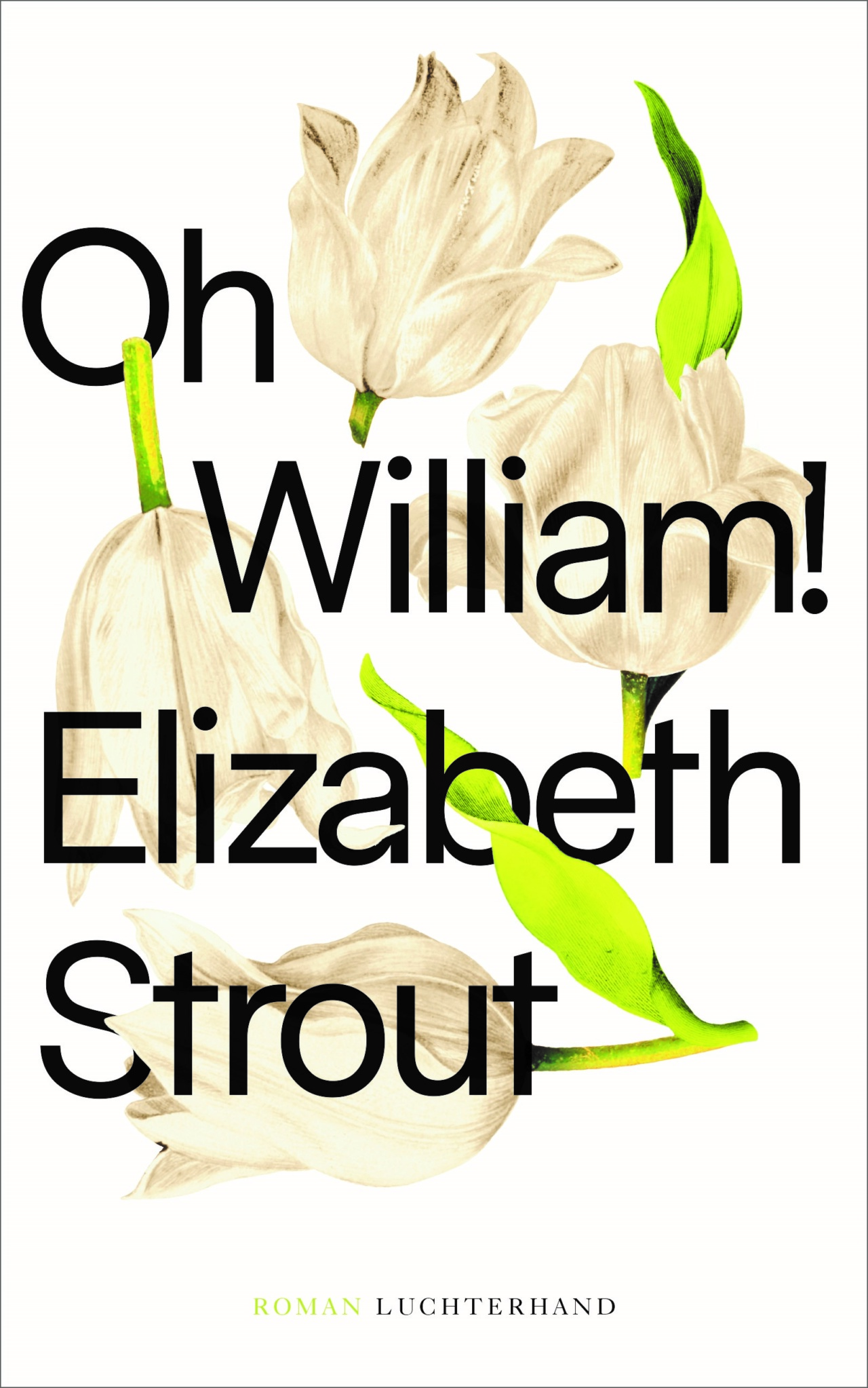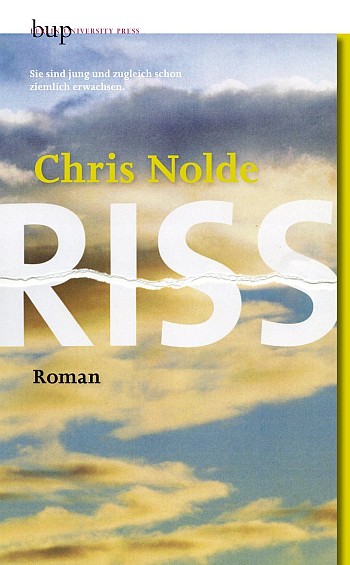Antonio Munoz Molina gehört zu den herausragenden zeitgenössischen spanischen Schriftstellern. Der 66-jährige Autor wird am 18. Oktober als Ehrengast Redner bei der Eröffnung der Frankfurter Buchmesse sein. Munoz Molina hat viele Jahre das Cervantes-Institut in New York geleitet und ist mit den meisten wichtigen Literaturpreisen Spaniens ausgezeichnet worden – bereits 1991 mit dem Premio planeta (den wichtigsten spanischen Literaturpreis) für den Roman Der polnische Reiter. Von PETER MOHR
 Als ihm 2013 der Prinz-von-Asturien-Preis für Literatur verliehen wurde, rühmte man ihn für seinen »brillanten Stil« und die Fähigkeit »bedeutende Momente der Geschichte Spaniens, zeitgenössische Schlüsselereignisse und persönliche Erfahrungen in bewundernswerter Weise zu erzählen.«
Als ihm 2013 der Prinz-von-Asturien-Preis für Literatur verliehen wurde, rühmte man ihn für seinen »brillanten Stil« und die Fähigkeit »bedeutende Momente der Geschichte Spaniens, zeitgenössische Schlüsselereignisse und persönliche Erfahrungen in bewundernswerter Weise zu erzählen.«
Im letzten Jahr war in deutscher Übersetzung sein großartiges, ausschweifendes Assoziationsepos Gehen allein unter Menschen erschienen – es war weder ein Roman noch ein Essay, sondern ein verschlungener, hybrider Text, eine Art erzählerische Collage eines modernen Flaneurs.
Auch Munoz Molinas neuer Roman knüpft formal an diese Assoziationskomposition an. In 52 kurzen, lose miteinander verbundenen Kapiteln begleiten wir die Hauptfigur, den Frührentner Bruno, der sich in Lissabon niedergelassen hat. »Ich habe mich in dieser Stadt niedergelassen, um dort auf das Ende der Welt zu warten. Die Bedingungen könnten nicht besser sein.«
Mit diesem Satz, der ihm bei einem Spaziergang am Ufer des Tejo eingefallen sein soll, startet Munoz Molina in die Handlung. Daraus ist dann eine kaum greifbare Gefühlsmelange entstanden, die den gesamten Roman umgibt – das quälende Gefühl des Wartens.
Der Ich-Erzähler will sich sein Leben als Frührentner einrichten. Doch seine innere Verfassung, sein ständiges Nachdenken über Gott und die Welt, seine hypersensiblen Antennen für kleinste Veränderungen im Alltag sprechen gegen einen geordneten »Ruhestand«.
Seine Frau Cecilia lebt und arbeitet noch in den USA als Naturwissenschaftlerin im Team eines Nobelpreisträgers und forscht nach Möglichkeiten, »schlimme Erinnerungen bei Soldaten mit posttraumatischer Belastungsstörung zu unterdrücken.« Und gerade diese Cecilia leidet selbst sehr stark an den Nachwirkungen des 11. September 2001. »Weit von uns entfernt stieg am südlichen Ende der Insel noch immer die große schwarze Wolke mit dem Flammenrot in ihrem Innern genau an der Stelle des Horizonts auf, an der vor ein paar Tagen, und später dann vor Wochen, die beiden Türme gestanden hatten. In Cecilias Träumen näherten sich die Flugzeuge im Tiefflug und rasten in einen Turm und danach in den anderen inmitten eines Feuerballs, immer wieder, so wie man es im Fernsehen sah. Wir erlebten das Ende der Welt direkt am Bildschirm des Fernsehers.«
Bruno sitzt in Gesellschaft seiner Hündin Luria in seiner Wohnung in Lissabon und sieht den Handwerkern bei den Renovierungsarbeiten zu. Alles soll so hergerichtet werden wie in der letzten gemeinsamen Wohnung.
Der Protagonist lässt immer wieder das Leben in den USA Revue passieren – Aids, den 11. September, wechselnde Präsidenten und die zunehmende Digitalisierung. Er sitzt oft nächtelang vor dem TV, konsumiert Nachrichtensender aus aller Welt und setzt sich damit einer Art negativen Reizüberflutung aus. Waldbrände, Überschwemmungen, immer mehr Hurrikans – der Klimawandel lässt grüßen.
Zu den Mahlzeiten legt er stets ein Gedeck für Cecilia auf – eine wahrlich seltsame Art des Wartens. Cecilias Abwesenheit erhält etwas Mysteriöses. Es gibt keinen wirklichen Kontakt – kein Telefon, keine Nachrichten via Internet, nicht einmal einen konkreten Zeitpunkt ihres Eintreffens.
Das Romanende soll an dieser Stelle nicht verraten werden. Warten auf Cecilia ist ein gleichermaßen rätselhaftes wie liebevolles Buch über das turbulente Innenleben eines vereinsamten Außenseiters. Wirklich eines, das unter die Haut geht. »Nachts sitze ich gerne in Cecilias Arbeitszimmer an ihrem Schreibtisch, vor mir die riesige Karte des menschlichen Gehirns.
Titelangaben
Antonio Munoz Molina: Tage ohne Cecilia
Aus dem Spanischen von Willi Zurbrüggen
München: Penguin 2022
272 Seiten, 25 Euro
| Erwerben Sie diesen Band portofrei bei Osiander
Reinschauen
| Leseprobe
| Mehr zu Antonio Munoz Molina in TITEL kulturmagazin