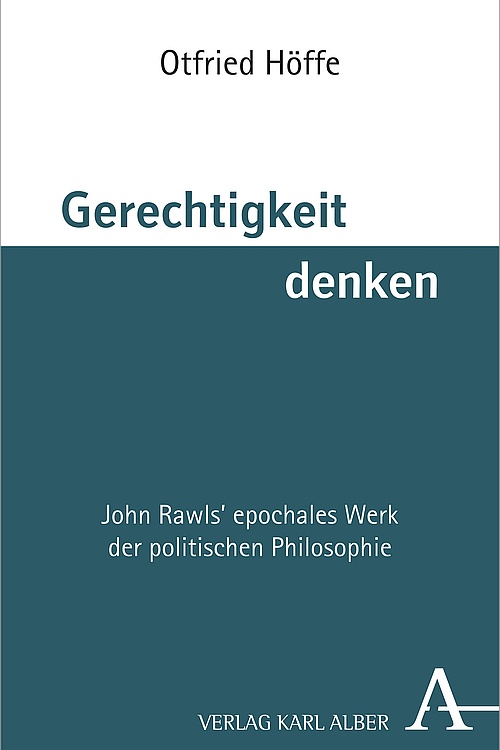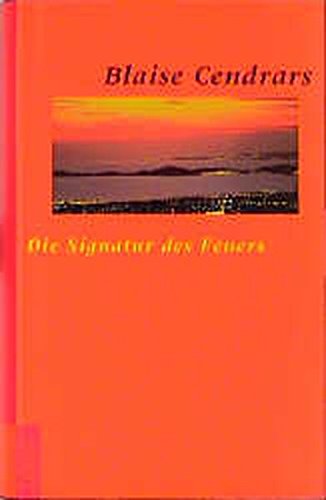»Ein Schriftsteller ist kein Zauberer. Er kann das Fehlverhalten eines Landes, das auf den Abgrund zusteuert, nicht wegzaubern. Er trägt allerdings Verantwortung für sein Werk, auch wenn dieses unter widrigen Verhältnissen entsteht. Ich habe nicht erst über den Kommunismus geschrieben, als man es tun konnte«, hatte der albanische Schriftsteller Ismail Kadare erklärt, der über Jahrzehnte hinweg vor allem als politischer Chronist seines Heimatlandes wahrgenommen wurde und oft als Nobelpreiskandidat gehandelt wurde. Von PETER MOHR
Albaniens politischer Sonderstatus nach dem Bruch mit der Sowjetunion Anfang der 1960er Jahre und Kadares glühender Patriotismus (»Albanien ist die rebellischste aller Nationen.«) weckten eine gehörige Portion Neugierde auf seine Romane, die seit den 1980er Jahren in deutscher Sprache vorliegen und in mehr als 20 Sprachen übersetzt wurden. Kadare, der am 28. Januar 1936 in der südalbanischen Stadt Gjirokastra als Sohn eines Gerichtsboten geboren wurde und Literaturwissenschaften in Tirana und später am Moskauer Gorki-Institut für Weltliteratur studierte, hat 2005 einen vorläufigen Höhepunkt seines internationalen Ruhms erfahren, als ihm in London der mit rund 85.000 Euro dotierte International Booker Prize für sein Lebenswerk zugesprochen wurde.
Kadare, der als Lyriker debütierte und die französischen Romanciers des 19. Jahrhunderts schätzt, erregte 1964 erstmals (über seine Landesgrenzen hinaus) mit seinem Roman ›Der General der toten Armee‹ Aufsehen. Darin hat ein hoher italienischer Offizier 20 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs den Auftrag, die sterblichen Überreste seiner in Albanien gefallenen Landsleute heimzubringen. Dieser Roman, der in Frankreich unter anderem mit Michel Piccoli und Marcello Mastroiani verfilmt wurde, changiert zwischen dämonischem Schauermärchen und historischen Überlieferungen.
Nie hat sich Kadare (auch nicht in seinem patriotisch-hymnischen Roman ›Der große Winter‹) einer Form des sozialistischen Realismusʼ verpflichtet gefühlt. Das formale, beinahe spielerische Experiment mit Mythen und Wahrheit dominiert das Gros seiner Erzählwerke – so ›Der zerrissene April‹, ›Die Brücke mit den drei Bögen‹, ›Der Palast der Träume‹, ›Chronik in Stein‹ und zuletzt ›Das verflixte Jahr‹.
Vielleicht hat Kadare, der 2009 mit dem Prinz-von-Asturien-Preis ausgezeichnet wurde, in der ambivalenten Figur des Doktor Gurameto in seinem Roman ›Ein folgenschwerer Abend‹ (2010) die eigene politische Zerrissenheit (leicht verfremdet) einfließen lassen. Die Handlung ist in Kadares Geburtsort Gjirokastra angesiedelt und spielt im Herbst 1943.
»Ich habe im Alter von zehn Jahren Macbeth gelesen. Ich war so begeistert, dass ich das ganze Stück von Hand abgeschrieben habe«, erinnerte sich Kadare, der 1990 mit seiner Familie von Tirana nach Paris übersiedelte, an sein literarisches Schlüsselerlebnis. Je mehr sich Albanien in den 1990er-Jahren dem Westen öffnete und die Demokratie etablierte, umso stärker wurden die kritischen Stimmen über Kadares Wirken.
Ungeachtet der zahlreichen Widersprüche, in die sich Kadare im Laufe der Jahre verfangen hat (»Meine besten Romane sind auf dem Höhepunkt der kommunistischen Diktatur entstanden« und andererseits »Authentisches Schreiben und Diktatur sind nicht vereinbar«), war er ein großer Erzähler, ein fabulierender Grenzgänger zwischen fantasievollen Märchen und knallharter Politik, in die er sich immer wieder eingemischt hat. Beeindruckend war seine bis ins hohe Alter ungebrochene Produktivität. Zuletzt war 2019 in deutscher Übersetzung der Roman ›Geboren aus Stein‹ erschienen. Gestern ist Ismail Kadare im Alter von 88 Jahren in der albanischen Hauptstadt Tirana an einem Herzinfarkt gestorben.
| PETER MOHR
| Titelfoto: Lars Haefner, Ismail Kadare, CC BY-SA 3.0